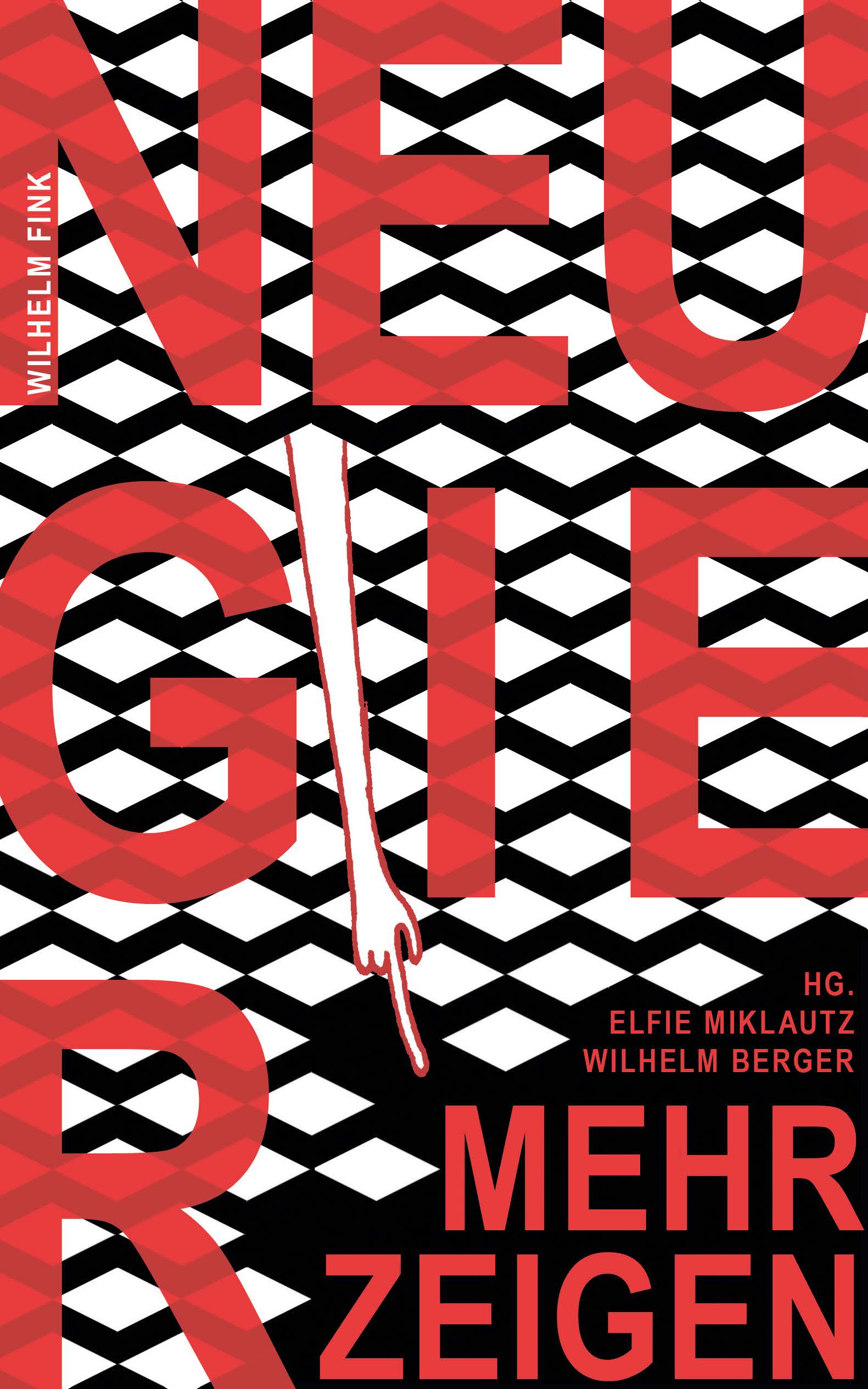Zur 500. Wiederkehr der lutherschen Umstellung von evidenzbasierten auf begriffsgestützte Glaubensbekenntnisse ist es angebracht, die Aktualität dieser Unterscheidung in Erinnerung zu rufen.
Heute liegt die Priorität allerdings nicht so sehr in der Bedeutung der Theologie als vielmehr im Konsum. So halten es zum Beispiel die bildgestützten Konsumrealisten für selbstverständlich, als Produzenten über Reklameschilder noch kurz vor der Kasse Kaufappelle zu erteilen, während es die Konsumenten für selbstverständlich halten, auf diese Appelle zu reagieren. Der Kaufappell zielt darauf ab, den Augen als dem schnellsten Weltvermittlungsorgan mehr zu trauen als dem Kleingedruckten. Vor dem Supermarktregal vollzieht sich die Synthese von Ergreifen durch die Hand und Begreifen durch das Hirn beschleunigt. Die üblich gewordene Handlungsdynamik des Aneignens hebt die ästhetischen, epistemologischen und ethischen Differenzen zwischen Wesen und Erscheinung, zwischen Abbild und Abgebildetem und zwischen Vertrauenswunsch und Täuschbarkeitserfahrung auf bis zum späteren Überprüfen der Ware im Gebrauch, durch den die erzwungenen Synthesen wieder aufgelöst werden. Die Konsumrealisten glauben fest, dass man isst, was man sieht; das Auge isst nicht nur mit, sondern mit dem Auge isst man – wenigstens bis zur Kontrolle durch den Geschmacks- und Geruchssinn. Aber diese Kontrolle ist kulturrelativ; faule Eier können auch eine Delikatesse sein.
Die Konsumidealisten (Wolfgang Ullrich) hingegen richten sich ausschließlich nach den begrifflich ausgewiesenen Inhaltsstoffen der Produkte, sie leben begriffsgesättigt in der Gewissheit, dass Substanzen von ihren Akzidentien zu trennen sind in der reinen Idealität der Einheit von Begriff und des unter ihm Begriffenen. Die Realisten profitieren von der akzeptierbaren Einheit des Bildes der Nahrung auf der Verpackung und deren Inhalt. Die Idealisten leben von der behaupteten Wahrheit als adaequatio von Begriff und zu Begreifendem. Mit den so vorausgesetzten Identitäten als Einheit des Unterschiedenen werden die realistische wie die idealistische Haltung gleichermaßen begründungspflichtig.
Dem seit alters tradierten Streit um den Wirklichkeitsanspruch von Bildern und Begriffen kann man wohl am besten begegnen mit einer Orientierung auf das Zeigen als Handlung, die zum Zeichen wird. Denn nur im Zeichen, etwa als Bild, lässt sich Bezeichnendes und Bezeichnetes als Bild und Abgebildetes unterscheiden.
Auf der Handlungsebene ist die Einheit von Zeigen und Weisen im Bezeugen gesichert, weswegen wir überzeugend sein müssen, wenn wir etwas zu zeigen als Beweis gelten lassen wollen.
Evidenzerzeugung durch Evidenzkritik
Weltvertrauen durch eigenen Augenschein nennen wir Evidenzerfahrung. Vertrauen in die Wiederholbarkeit von Handlungen baut Erfahrung auf. Evidenzerleben bestätigt unser Urteil nach eigenem Augenschein und damit unser Vertrauen in die eigene Urteilskraft. Evidenzerleben ist also ein Wiedererkennen von Sinnfälligkeiten, unter denen die Aussage „Ja, genau so erkenne ich es“ die bekannteste ist. Am stärksten leuchtet eben ein, was wir als sinnfällig erfuhren, zum Beispiel Ursache-Wirkungs-Verhältnisse als bewährte Unterscheidung von Früher und Später, von Innen und Außen, von zur Sichtbarkeit Enthülltem und unsichtbar Gebliebenem.
Das Verhältnis zwischen beiden Seiten überbrücken wir durch ostentatives Bezeugen als Einheit von Zeigen und Weisen. Das Weisen wird im Beweis beendet, das Zeigen im Evidenzerleben. Weil aber Evidenz jeweils nur für den Einzelnen gilt, muss deren Gültigkeit bezeugt werden, damit sie anderen verbindlich erscheinen kann.
Da wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass wir trotz subjektiver Glaubwürdigkeit objektiv Täuschungen unterliegen, ist Evidenz nur dann zu akzeptieren, wenn in sie die Erfahrung der Täuschbarkeit eingegangen ist. Das wird durch Kritik der Evidenz möglich, wie sie etwa Wissenschaftler üben, wenn sie ihrem Augenschein die Evidenz von Zahlen und Zeigern entgegensetzen. Das Ablesen von Zahlen und Zeigern ist seinerseits Evidenzerleben, aber abgesichert durch eine Kritik des Augenscheins. Zugleich und in Einheit mit den Wissenschaftlern erobern bildende Künstler als historisch neue Tätertypen seit dem 14. Jahrhundert unsere Aufmerksamkeit, weil sie etwa das Gemälde (per se ein Sinnenerleben) als Evidenzerleben vertrauenswürdig erscheinen lassen, indem sie zeigen, wie abhängig die Wahrnehmung von den gewählten Darstellungsmitteln ist.
Kulturgeschichtlich, das heißt vor allem religionsgeschichtlich, bedeutet die künstlerische Evidenzerzeugung durch Evidenzkritik die Auflösung des apokryphen Bilderverbots etwa im Judentum oder im Islam. Sich kein Bildnis machen zu dürfen, kann ja nur denen gelten, die Bildnisse herstellen, also kann die Erfüllung des Bilderverbotes nur durch Bildermachen gelingen. Denn das simple Unterlassen des Bildermachens ließe auch das Gebot ins Leere laufen. Für die europäische Epistemologie (Arno Bammé) ist deshalb Religionskritik nicht schlichtweg zerstörerisch, sie zeigt vielmehr, dass sich der Glaube erst als Zweifeln bewähren kann. Deswegen ist es in Europa ganz und gar unspektakulär, wenn viele Theologen, die Kritik als Wissenschaft betreiben, zu Atheisten werden und, mit Nietzsche, das stärkste Verlangen nach bewährtem Glauben in der Unfähigkeit zu glauben identifizieren. Zeitgemäß modern mit Martin Walser ausgedrückt, heißt das: Gott ist tot, aber wir vermissen ihn auf Schritt und Tritt. Von ähnlichen Ausprägungen der negativen Theologie und negativen Ästhetik lassen sich gegenwärtig die entscheidenden Leistungen von Künstlern und Wissenschaftlern generell herleiten.
Konformität in der Abweichung
Es ist nicht fauler Zauber, sondern Resultat der Bezeugung von Evidenzen und Beweisen, wenn so gut wie jedermann dem Argument folgt, etwas sei bewährt, weil es von vielen akzeptiert wird. Wir kaufen mit größtem Vertrauen, was andere immer schon auswählten. Selbst für Nörgler und Kritikaster gilt noch dieser Konformitätsdruck, dessen Geltung heute in der Verpflichtung von jedermann auf Eigenständigkeit zu sehen ist. In der Tat: Die stärkste, belastbarste Gemeinschaft ist die der Einzelgänger als ausgeprägten Individualisten, die eben deswegen etwa in wissenschaftlichen Teams besonders gut kooperieren können, weil sie als Individualisten mögliche Konkurrenz gar nicht wahrnehmen oder aber als Herausforderung zum Wettkampf, d.h. zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit verstehen.
Bewährter Glaube
Mit Verweis auf das Eingangsstatement gilt, dass Menschen mit starkem Glauben länger, gesünder, weil bindungstreuer leben. Aus der Erfahrung der berufsmäßigen Begleitung von Sterbenden lässt sich schließen, dass man viel schöner stirbt, wenn man fest ans Wiedersehen im Paradies, an die Gnade Gottes, an die Seelenwanderung glaubt. Schöner Sterben ist kein Zynismus, sondern ergibt sich aus der Logik von Versuch und Irrtum, die im Kleinstkindalter mit learning by crying beginnt, in der Pubertät durch learning by denying fortgesetzt wird, dann mit learning by trying, learning by buying und learning by sighing eben zum learning by dying führen muss. Der Denker Ernst Bloch gab Auskunft über seine Erwartung, schön sterben zu können, weil er neugierig darauf sei, was er durch den Tod lernen würde über das Jenseits des Todes.
Selbst Transzendentalphilosophen, die sich der Grenzen ihres Denkvermögens bewusst sein zu können behaupten, müssen gerade dem Tode hoffnungsvoll entgegenblicken in der logisch unabweisbaren Schlussfolgerung, dass im Tode eröffnet werde, was ihnen durch die Grenzen des Verstandes per Definition unzugänglich bleiben musste.
Mit Hegels Kritik an Kant heißt das, dass mit den Grenzen der Erkenntnis das Jenseits der Grenze zu fassen unabdingbar wird. Das meint, alles Weisen als Verweisen zu bestimmen. Grenzen werden damit zu Horizonten, die stets auf das Jenseits des Horizonts abzielen; fließende Grenzen, die das bisher Durchschrittene als ein vorher Unbekanntes erweisen und alles jenseits der Grenzen als ein jederzeitiges Diesseits, wenn man nur immer dem Horizont weiter entgegenläuft.
Grenzen sind also Verweisungszusammenhänge zwischen Aktualität und Potentialität des Zustands, wofür in der allgemeinen Erfahrung das Wetter steht, denn alles Wetter wird auf ein Zukünftiges hin bewertet: Wie wird das Wetter in Zukunft aus dem, was es gegenwärtig ist? Das morgige Wetter ist nicht unserer heutigen Feststellung des Wetters transzendent, sondern Konsequenz der Verschiebung des Beobachtungshorizonts zwischen Heute und Morgen. Die heute sichtbaren Erscheinungsformen wetterbildender Faktoren beweisen sich in der morgigen Feststellung des Wetters. Die nicht zutreffende Vorhersage ist aber kein Beweis ihrer Unmöglichkeit, sondern ein Hinweis auf den nicht hinreichend erfassten Verweisungszusammenhang. Den zeigen Vorzeichen an, die ja jetzt evident sind, als heutiges Wetter sichtbar. Was wir in den Zeichen anzeigen, ist die Erfahrung eines Verweises auf das Morgen als das Jenseits von heute.
Im Zeigen steckt also immer die Konfrontation mit dem Angezeigten als mittelbar evident, wobei dieses Evidenzerleben der Anzeichen für morgiges Wetter erst durch die Erfahrung vertrauenswürdig wird, dass die Evidenz unter Kritik von Barometern, Hygrometern und Thermometern zustande kommt.
Zeigen des Gegebenen, um es als Verweis zu nutzen
Zeigen beruht also auf Evidenz durch Konfrontation mit real Gegebenem (Lambert Wiesing), Weisen hingegen ist eine intentionale Geste zur Organisation von Aufmerksamkeit auf das, was nicht sichtbar ist, also Evidenz nicht zulässt. Das Theater hat in der Teichoskopie eine Bezeugungsroutine für das Verhältnis von Zeigen und Weisen entwickelt. Gezeigt wird, was auf der Bühne geschieht, darunter auch, wie jemand mit Intentionalgesten auf das verweist, was jenseits der Bühne geschieht und eben nicht sichtbar ist.
Solche Bezeugungsroutinen entstammen der Erfahrung einer unverbrüchlichen Einheit von Blitz und Donner. Die Routine ermöglicht es, durch die zeitliche Differenz von Blitz und Donner in etwa die Entfernung des Wahrnehmenden vom Wetterereignis einzuschätzen. Zeitlich kurzer Abstand zwischen Blitz und Donner zeigt Nähe zum Ereignis an und vice versa. Derartige Bezeugungsroutinen, das Verhältnis von Zeigen und Weisen, von Evidenz und Beweis bestimmen unseren Alltag nach der Erfahrungsweisheit: Wo Rauch, da auch ein Feuer; wo ein Angstschrei, da ein Verbrechen; wo man singt, da ist gut niedersetzen. Wie stark Bezeugungsroutinen sein können, erwies sich etwa nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als längst alle Bombardements aufgehört hatten, aber beim Testheulen der Sirenen jedem Kriegskind das schon lange zurückliegende Realerleben aktuell wieder aufgenötigt wurde.
Die stärkste Bezeugungsroutine zwischen Zeigen und Weisen, zwischen Evidenz und Beweis entstammt aber der frühkindlichen face-to-face-Kommunikation zunächst mit der Mutter, dann mit anderen Bezugspersonen. Im Mienenspiel zeigen sich Verweise auf intrapsychische Prozesse im Gegenüber. Nach einiger Erfahrung im Hinblick auf mimischen Ausdruck von psychischen Vorgängen stärken die Lernenden das Vertrauen in ihr eigenes Deutungsvermögen durch die Erfahrung der Möglichkeit zu lügen, also den expressiven Gesten (Mimik, Haltung, Handlung) willkürlich eine Bedeutung zuzuordnen, durch die das Gegenüber getäuscht werden soll.
Expressions- und Kognitionsvermögen entwickeln sich in dem Maße, wie sich Lügen als Autonomie- und Souveränitätsgeste bewährt. Zum Instrumentarium dieses Trainings in der Unterscheidung von Wahr und Falsch gehört die Orientierung auf das Risiko des Nichtgelingens, denn „wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht“. Um das Risiko zu minimieren, muss man sowohl das Zeige- wie das Weisewerkzeug erheblich verfeinern, das heißt, uneindeutiger werden lassen. Das mindert die Gefahr, dass das Lügen misslingt. Auf der Seite des Zeigens ist es die nahezu irritierende Differenzierung von Herzeigen, Anzeigen, Aufzeigen, Vorzeigen und schließlich Erzeigen als Evidenz oder auf der anderen Seite von Ausweisen, Aufweisen, Abweisen, Vorweisen, Verweisen, Hinweisen mit dem Höhepunkt des Beweisens.
Monstranz und Demonstranz
In den Ideologien erhalten diese Bezeugungen ihre Massenwirksamkeit. Im Publikumsverhalten in Theatern oder Konzertsälen, bei kirchlichen Ritualen oder Parteiaufmärschen wird gleichermaßen erkennbar, dass Zeigen und Weisen für ein Adressatenkollektiv zur Einheit werden, indem die Adressaten eben diese Einheit bezeugen. Das tun sie, indem sie einem gezeigten Realobjekt, das zum Beispiel nur durch eine Monstranz, ein Zeigezeug, in den Bereich der Sichtbarkeit fürs Kollektiv erhoben werden kann, folgen, nachfolgen, also dem Zeigen aufs Verwiesene eine verhaltensbestimmende Kraft zugestehen.
Monstranz ‚Bühne‘ – Demonstranz ‚Publikum‘, Monstranz ‚Bild an der Wand‘ – Demonstranz ‚Betrachterscharen im Museum‘, Monstranz ‚Reliquie‘ – Demonstranz ‚Gläubige‘: Die Relation geht auf in der Fähigkeit, einerseits das Liebste gut zu zeigen und andererseits das liebste Gut zu zeigen, das heißt, zu bekennen, dass etwas gezeigt wird und dass es als auffällig, sehenswürdig, verehrungswürdig gezeigt wird. Gemeint, ja gefeiert wird die Kraft des Zeigens als Verweisen, Verweisen auf höchste Güter, Götter und Gedanken.
Wir erkennen, dass jedes Zeigen, auch das reflexive, ein Verweisen ist. Es sind die höchsten Feste der Menschheit, die das Verweisen als Erscheinung feiern, aber tatsächlich feiert man die Fähigkeit zu verweisen. Epiphanien, Diaphanien sind als Vorschein dessen, worauf sie verweisen, bewährt, so wie die Annahme des morgigen Wetters durch das heutige. Das heißt, sie eröffnen die Gewissheit eines Morgens, eines Kommenden aus der Kraft des Zeigens als Verweisen.
Das sind Erfahrungen für das Evidenz- und Beweiserleben, die selbst noch die strikteste empirische Forschung tragen. Wer Kleinteilchenphysik betreibt und den Fortschritt in der Fähigkeit, das kleinste Unteilbare, das atomon zu zerteilen, nachvollzieht, ist beim Anzeigen der quarks mit den gleichen Verweisungszusammenhängen konfrontiert wie bei der Differenzierung von Atomkern und -schale, von Elektronen, Neutronen und Protonen – bis am Ende der Erkenntnisfortschritt der Physik nur noch durch das Vorzeigen der Werkzeuge von Physikern aussagekräftig bezeugt werden kann. Werk ist dann Werkzeug im Gebrauch. Erkenntnis erweist sich im Bau der Werkzeuge, nicht aber jenseits ihres Gebrauchs.
Das bedeutendste aller Werkzeuge ist das Zeichen und seine Entfaltung in der Zeichengebung. Auf die Vergegenständlichungsform etwa als Schrift oder Bild, als Sprechen oder Gestikulieren kommt es nur in Bezug auf ihre situationsbedingte Praktikabilität an.
Evolution der Erkenntnis
Das Bezeugen der Einheit von Zeigen und Verweisen, die Beglaubigung der gezeigten Monstranz durch die Demonstranten ist nur so lange bedeutsam, wie die Bezeugung statthat. Das markiert einen Verweisungszusammenhang, den man herkömmlich unter dem Begriff Evolution fasst. Sie hat kein eschaton, kein Ziel, in dem sie enden könnte, weswegen etwa die heute von Kosmologen wahrgenommenen Anzeichen der Evolution des Kosmos nicht in der Feststellung erfolgreich sind, dass alles mit dem Urknall begann. Denn im Beginnen ist der Vorbeginn als Sachverhalt mit gegeben und das kann mit Blick auf die Kosmologie nur heißen, dass der Urknall weder einen Anfang noch ein Ende darstellt, sondern einen Verweisungszusammenhang zwischen Entstehen und Vergehen als Voraussetzung für Entstehen und Vergehen etc. ad infinitum.
Ähnliches gilt für die Evolution von Lebewesen. Den menschlichen Körper bewohnen mehr Viren und Bakterien, als er Zellen hat. Unsere DNA besteht zu erheblichen Teilen aus dem eingebauten Erbmaterial unserer Parasiten.
Den für unser Leben gefährlichsten Parasiten, den Retroviren, verdankt sich die Entstehung der Gattung der Säugetiere. Retroviren setzen das Immunsystem ihrer Wirte außer Kraft; Säugetiere konnten nur entstehen, weil durch Retroviren die Abstoßung von Fötus und Placenta als Fremdkörper verhindert wird.
Auf die daraus ableitbare Erkenntnis verweist ein formidabler Witz: Mond und Erde unterhalten sich. Klagt der Mond: Mich piesacken dauernd Asteroiden. Antwort Erde: Mich die Menschen! Das zielt auf die Analogie im Verhältnis von Viren und Bakterien im menschlichen Organismus zu Menschen als Viren und Bakterien des Planeten Erde.
Analogie und Metapher
Generell kann Erkenntnis nur durch Analogiebildung vermittelt werden. Das erledigen wir routiniert als Metaphernbildung zwischen Zeigen und Weisen. Die Bezeugungspraktiken durch Metaphorisierung gründen sich auf die Erfahrung, dass wir Evidenzen, die durch Evidenzkritik entstanden sind, als Beweise akzeptieren können. Die Erfahrungen zeigen sich in Feststellungen wie „im Größten wie im Kleinsten“, „im Jenseits wie im Diesseits“, „in der Ferne wie zu Hause“, oder, mit Kant und Lieschen Müller, also den schlechthinnigen philosophischen Autoritäten: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Und ist das nicht Sinn aller Erkenntnisbestrebung, dass es deutungslose Zeichen (Hölderlin) nicht geben kann, weil „deutungslos“ eben eine höchst bedeutsame Bedeutung darstellt? Das Ende des Jenseitsgeraunes – denn jedes Jenseits, auf das wir verweisen, ist als Zeichen im Diesseits ganz real.
Verweisen ist das Zeigen des Unzeigbaren, aber als ein Zeigbares, ein Zeichen; das Darstellen des Undarstellbaren ist eine Darstellung und das Denken des Undenkbaren ist eben der Gedanke „das Undenkbare“.
Das Undenkbare denken, das Undarstellbare darstellen und das Unvorstellbare vorstellen zu können, erlaubt uns die Zeichengebung als gegebene Einheit von Zeigen und Verweisen, von Evidenz und Beweis, solange wir durch den Gebrauch der Zeichen eben dieses Gelingen der Einheit bezeugen. Also lesen wir in Büchern und Mimiken, in Bildern und Partituren als Zeugnissen einer möglichst viele Generationen umfassenden Bezeugungsroutine, herkömmlich Tradition genannt, die immer erneut durch besagtes Lesen gewährleistet, also im Zeichengebrauch neu geschaffen werden muss.
Anmerkung
„Monstranz und Demonstranz“ 1977 in vielen Städten als „Zeig Dein liebstes Gut – zeig Dein Liebstes gut“, in Bazon Brock, Der Barbar als Kulturheld, 7. Aufl., Köln 2012. Zur ästhetischen Differenz etc., in Bazon Brock, Die Gottsucherbande – Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit, Köln 1986; darin auch „Avantgarde und Tradition – Über die Funktion des Neuen“. „Über die Grammatik der Zeichen“ (Bildsprachliche Negation oder Konditional- und Konsekutivsätze)“, in: Bazon Brock, Ästhetik als Vermittlung, Köln 1977.