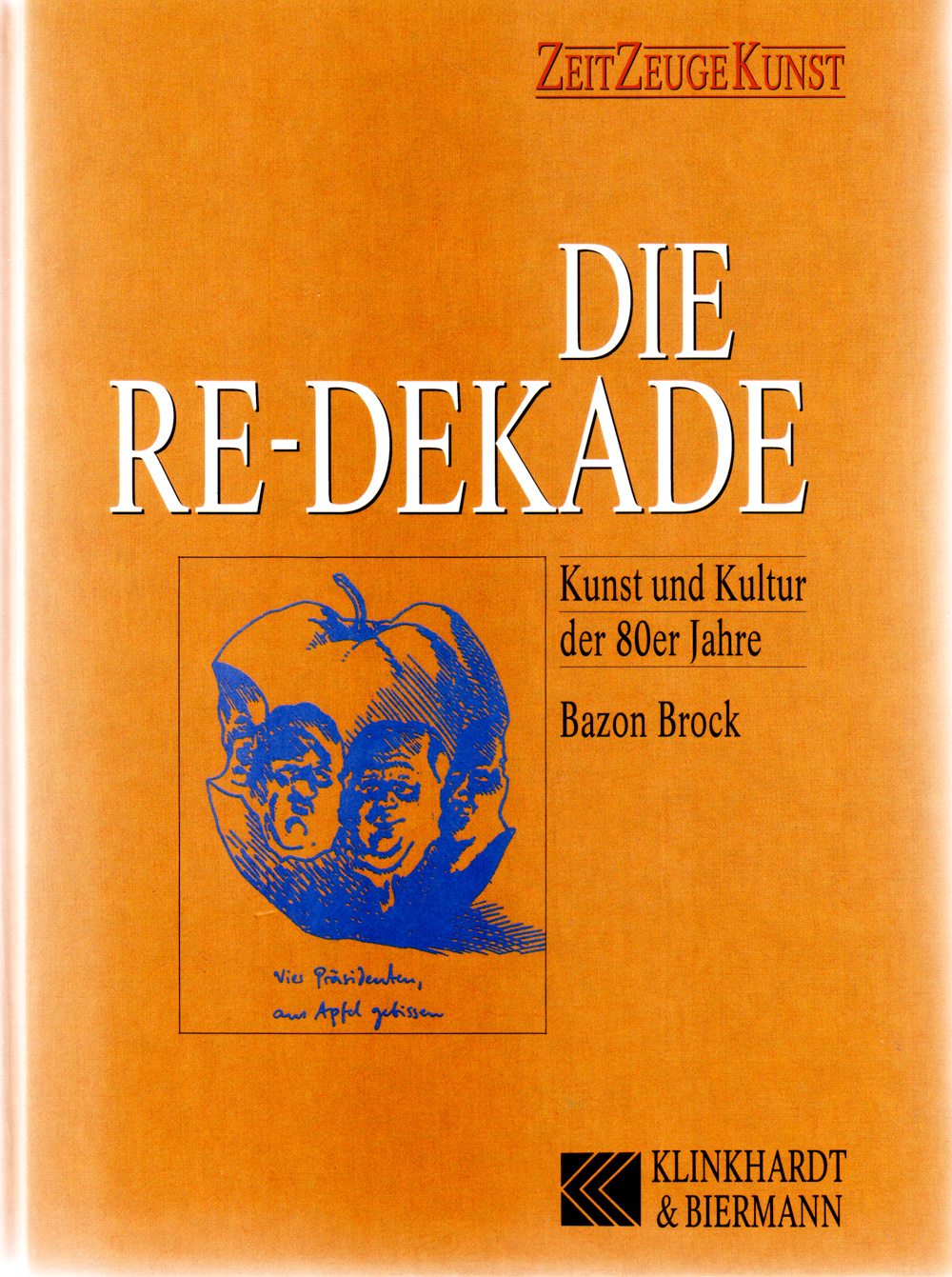In der öffentlichen Diskussion wie in Fachkreisen kursieren Begriffe als kritische Größen, deren Verwendungshäufigkeit fast durchweg als Bestätigung ihres Realitätsgehalts gewertet wird. Man behauptet mit kulturkritischem Pathos, unsere Wirklichkeit bestehe schon weitgehend in einer elektronischen Totalsimulation; die Zeichen transportierenden Medien seien ihre eigene Botschaft; der Medienanalphabetismus nehme rapide zu. In der Bundesrepublik verbreiten gerade diejenigen gesellschaftlichen Kräfte solche kulturkritischen Einschätzungen, die alles daran setzten, den Medienmarkt entscheidend zu erweitern. Sie begründeten ihre Forderung nach Etablierung von noch mehr Medienangeboten durch private Sender mit der Behauptung, die freie Entfaltung von Meinungen sei nur durch die Vergrößerung des Medienausstoßes garantiert. Läßt sich dieser Widerspruch zwischen der beklagten Auswirkung des Medienkonsums und der Forderung nach Ausweitung der Angebote anders bewerten als die schon lange bewitzelte Tatsache, daß die Kulturkritiker zwar auf die Glotze schimpfen, dennoch aber allabendlich vor ihr hocken? Es mag zwar in einer Hinsicht belegbar sein, daß der Analphabetismus wieder zunimmt – aber sicherlich nicht notwendigerweise durch verstärkten Einfluß der Medienprogramme; denn andererseits ist die Sensibilisierung der Bevölkerung für die Problematik der technischen Evolution, des Rüstungswettlaufs, der apparativen Medizin, der Umweltzerstörung zu keiner Zeit größer gewesen als heute. Offensichtlich führt der beschworene Analphabetismus der Fernsehkonsumenten nicht zur Äußerung größerer Dummheiten, als sie vom hochgerühmten Alphabetismus klassisch gebildeter und erzogener Mitteleuropäer etwa in den Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs vertreten wurden. Was die Bildungseliten damals, in Zeiten reiner Buchkultur, über die Unabdingbarkeit des Kulturkampfes, die gottgewollte, soziale Ordnung oder die Degenerierung der menschlichen Seelen durch Bildung und Wissen vortrugen, durchschaut selbst der durchschnittliche Fernsehkonsument als haltlos.
Die Zunahme des Fernsehanalphabetismus läßt sich nur behaupten, weil man übersieht, daß die Kulturtechniken im elektronischen Zeitalter andere sind als im Zeitalter der Buchkultur. Die Medien haben unsere Wahrnehmungs- und Aneignungsformen verändert. Die zu ihrem sinnvollen Gebrauch gehörenden Techniken mögen manchen immer noch fremd sein, nichtsdestoweniger sind sie erlernbar.
Die Fernsehästhetik ist in erster Linie eine Rezeptions- und nicht mehr eine Produktionsästhetik. Sie verlangt die Fähigkeit, auch in Bildern reflexiv denken zu können. Obwohl traditionell, auch in den Kulturwissenschaften und der Philosophie, noch die Wortsprache in kommunikativen Beziehungen dominiert, beherrscht längst ein großer Teil der geschmähten Medienkonsumenten die Fähigkeit, über Bilder zu kommunizieren. Auf keinen Fall werden dabei die Fähigkeiten zu gedanklichen Leistungen oder zu realitätsadäquatem Verhalten eingeschränkt.
Die Fernsehkonsumenten wissen den Wirklichkeitsanspruch der elektronischen Bilderflut durchaus kritisch abzuschätzen. Ihre Reaktionen auf die Fernsehwerbung und auf noch so aberwitzige Horror-Fictions zeigen, daß für sie keineswegs die Zeichenwelt sich verselbständigt hat.
Wo ihnen elektronisch synthetisierte Bildwelten als Zeichen ohne Bedeutung vorgesetzt werden, erarbeiten sie sich phantasievoll Bedeutungen, auf die diese Zeichen verweisen könnten. Daß wir in einer Welt totaler Simulation leben, wollen uns diejenigen weismachen, die Programmgewalt haben. Aber sie manövrieren sich ebenfalls nur in „bezeichnende“ Widersprüche; einerseits wollen sie ihre Einflußnahme auf die Konsumenten vergrößern, andererseits wäre gerade das nicht möglich, wenn den Konsumenten beliebige, also bedeutungslose Zeichenfigurationen vorgesetzt werden. Sollten solche Programme tatsächlich die Wirkung haben, die Konsumenten in den sozialen Autismus unvermittelbarer Privatwelten einzuschließen, so verhinderte gerade dieser Effekt die Absicht, die sozialen Prozesse den Machtinteressen zu unterwerfen. Wen wollte man denn eigentlich noch manipulieren, wenn man ihm zuvor unmißverständlich aufgenötigt zu haben glaubt, daß alle Aussagen, Aufforderungen, Appelle, Meinungen und Urteile nichts anderes seien als Gestalten bedeutungsloser Zeichen?
Wir erleben die elektronische Totalsimulation als Mache, die dennoch nicht unserem Belieben anheim gestellt ist. Gerade das zwingt uns, auf der einen Wirklichkeit zu bestehen, zu der eben auch Phantasien, Träume und gedankliche Spekulationen gehören. Was wir für wirklich halten, wird durch die Konsequenzen, die diese Annahme auf unser Handeln und Verhalten hat, tatsächlich Bestandteil unserer Wirklichkeit, so lautet ein sozialpsychologisches Grundgesetz. Weil es unser Fürwahrhalten ist, muß es nicht notwendigerweise auch von anderen Menschen, mit denen wir zu leben gezwungen sind, für wirklich gehalten werden. Wir kommunizieren mit anderen, um das, was wir für wirklich halten, mit dem, was sie für wirklich halten, abzugleichen. Aus der Wirklichkeitsauffassung der Einzelnen wird so erst Wirklichkeit, die wir mit anderen teilen, und nur in der können wir uns bewegen ohne allzu großes Risiko, an der Realität dessen, was wir nicht selbst sind, zu scheitern. Unser Geist ist nämlich keineswegs von so grenzenloser Macht, daß er sich seine eigenen Bedingungen beliebig vorgeben könnte. Das aber würde mit der Annahme, eine totale Simulation virtueller Realität sei möglich, vorgespiegelt. Solcher unvergegenständlichter Geist jenseits unserer leiblichen Existenz wäre nicht mehr menschlicher Geist. Ob es den überhaupt geben kann, ist eine offene Frage; sie mit ja oder nein zu beantworten, wäre aber wiederum nur dem menschlichen Geist abzuverlangen, und den kann man ebensowenig in Batterien von Weckglasgehirnen sich entfalten lassen wie in Simulationen künstlicher Intelligenz.
Denn an die Stelle der äußeren Realität treten für die Weckglasgehirne jene Regeln, nach denen die elektronischen Simulationsmaschinen bedient werden müssen. Wer die Bedienungspläne nicht minuziös einhält, kann die Maschine nicht einmal in Gang setzen. Die Regeln einzuhalten, ist zumindest so notwendig, wie es früher galt, die Naturgesetze zu beachten, wenn man den eigenen Körper einsetzte, um irgendeine zielgerichtete Handlung auszuführen. Die Verfechter der „künstlichen Intelligenz“ behaupten die Möglichkeit, virtuelle, also beliebig veränderbare Realität herstellen zu können. Selbst wenn sie das könnten, würden die Menschen, die sich in diesen Welten bewegen sollen, nicht selber Bestandteil der virtuellen Welt sein können, da sonst die Unterscheidung zwischen virtuellen und manifesten Realitäten aufgehoben würde. Es wäre niemand mehr da, der diese Realitäten als virtuelle wahrnehmen oder regenerieren könnte.
Das ganze läuft auf nichts anderes hinaus, als was die mittelalterlichen Theologen für die virtuellen Menschen, die Engel, zu behaupten versuchten, und was die Teilchenphysiker mit der Erfindung immer neuer Tautologien nachvollziehen. Aber mit der Klärung der Frage, wieviele Teilchen oder Engel oder andere Virtualitäten auf eine Nadelspitze passen, werden die Theologen, Physiker und Neuroelektroniker sich nicht davor bewahren können, schmerzhaft aufzuheulen, wenn sie sich eine Nadel in den Hintern rammen.
Wir dürfen uns nicht täuschen lassen: die bloße elektronische Beschleunigung der Vermittlung von gedanklicher Operation und Bewegung der Körper kann die Menschen nicht in frei flottierenden Geist verwandeln. Dagegen spricht die in den 80er Jahren entdeckte Grenze der Neuronenimpulsgeschwindigkeit, die ebenso unüberbietbar ist wie die Lichtgeschwindigkeit. Möglicherweise kommt beiden der gleiche Grenzwert zu. Durch noch so viele Simultanschaltungen von operativen Clustern (zum Beispiel als Nervenzellen) ist dieser Wert nicht zu überschreiten. Aber auch die bloß relative Zunahme der Vermittlungsgeschwindigkeit erzeugt Angst und Unsicherheit, weil sie mit unseren konventionellen Betrachtungsweisen kultureller Entwicklungen kollidiert. Von diesem Erschrecken sind unter vielen anderen die Untersuchungen von Virilio, Sloterdijk und Bierter (14) geprägt. Sie haben eins gemeinsam: sie wollen uns mobilisieren gegen den Zusammenbruch unseres konventionellen Zeitgefühls. Aber kann man sich noch mit der Absicht, durch Konfrontation mit dem Schrecken das Erschrecken in kalkulierbare Reaktionen zu überführen, an Zeitgenossen wenden? Die gut begründeten Schlußfolgerungen jener Autoren über den Tod der Zeit könnte man, wenn sie denn zuträfen, doch nur durch Verdrängung bewältigen. Als Aufklärer vermitteln die Autoren den Eindruck, uns zu Einsichten zwingen zu wollen, von denen sie gerade beweisen, daß wir sie gar nicht fassen können. Wer das hört, verfällt nur allzu leicht darauf, die Katastrophen möglichst schnell herbeizusehnen, die unserer konventionellen Orientierung in Zeit und Raum angeblich durch die elektronische Beschleunigung der Kulturdynamik unausweichlich drohen. Die von den Autoren diagnostizierte Katastrophensehnsucht ist eine verständliche Reaktion auf die Schlußfolgerungen ihrer Untersuchungen. Wenn wir ohnehin alle nur noch Tote auf Abruf sind, wenn die Menschheit unaufhaltbar ihrem naturgeschichtlichen Ende zustrebt, dann können die Menschen ihre Würde nur noch im Selbstopfer bewahren. Sollte erst durch die elektronische Beschleunigung der Zusammenbruch unserer konventionellen Weltorientierung bewirkt werden, dürften in historischen Zeiten, in denen es diese Phänomene der Beschleunigung nicht gegeben hat, Prophetien, wie die unserer Autoren, unmöglich gewesen sein. Solche Prophetien gab es aber lange vor dem elektronischen Zeitalter; sie können also nicht das Resultat einer historisch völlig neuen Situation sein.
Es ist ja nicht zu übersehen, wie seit den Tontafeln von Ninive über Platons Angriffe gegen die Sophisten, Juvenals römische Satiren, die mittelalterlichen Apokalyptiker, Montaignes Flucht vor der Schreibsucht und und und bis zu den Kulturkampfheroen der vergangenen hundert Jahre immer wieder darüber überzeugend argumentiert wurde, warum die unaufhaltsame Steigerung der Kulturdynamik zur Zerstörung jeder Kultur führen muß.
Die Argumente sind und waren in der Tat zwingend, sie wurden zumeist auch noch stilistisch brillant vorgetragen; was sie allein entwertet, ist die Tatsache, daß diese Argumente in allen Stadien der europäischen Kulturentwicklung glaubhaft gemacht werden konnten.
Gerade weil sie zu allen Zeiten, völlig unabhängig von den jeweiligen historischen Gegebenheiten, nicht nur Glauben fanden, sondern tatsächlich überzeugten, müssen sie falsch sein, wenn man sie nunmehr auch in einer Situation vortragen kann, die ja nicht nur angeblich für die Menschen eine historisch noch nie dagewesene ist. Daß der immer schneller „rasende Chronos“ (Bierter) längst in wahrhafte Raserei verfallen sei, hielten Menschen offenbar zu allen Zeiten für unbestreitbar. „Ja früher ... aber heute ... und gar erst in Zukunft ... wohin soll das noch führen?“ Früher hatte man Zeit, sich alles gründlich zu überlegen und angemessen zu reagieren – heute verkürzen sich die Vorwarnzeiten auf Minuten; früher war die Kultur auf Dauer abgestellt und nur das galt als kulturell wertvoll, was dauerte und überdauerte – heute triumphieren die sich überbietenden Veränderungen und nur das gilt als wertvoll, was als völlig Neues in Aussicht gestellt wird; früher entfaltete sich ein Leben kontinuierlich als Entwicklungsroman – heute fällt es auseinander in Fragmente imaginärer Chiffren anorganischer Zeitlosigkeit.
Noch einmal: Ist es bloß zynisch, derartige Topoi wie „früher … aber heute“ als Heißlaufen der Mechanik unseres natürlichen Weltbildapparates zu kennzeichnen, als Resultat der uns als Evolutionsprodukte immer noch beherrschenden Naturlogik, der Logik der natürlichen Dummheit? Ist möglicherweise sogar die hochentwickelte Dialektik nur eine Figur der Logik der Dummheit, wenn wir dialektisch die Frage nach dem Verhältnis von Dauer und Wechsel, von früher und heute, von Bleiben und Vergehen mit der Antwort bescheiden, die einzig verbindliche Form der Dauer sei der ewige Wechsel? Sind die Fragen danach, was sich in ihr verändert, tatsächlich zu unterscheiden, wenn sich die Unterscheidung von Dauer und Wechsel doch nur aus dem naturlogisch uns aufgezwungenen Mechanismus der Dualbildung ergibt?
Die Biologie der Erkenntnis hat in jüngster Zeit die Mechanismen der Naturlogik unseres Weltbildapparates in erstaunlichem Umfang freigelegt. (15) Es hat sich herausgestellt, daß die Instinktbindung als Bindung an die Naturlogik auch heute die Kulturproduktion wie eh und je beherrscht. Der größte Teil dessen, was wir in den Naturwissenschaften, der Philosophie, den Künsten und in den Organisationsformen des sozialen Körpers geradezu als widernatürlich oder zumindest als Naturbeherrschung verstehen wollten, ist nichts anderes als die immanente Logik der Evolution selbst. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, daß die wahnhafte Raserei der Kulturdynamik bloß natürlich ist, und das heißt, daß aller Widerstand gegen diese Raserei des Chronos als angeblich entarteter Kultürlichkeit, der Versöhnung mit der Natur und Rückkehr zu ihren Gesetzen fordert, das Dilemma nur noch verstärkt.
Der natürliche Affe in uns baute die Atombomben und Raketen, nicht der triumphierende Geist des Kulturschaffenden, des aus natürlichen Instinktbindungen entlassenen Menschen. Und der natürliche Affe in uns baute die Atombomben und Raketen, die Chemiewerke und Verkehrssysteme, die Computer und Laser, weil er in seiner äffischen Logik keine Schwierigkeiten darin sah, Geist und Tat, Plan und Ausführung umstandslos identisch zu setzen. Die äffische Naturlogik fordert sofort ihr Recht und das auch noch als ethisches Postulat. Wo die Taten nicht den Worten entsprechen – wo die gute Absicht rückhaltloser Verständigungsbereitschaft nicht tatsächlich zur Einigkeit seligen Einverständnisses führt, mahnt sie Wahrhaftigkeit an, Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit. Und so marschiert der Menschenaffe, gleichgesinnt, ethischen Prinzipien verpflichtet, aufrecht und wahrhaftig auf jenes Ende zu, das ihm als „reinem“ Wesen der Natur von eben dieser vorgezeichnet ist. In dieser Perspektive lassen sich die historisch auffälligen Verbindungen zwischen künstlerischer Produktivität und Rebellion, zwischen ästhetischer Manifestation (z. B. der als Dandy) und Asozialität als „widernatürlichem“ Verhalten tatsächlich sinnvoll so begründen, wie das von Villon über Caravaggio, die Romantiker, die Poètes Maudits, die Dadaisten, Futuristen, Surrealisten bis zu unseren Freunden Karl-Heinz Bohrer (16) und seinen Kraft-durch-Frevel-Enthusiasten immer wieder geschehen ist.
Der ästhetische Affront schockierte die Bürger tatsächlich als radikaler Einspruch gegen die als problemlos behauptete Übertragung und Anwendung der Ausgedachtheiten von Künstlern, Philosophen und Wissenschaftlern. Da es aber sehr schwer fällt, derartige historische Sprengmeister im Aktionsfeld der natürlichen Dummheit von jenen zu unterscheiden, die ihre Katastrophenphantasien nur allzu gern im Sozialen, Politischen und Wirtschaftlichen angewandt und ernst genommen wissen wollten (von jenen also, die die Katastrophe der Menschheit herbeisehnten, um endlich der Eschatologie der Evolution zu entsprechen), ziehe ich es vor, die Sprengkraft des Ästhetischen in systematischer Hinsicht anzusprechen. Ich nutze dabei die Gelegenheit, auf einen Einwand zu reagieren, den 1988 Helmut Seiffert gegen meine Argumentation vorgebracht hat.
Ich habe behauptet, daß die ästhetische Dimension jeglicher zwischenmenschlicher Beziehungen insofern das Produkt der Naturevolution ist, als sich die Leistungsfähigkeit des menschlichen Weltbildapparates erst durch Differenzierung der operativen Leistungszentren der Großhirnrinde herausgebildet hat. Diese Differenzierung stellt aber zugleich ein neues Problem dar, nämlich das der Kooperation zwischen den Leistungszentren, die durch Spezialisierung herausgebildet wurden. Die entsprechenden empirischen Versuche zeigen, daß bei allen operativen Aufgaben (z.B. der Wahrnehmungsverarbeitung von Geräuschen bis hin zu komponierter Musik; vom Blick aus dem Fenster bis hin zur Betrachtung eines Gemäldes; von der Ertastung der eigenen Körperoberfläche bis hin zu der einer Skulptur) alle Leistungszentren der Großhirnrinde (von den anderen Leistungszentren des Zwischenhirns und des übrigen zentralen Nervensystems ganz abgesehen) kooperieren. (17)
Die Leistungszentren bilden bei operativen Aufgaben schnell wechselnde Dominanzhierarchien.
Es steht fest, daß nur durch den Wechsel der Dominanzhierarchien annähernd anforderungsgerechte Bewältigungen der Selbst- und Fremdwahrnehmung ermöglicht werden (d. h. unter anderem: es gibt keine gattungsspezifischen Dominanzhierarchien; die Verarbeitungszentren der über die Augen vermittelten Wahrnehmung werden, etwa bei der Betrachtung eines Gemäldes, nicht kontinuierlich durchgehalten; die historisch entstandene Zuordnung von optischer Wahrnehmung, auditiver und sensitiver Wahrnehmung zu den Aufgaben „Bilder sehen“, „Musik hören“, „Skulpturen ertasten“, entbehren jeder neurophysiologischen Grundlage; jedes „Werk“ ist damit für unseren Weltbildapparat ein Gesamtkunstwerk).
Nun steht aber die Funktion des gesamten zentralen Nervensystems immer unter der Bedingung gleichzeitiger Selbst- und Fremdwahrnehmung, die zur Vermeidung tödlicher Irrtümer nicht zirkulär und unmittelbar selbstbezüglich sein dürfen. Eine lebende Einheit als vollständig selbstbezüglich zu erhalten, würde durch die Funktionsweisen des Systems der unmittelbaren Rückkoppelungen mehr oder weniger schnell zum Informationstod (kulturgeschichtlich: Wirklichkeitsverlust) führen. Rückkoppelungen müssen immer reflexiv sein, d. h. die Selbstbezüglichkeit muß über Leerstellen (black boxes) oder selbstinduzierte oder aufgezwungene Störungen vermittelt werden. Das ist für Lebewesen dadurch schon gegeben, daß ihre Ressourcen nicht von ihnen selbst generiert werden können. Ein Leben ohne Fremdbezug (zumindest auf anderes Leben und seine Ressourcen) ist nicht möglich. Wie die Arbeit an „technisch“ absolut selbstbezüglichen Systemen zeigt, ist der Fremdbezug eine Eigenleistung des in sich geschlossenen Systems. Verkürzt auf den hier bedeutsamen Gesichtspunkt heißt das, daß es den Menschen im Singular nicht gibt, so sehr sich auch in jedem einzelnen die autonome Logik des Systems „Leben“ gleichermaßen zur Geltung bringt. Der zur Aufrechterhaltung des Systems notwendige Fremdbezug wird in dieser Hinsicht als Auto- und Allokommunikation vom System selber aufgebaut. Den naturgesetzlichen Voraussetzungen gemäß muß es dafür Medien nutzen. Der Außenbezug ist in der medialen Vermittlung als externe Vergegenständlichung des Systems, herkömmlich Abbildung genannt, zu leisten. Wie unter anderem auch die selbstbezügliche Abbildung des genetischen Codes zeigt, ist die Vergegenständlichung nur um den Preis des Stillstands der Entwicklung identisch möglich. Nichtidentität wird entweder als zufällige Mutation oder durch die Eigengesetzlichkeiten der Vergegenständlichungsmedien erzwungen. Für den menschlichen Organismus sind das einerseits neurophysiologische mediale Prozesse, für die die Geschwindigkeit der neuralen Impulsübertragung eine absolute Grenze darstellt, die aber durch reflexive Rückbezüglichkeit, also eine über Fremdheit vermittelte, niemals erreicht werden kann (hier ist für die Neurophysiologen Erhebliches zu lernen aus der Beschäftigung der Physiker mit der absoluten Größe „Lichtgeschwindigkeit“).
Für unser Argument heißt das hier: Die Kooperation der neuralen Leistungszentren im Wechsel ihrer Dominanzhierarchien ist über die selbstproduzierte Vergegenständlichung als äußere Abbildung nur dann funktionsadäquat, wenn die äußere Abbildung nicht vollständig identisch ist. Oder anders ausgedrückt: Wenn die vergegenständlichende Abbildung im kommunikativen Außenbezug leistungsfähig sein soll (schließlich kann ja nur ein Muster der Dominanzhierarchien gewählt werden), gehen in die Abbildung alle möglichen, aber nicht gleichzeitig wählbaren alternativen Kooperationsformen der Leistungszentren als Dominanzhierarchien ein. Für die menschliche Kommunikation heißt das: erst in der Reaktion anderer Menschen auf vergegenständlichten Außenbezug im Reden, Gestikulieren, Mimik, Zeichengebung läßt sich für das einzelne System erfahren, wie sinnvoll oder unsinnig es seine eigenen Kooperationsmuster der Leistungszentren ausgewählt hat. Kurz: Ich erfahre nur an den Reaktionen anderer, was ich gemeint haben kann, wenn ich durch Entäußerung eine bestimmte vergegenständlichte Abbildung meines eigenen Systems schaffe. Diese unumgängliche Differenzbildung des Systems in Selbst- und Fremdbezug zu anderen Systemen begründet für den kommunikativen Akt die ästhetische Dimension, nämlich als zahllos vielfältig mögliche, aber jeweils nur im einzelnen bestimmt wählbare Zuordnung und Abkoppelung der Kooperationsformen operativer Leistungszentren.
Noch kürzer: Welche bildliche oder andere Vergegenständlichung ich für einen herkömmlich „Denkvorgang“ genannten neuralen Prozeß in kommunikativer Absicht auch wähle – sie kann niemals genau und eindeutig das „ausdrücken“, was gedacht sein könnte. Was tatsächlich gedacht wurde, wird erst bestimmbar, wenn über die Kommunikation Rückkoppelung erfolgt. Diese allmähliche Verfertigung der Gedanken im vergegenständlichten Abbilden als Sprechen, Gestikulieren, Zeichengeben ist darauf angewiesen, in der Rückkoppelung über die „Antworten“ anderer, genau so Kommunizierender zu „erfahren“, welche Kooperationsmuster der Leistungszentren deren vergegenständlichten Abbildungen entsprechen.
Seiffert (18) hat nun gefragt, wie die beiden gleichermaßen begründeten Aussagen miteinander vereinbar seien, nämlich erstens, daß die Naturlogik uns fatalerweise nahelegt zu glauben, geistige Konstrukte und die sie abbildenden Vergegenständlichungsformen (wie Konstruktionsplan und Ausführung) problemlos identisch setzen zu können, und zweitens, daß die Naturevolution die prinzipielle Uneinholbarkeit des Denkens oder der inneren Vorstellungen durch medial vergegenständlichte Abbildung erzwungen hat.
Meine Antwort: Beide Ausformungen desselben evolutionären Prinzips sind miteinander - alteuropäisch ausgedrückt – wie analytische und synthetische apriorische Urteile vermittelbar. Neurologisch gesprochen, sind die tautologischen Kurzschlüsse von der Impulsgier der Lust- und Unlustzentren des limbischen Systems erzwungene Direktschaltungen zwischen den Leistungszentren der Großhirnrinde und dem limbischen System. In diesen Direktschaltungen setzen sich evolutionär frühere Phasen der Ausdifferenzierung der Leistungszentren des zentralen Nervensystems durch. Auch hier ist es tragisch zu sehen, daß man glaubt, durch meditative Versenkung der prinzipiellen Uneinholbarkeit des Denkens und Vorstellens in den medial vergegenständlichten Abbildungen entgehen zu können; wo diese Meditation Wirkung zeigt, beruht sie auf jenen frühevolutionären Direktschaltungen zwischen der Großhirnrinde und dem limbischen System.
Die hier nicht abgeleitete, sondern nur mitgeteilte Schlußfolgerung im Hinblick auf die Frage, ob die vergegenständlichte Abbildung neuraler Prozesse in den historisch neuen elektronischen Medien zu einer die Kommunikation zerstörenden rasanten Steigerung der Kulturdynamik führt, lautet: Sollte es selbst dazu kommen, daß die elektronischen Abbildungssysteme direkt an das neurale Impulsgeschehen angeschlossen werden können, so würde die ästhetische Differenz von System und Umwelt nicht ausgelöscht, sodaß jenseits einer bestimmten Schwelle die Kommunikation zusammenbräche. Die verschiedenen Rechner als unmittelbare Erweiterung des zentralen Nervensystems identifizieren sich wechselseitig als System und Umwelt. Das allerdings ließe sich nur durch selbstgenerierte Dysfunktionen (elektronische Immunreaktion hieße dann die ästhetische Differenz) ermöglichen. Wahrscheinlich – wie die Chaosforschung zeigt – sind dazu elektronische Systeme gerade dann fähig, wenn sie direkt von neuralen Impulsen bedient würden; denn das selbstgenerierte Chaos gehorcht bisher nicht der Logik des Chaos, sondern der Lüge, d.h. der Fähigkeit, willkürlich, also bewußt, falsche Kopplungen zwischen neuralen Prozessen und ihren medial vergegenständlichten Abbildungen zu erzeugen. Die herkömmlichen Skandale des Ästhetischen demonstrierten die Unumgänglichkeit des Lügens bei dem Versuch, mehr als die Wahrheit der Tautologien hervorzubringen. Das herkömmliche Schöne als das sinnliche Scheinen (als medial vergegenständlichte Abbildung) der Ideen (des neuralen Impulsgeschehens) in der Identität von Inhalt und Form, von Begriff und Anschauung, von Vorstellung und Bild, von Zeichen und Bezeichnetem galt bisher als die höchstrangige Tautologie; sie war aber immer der Tod des Ästhetischen in maskenhafter Starre, erzwungener Dauer des Anorganischen. Solche Schönheit machte wirklich sprachlos.
Die beklagte imaginäre Scheinhaftigkeit bloß noch simulierter Kommunikation reagiert auf Überforderungen durch die sich ständig steigernde Kulturdynamik. Überfordert sind wir, solange wir diese Dynamik nicht an ihrer absoluten Grenze (der Übertragungsgeschwindigkeit neuraler Impulse reflexiver, also über Außenbezug rückgekoppelter Systeme) orientieren, sondern an ihrem Ausgangspunkt, an früheren Stadien unserer Evolution, in denen die Lust- und Unlustzentren des limbischen Systems nur „langsamere“ Bedienung durch die neuralen Impulszentren der Großhirnrinde einzufordern vermochten.
Wer die totale elektronische Simulation nicht nur für möglich, sondern auch für wünschenswert hält, möchte nichts anderes als das, was die Menschheit immer schon wünschte, nämlich in das Paradies einziehen. Das Simulacrum, das Allerheiligste der Welt, die nur noch aus Zeichen ohne Bedeutung bestehen soll, ist das Paradies als Schlaraffenland ewig lustvoller Stimulierung (Konsumieren), ohne noch vor die Schranke des Ekels zu gelangen, mit dem das limbische System uns bisher daran hindert, der Lust Ewigkeit zu gewähren. Wem durch neurologische Manipulationen die Ausschaltung des Ekels vor immer der gleichen Lustquelle ermöglicht wird, geht lustvoll zugrunde. Der entsprechende experimentelle Beweis ist an Ratten schon in den 60er Jahren erbracht worden. Aber auch das ist keine Einsicht, die erst die Neuroelektronik ermöglichte. „Lustvoll geht die Welt zugrunde“, mahnten uns schon die antiken Philosophen.
• (14) Paul Virilio: Ästhetik des Verschwindens, Berlin 1986; Peter Sloterdijk: Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung, Frankfurt/Main 1987; Willy Bierter: Der rasende Chronos, in: Einspruch, 8/88.
• (15) Rupert Riedl: Biologie der Erkenntnis, Berlin 1980.
• (16) Karl Heinz Bohrer: Die Ästhetik des Schreckens, München 1978, S. 430-439 u. 404-410.
• (17) Forschungsarbeiten von Prof. Werner Sickel, Neurophysiologisches Institut, Uni Köln 1988.
• (18) Helmut Seiffert: Votum vom 1. 6.1988, Institut für Soziologie, Universität Hannover.