In: Petrarca-Preis 1975–1979, Autorenbuchhandlung München 1980
Der Petrarca-Preis wurde seit 1975 von Hubert Burda jährlich gestiftet. Jurymitglieder waren von 1975–79 Nicolas Born, Bazon Brock, Peter Handke, Michael Krüger und Urs Widmer. Die Preisträger 1975–79: Rolf Dieter Brinkmann, Sarah Kirsch, Herbert Achternbusch, Alfred Kollerisch und Zbigniew Herbert. Zum Petrarca-Preis 1980–84 vgl. ›Heiligung der Filzpantoffeln‹, Band VI, S. 24-33
Als wir uns 1974, in seinem sechshundertsten Todesjahr, Petrarca als Patron eines neuen Lyrikpreises anvertrauten, hatten wir uns vorgenommen, unsere Arbeit für den Preis auf fünf Jahre zu beschränken. Deshalb beschlossen wir, bei den Preiszusammenkünften die fünf wichtigsten Stationen von Petrarcas Lebenslauf aufzusuchen, um den genius loci und die Geopsyche der bestimmten Ereignisorte in jeweils einem der Themen zu versammeln, die Petrarca sein Leben lang beschäftigten.
- Als Stationen jenes Lebens auf Erden wählten wir für 1975 den Mont Ventoux, dem wir Petrarcas Topoi Berg und Theorie, Natur und Landschaft – der Wanderer als Subjekt der Landschaft – zuordneten;
- 1976 wollten wir nach Arquà/Padua gehen, um uns an Petrarcas Alterssitz seinem Verständnis vom Humanismus als dialogischer Kommunikation und vom Leben als Exemplum auszusetzen;
- Für 1977 galt es, im Tusculum die Zukunft als Verwirklichung der Vergangenheit zu verstehen, also Petrarcas und seiner Freunde Versuch kennenzulernen, Zukunft zu erzwingen;
- 1978 sollte in Arezzo/Siena am Beispiel von Lorenzettis Divisio die das 14. Jahrhundert beherrschende Frage nach dem Lebenszusammenhang, nach der Einheit von Kunst, Wissenschaft, Politik gestellt werden;
- 1979 schließlich wollten wir in Verona, dem Ort, an dem Petrarca wesentliche antike Texte entdeckte, dem Kulturinstrument »Buch« nachspüren, das durch Petrarcas Arbeit seine bis in den heutigen Alltag andauernde Vorrangstellung unter allen anderen Kulturinstrumenten erhielt.
Wir wollten es – und wir taten es. Und daß wir es niemals wieder so werden tun können, gibt dem ausgeführten Plan seine Bedeutung: Es war einmal, wie es nie wieder sein wird – deshalb war es nicht vergeblich.
Ich gebe im nachfolgenden die Stichworte, anhand derer ich im Sinne unseres Planes bei den jährlichen Preisverleihungen versuchte, uns und unseren Freunden Petrarcas Problemstellungen zu vergegenwärtigen. (1)
1 Wanderer und Gärtner als Subjekte der Landschaft
Am 26. April 1335 besteigt Petrarca in Begleitung seines Bruders Gherardo den Mont Ventoux – eine für seine Zeitgenossen ganz aberwitzige Tat.
Warum sollte man sich einer menschenfeindlichen Natur, dem sturmgepeitschten Dornenurwald jenes Gipfels aussetzen, wo sie durch menschlichen Eingriff weder zu Ackerland noch zur Weide fürs Vieh umgestaltet werden konnte?
Ein Hirte, den Petrarca beim Aufstieg trifft, versichert ihm, daß es auf dem Berge nichts zu holen gebe – außer zerrissener Kleidung und geschundenen Gliedern. Petrarca bleibt unbeeindruckt, erreicht schließlich den Gipfel. Was treibt ihn an, die Mühen nicht nur nicht zu scheuen, sondern geradezu zu suchen?
In dem Bericht, den er unmittelbar nach dem Abstieg in einer Herberge verfaßt, enthüllt er seine Motive. Er hatte aus Livius herausgelesen, daß in der Antike derartige Bergbesteigungen zum Reiseprogramm der Kaiser und Könige gehörten; Philipp von Mazedonien bestieg zum Beispiel den Haimon, um vom Gipfel einen Blick auf die sein Reich begrenzenden Meere zu haben.
Zunächst ist auch für Petrarca die Nachahmung des antiken Vorbildes treibendes Motiv, das er auch durchhält: Auf dem Gipfel ist er überwältigt von der Erweiterung des Gesichtsfeldes in der Vogelperspektive, die es ihm ermöglicht, das bisher durch großräumliche Distanz Getrennte zusammenzuschauen. Während des Aufstiegs aber entwickelt sich bei ihm viel stärker ein zweites Motiv: Je größer die Anstrengungen werden, desto intensiver wird seine Selbstwahrnehmung; Körpergefühl und Selbstbewußtsein bilden sich über jedes bisher ihm bekannte Maß hinaus.
Da er aber an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt, wird er sich zunehmend auch des Risikos bewußt, in das er sich begeben hat. Lustvolle Selbsterfahrung droht in Angst umzuschlagen. Er wird mit der Angst fertig, indem er nach einer Begründung für sein Unternehmen sucht, die über die Nachahmung des antiken Beispiels hinausgeht.
In einer Verschnaufpause fällt ihm diese Begründung mit großer Plötzlichkeit zu. Es wird ihm schlagartig die Analogie zwischen seinem augenblicklichen Tun und dem menschlichen Lebenslauf klar. So versteht er nun den Mont Ventoux als jenen Heilsberg, den zu erklimmen zum Beispiel Dante als Weg der Läuterung beschrieben hatte. Das Leben sei anstrengende und gefährliche Wanderschaft bis zu jenem Höhepunkt, an dem sich Seele und Selbstbewußtsein von ihrem leiblichen Träger trennen.
Der Gipfel des Läuterungsberges ist das Ziel aller Lebensbewegung und Ende des Lebensweges. Dort wird sich das Auge des Wanderers auf ihn selbst richten, um schließlich sein eigenes Inneres als die Welt zu entdecken, der er sich zu stellen hat.
So verwandelt sich für Petrarca sein praktisches Tun in ein theoretisches, in anschauende Betrachtung des Weltzusammenhangs, den der Schöpfer dieser Welt gestiftet hat.
Theoria – anschauende Betrachtung – ist das Mittel, sich selbst als Bestandteil jenes Weltzusammenhangs zu erfahren. Wo das gelingt, wird – wie sich Petrarca von Augustin sagen ließ – aus der anschauenden Betrachtung eine genießende: Die Selbstverwirklichung des Menschen wird bestätigt durch seine Fähigkeit, die Welt als das zu nehmen, was sie ist.
Aus dieser über weite Strecken noch ganz mittelalterlichen Vorstellung entwickelt Petrarca mit zunehmender Deutlichkeit bis dahin unbekannte Auffassungen und vor allem Haltungen, die ihn nicht nur sein Leben lang beschäftigen und die seine eigentlichen Beiträge zur Entwicklung dessen sind, was seit hundert Jahren mit dem Begriff »Renaissance« vergegenwärtigt wird; vielmehr markieren Petrarcas neue Auffassungen und Haltungen Probleme, mit denen wir gegenwärtig wieder verstärkt konfrontiert werden: Es ist die Frage nach der Vereinbarkeit von Subjekt-Anspruch und den Wirkungszusammenhängen des Weltganzen, das gegenwärtig unter dem Namen »Die Gesellschaft« firmiert. Ein Preis für Lyrik trägt den Namen Petrarcas mit gutem Grund, wenn der Lyriker nicht durch die spezifische Art seines literarischen Schaffens (Gedichte schreiben) gekennzeichnet wird, sondern durch spezifische Auffassungen und Haltungen, die zu der Art von Literatur führen, wie sie Lyriker produzieren. Petrarca selbst war in diesem Sinne Lyriker, auch, wo er als Historiker, Philologe, Moraltheologe oder praktischer Philosoph schrieb. Nur ein geringer Teil seines Werkes besteht aus Lyrik im engeren Sinne. Den Kern jener Haltung des Lyrikers bilden nach Auffassung Petrarcas die Fähigkeit und der Anspruch eines Menschen, »Ich« zu sagen. Dieser Anspruch wird aber nicht nur in der Hinwendung auf sich selbst eingelöst, sondern in der Fähigkeit, die Lebenswelt durch eigenständige Wahrnehmungsformen und nach Maßgabe selbst gemachter Erfahrungen zu gestalten. Das Ich wird zum Subjekt.
Petrarca demonstriert einen solchen Vorgang mit seinem Aufstieg auf den Mont Ventoux. Er geht von der Welt der Natur aus, wie sie anderen erscheint. Er versteht die Einwände des Hirten, er versteht, was Natur dem Hirten, dem Ackerbauern, dem Handeltreibenden, dem Krieger ist. Für sie werden ihre Auffassungen von der Natur durch die Art der Arbeit nahegelegt, ja erzwungen, die sie in ihren Berufen zu verrichten haben.
Petrarca als Lyriker versucht, Natur zu dem zu machen, was sie sein könnte, wenn sie nicht nur Gegenstand menschlicher Arbeit wäre: zur Landschaft als »freier Natur«. Wenn nicht objektive Bedingungen des Überlebens in der Natur, sondern die des subjektiven Erlebens der Natur unsere Haltungen ihr gegenüber beherrschen, formen wir sie zur Landschaft um. Der von Petrarca zum ersten Mal in der Neuzeit erhobene Subjekt-Anspruch erfüllt sich in dieser Hinsicht, wenn der Lyriker Natur zur Projektionsfläche seiner Wahrnehmungen und Vorstellungen macht, »zum Spiegel der Seele«.
Bis auf den heutigen Tag sind wir genötigt, in diesem Sinne Landschaft zu erfahren; und es ist kein Zufall, daß Petrarca am Mont Ventoux, einem Stück zivilisatorisch unbrauchbarer Natur, seinen Landschaftsbegriff ausbildet; Natur als Projektionsfläche psychischer Prozesse des Einzelnen kann nur als Landschaft verstanden werden, wenn sie devastiert ist oder von zivilisatorischer Nutzung freigestellt zu sein scheint.
Bemerkenswert ist ja, daß unser Begriff »Kultur« sich aus der römischen »Agricultura« als der zivilisatorischen Nutzung der Natur durch Umgestaltung herleitet. Es muß so folgerichtig erscheinen, daß die Haltung der Künstler immer wieder als kulturfeindlich verdächtigt wird. Wer seit Petrarca darauf besteht, seine subjektiven Formen der Wahrnehmung und Vorstellungen von Natur zur Landschaft umgestalten zu lassen, ist zumindest einem erweiterten Kulturverständnis verpflichtet, als es in Agricultura zum Ausdruck kommt.
Es ist ein theoretisches Verständnis: Die anschauende Betrachtung schließt nicht andere, weitere Horizonte, als sie in der kulturell genutzten Ebene möglich sind, zu einem Ganzen zusammen; das Ganze bildet sich nicht innerhalb neugesteckter Horizonte, sondern entsteht durch Entgrenzung, durch Öffnung der Horizonte.
Diese Haltung ist für den Lyriker aber nicht radikal durchhaltbar. Auch er kann immer nur Analogien für das bieten, was er meint. Worte und Wörter haben nur Modellcharakter, wie Petrarca versichert.
Mit Bezug auf die Landschaft ist ein solches Modell der Garten. Er ist einerseits ein Stück Kultur im Sinne der Agricultura, verweist aber andererseits über derartige kulturelle Gestaltungen der Natur hinaus. Das verstehen wir heute wieder sehr gut, wenn wir ohne weiteres akzeptieren, daß der Garten als Modell der Landschaft erst sichtbar wird, wenn in ihm das Unkraut sprießen darf. Wo ringsum alle Natur agrikulturell bestimmt ist, verdankt sich der Unkrautgarten einem anderen Kulturverständnis, das Petrarca begründet hat. Er sah sich sein Leben lang nicht nur als Viator, als Wanderer, sondern auch als Hortulanus, als Gärtner. Wanderer und Gärtner sind das Subjekt der Landschaft. Der Wanderer bewegt sich auf ein Ziel zu, das zu erreichen er – wie Petrarca sagt – möglichst weit hinausschiebt. Der Gärtner ist schon im unmittelbaren Bereich seines Hauses einem Modell dessen konfrontiert, worauf sich der Wanderer zubewegt; aber eben nur einem Modell.
Der Hortulanus muß zum Viator werden, wenn er seiner Vermutung nachgibt, jemals mehr erfahren zu können, als ein Modell ermöglicht; der Viator muß immer zum Hortulanus werden, damit er wenigstens an einem Modell sich dessen bewußt werden kann, wonach er sucht.
Auch das sind zum größten Teil noch mittelalterliche Auffassungen, aber Petrarca versteht eben den Garten nicht mehr nur als Paradiesgärtlein und die sacra peregrinatio nicht mehr nur als heilige Wallfahrt.
Zwar zählt Petrarca auch die Apostel zu den ihm vorbildlichen Viatoren, aber viel mehr bedeuten ihm Scipio Africanus, Odysseus, Aeneas und Herakles als Beispielgeber. Er versteht also den Viator schon in ähnlichem Sinne wie Goethe seinen ›Wilhelm Meister‹. Auch für ihn ist der Heroismus des Viators nicht von der Idylle des Hortulanus zu trennen. Das Pathos des heroischen Wanderers ist das eines Menschen, der nur auf sich selbst gestellt, auf seine Subjektivität vertrauend, sich in die entgrenzten Räume hineinwagt. Der Wanderer wird zum Entdecker dessen, was der Gärtner nur zeichenhaft markiert. Das Pathos des Idyllikers entsteht aus der Kraft der Beschränkung und des Beharrens. Petrarca sagt, daß der idyllische Gärtner von der Weisheit geleitet werde, die darin besteht, vieles nicht wissen zu wollen.
Ein letztes: »Es ist etwas in der Örtlichkeit, es ist sogar sehr viel in ihr«, schreibt Petrarca. Die Alten nannten das den genius loci, wir nennen das ›Geopsyche‹, also ist Landschaft dann doch wohl nicht nur subjektive Umgestaltung der Natur durch die eigenen Wahrnehmungen und Vorstellungen? Petrarca meint ja nicht nur, daß wir von Klima und Höhenlage abhängig sind, vom Sauerstoffreichtum der Luft und der Intensität des Sonnenlichts. Die variieren selbstverständlich von Örtlichkeit zu Örtlichkeit; »was aber an denen ist«, ergibt sich für Petrarca darüber hinaus als das kulturelle Echo, das eine Landschaft in den Subjekten hervorruft.
Petrarca erlebt die Landschaften nicht nur als die jeweils seinen, sondern auch als die Landschaft jener, die vor ihm gelebt haben oder mit ihm leben und deren Werke Bestandteil der Landschaft geworden sind. Die Landschaften werden für Petrarca geschichtlich, indem man den eigenen Subjektanspruch teilweise aufgibt, um in dem eines anderen Subjekts aufzugehen, und sich so durch die Landschaft auch zu einem jeweils Anderen machen läßt. Landschaften – und die sie bestimmenden Werke – erzählen die Geschichte der menschlichen Fähigkeit, Vorstellungen und Wahrnehmung zu entwickeln – ihr Echo geht durch die Jahrhunderte.
Wo immer jemand in der Landschaft steht, gesellen sich ihm viele, die vor ihm dort gestanden haben, und sie bleiben ihm nicht fremd, wo es ihm gelingt, mit ihren Wahrnehmungen und Vorstellungen immer neue Landschaften aus dem gleichen Stück Natur werden zu lassen.
2 Venus, Juno, Pallas Athene-Dolcezza des Gesprächs
Das Haus in Arquà; ein Geschenk. Die Carrara von Padua sahen sich geehrt, Petrarca gegenüber als Mäzene auftreten zu dürfen. An mäzenatischen Gönnern hat es Petrarca nie gefehlt, seit er durch das Angebot der römischen Colonna mit 25 Jahren das Studium der Rechtswissenschaften abbrechen konnte, um in der Position eines Hausprälaten seiner Berufung zum Dichter nachzuspüren.
Gut sieben Jahre lehrte er in Arquà. Vom Balkon im ersten Stock blickte er ost-, süd- und westwärts, die Kurvatur der Hügel als Profil der Welt vor sich; ein ganz von seinen Auffassungen der Landschaft bestimmtes Areal. Die Hügel in den drei Himmelsrichtungen liegen nicht alle gleich weit ab, sind kulissenhaft gestaffelt, einander überlappend, ein Panorama der Vermittlung: die Ferne ganz nah, und das Naheliegende in die Ferne verwiesen.
Hier ist er am 18. Juli 1374 auch gestorben. Die Legende berichtet, daß er während intensiver nächtlicher Arbeit, über einen Codex gebeugt, seine Seele in das Buch aushauchte – eine Stimme mehr unter den Stimmen, die Bücher sprechen lassen, wenn man ihre Seiten bewegt: Voces paginarum.
Die Legende zeichnet ihn als bis ins Alter stattlichen und kräftigen Mann von großer Vigilanz. Aber jene Zeitgenossen, die die Götter nicht mit Sportler- und Kriegernaturen verwechselten, vermochten durchaus wahrzunehmen, daß genußreiches Leben seinen Leib deformiert hatte; er war auch »der fette Mönch in seiner schwarzen Kutte«. Die ihn als Kulturheros Vergöttlichenden verbaten sich diese Kennzeichnung. Sie glaubten seinen Schriften entnommen zu haben, daß er unter den drei Formen der Lebensführung die unter dem Zeichen der Venus stehende vita voluptiosa verworfen habe, ja, daß er eigentlich nur die vita contemplativa akzeptierte: leibliche Askese zugunsten der Kraft des Verstandes, die Pallas Athene verleiht. Die vita activa im Zeichen der Juno habe er nur widerwillig, wenn es gar nicht anders ging, als Diplomat und Ratgeber der Päpste, Könige und des Kaisers erfüllt.
Indes: Petrarca hat sich nicht als Paris gesehen, er entschied sich nicht für einen der drei Wege als allein verfolgenswerten. Im Gegenteil – seine Kritik an den Zeitgenossen beklagt immer wieder deren Unfähigkeit, sich gleichermaßen allen drei Lebensformen zuzuwenden; sie zeichneten das Genußleben noch weit vor dem tatkräftigen Geschäft des Alltags aus und hätten die Lebensführung, die die vita contemplativa kennzeichnet, völlig verloren. Sie seien Opfer der »Divisio«, der von den Verhältnissen erzwungenen Zersplitterung des Lebenszusammenhanges in lauter kleine Bruchstücke. Ja, Petrarca betonte die Einheit der Lebensformen derart, weil die politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse seines Jahrhunderts in unaufhebbaren Widersprüchen und in der Tyrannei erzwungener Parteinahmen zerbrachen. Man lebte in Trümmern.
Es ist Petrarca natürlich auch nicht gelungen, seinem Ideal zu entsprechen: auch er wurde hin- und hergerissen zwischen der vita solitaria in einer villa clausa, wie er sie zum ersten Mal auf längere Zeit im Vaucluse des Mont Ventoux führte, und dem Lehen in den Zentren der Geselligkeit, wie er es zunächst in Rom und Avignon kennengelernt hatte. Der kultivierten voluptas folgte er in dem einen wie in dem anderen Falle: Er genoß selbstsüchtig die Einsamkeit wie die Gemeinschaft.
Kultivierte voluptas meint für ihn »dolcezza«, ein zentraler Begriff in der Kultur seines Jahrhunderts, seit Dante den »dolce stil nuovo« gepriesen hatte. Ein schwer zu verdeutschender Begriff: lustvoll stimulierend – unsagbare Wonne – knallende Freude? Auf keinen Fall meint er Süße im Sinne von Lieblichkeit und Anmut.
Die Jugendlichen unserer Jahre haben in ihrem Idiom dafür »unheimlich geil« gesetzt. Auf jeden Fall entdeckt das 14. Jahrhundert in der dolcezza menschliche Grundhaltungen gegenüber Reizfigurationen der Umwelt, die entweder Lust oder Unlust verschaffen und damit entweder den Wunsch auf andauernde Wiederholung stimulieren oder Ekel erzeugen. Dolce sind die Wonnen der Gewöhnlichkeit, wie das nackenhaaraufstellende Pathos der heroischen Tat. »Unheimlich geil« sind sowohl ein Gedicht wie ein Gedanke, eine Farbnuancierung wie eine Metapher, das kulturelle Echo einer Landschaft wie die Entdeckung eines antiken Codex. Dolce ist alles, was die Selbstwahrnehmung, die Gefühle weckt und verstärkt, was in Begeisterung versetzt, sei die nun impulsiv nach außen in Erscheinung gesetzt oder als stille Ergriffenheit verspürt.
Petrarcas Kritik an der Genußsucht seiner Zeitgenossen gilt nicht der Verwerflichkeit von voluptas, sondern ihrer Unkultiviertheit. Der normale Alltagsmensch kennt eben nur Fressen, Saufen, Raufen und Vögeln als Quellen der Lust. Wie schnell erschöpfen sich die – wie überraschend schnell führen sie an die Grenzen, an welchen die Gier in Ekel umschlägt.
Petrarca will zur Nutzung von Lustquellen erziehen, die auch dann noch das Gefühl eigener Lebendigkeit gewähren, wenn der Magen die Speisen nicht mehr faßt, und die allgemeine Hinfälligkeit des Leibes in Krankheit und Alter es unmöglich werden lassen, die Angebote von Tisch, Bett und Kampfplatz wahrzunehmen.
Aber – die kultivierte voluptas ist nicht Ersatz bei behinderter Zugriffsmöglichkeit – sie erschließt über die Wonnen der Alltäglichkeit hinaus andere Formen des Lebendigseins, des Lebensgenusses.
Unter allen Petrarca bekannten Quellen solcher Genüsse hat er eine ganz eindeutig über alle anderen gestellt: die des Gesprächs. Gesprächskultur als Lebensform, die alle anderen umfaßt. Der Genuß der Anwesenheit anderer ist Petrarca der intensivste und anhaltendste. Das soziale Wesen des Menschen erfüllt sich für ihn im Gespräch – wir würden heute sagen: in der offenen Kommunikation. Sich auf andere Menschen einzulassen, mit ihnen tatsächlich zu kommunizieren, heißt, von ihnen etwas zu erhalten, was man sich auf gar keinen Fall selber beschaffen und gewähren kann.
Im Grunde ist alles literarische Schaffen für Petrarca von der Form des Gesprächs, der offenen Kommunikation. Auch wo er als Autor den Dialog zweier oder mehrerer Gesprächspartner selber diktiert, versucht er zumindest ansatzweise sich selbst zu überraschen, indem er sich auf unerwartbare Schlußfolgerungen aus dem Zusammenhang von Rede und Gegenrede einläßt. Freilich droht er unter dem Druck einer vorgegebenen Nutzanwendung seiner Schriften immer wieder ins mittelalterliche Traktieren abzurutschen; seinen Adressaten zuliebe vereinheitlicht er am Ende die unterschiedlichen Positionen der Dialogpartner doch wieder recht willkürlich zu einer dominierenden Meinung, aber er hütet sich immerhin, diese Meinung als alleingeltende Wahrheit hinzustellen. In seinem lebenslangen Dialog mit Augustin (dessen ›Bekenntnisse‹ er stets bei sich trägt), den er auch literarisch fixiert, macht er unbezweifelbar, daß es keinem der Dialogpartner gegeben ist, am Ende seine Wahrheit über den anderen triumphieren zu lassen. Petrarca und Augustin führen ihren Dialog in Anwesenheit aller Wahrheit, deren Urteil weder von dem einen noch dem anderen Dialogpartner erkannt oder gar vorweggenommen werden kann. Das ist ein entscheidender Schritt über das mittelalterliche Traktieren in moralphilosophischer und theologischer Absicht hinaus. Die Gesprächspartner sind der Wahrheit verpflichtet, ohne indessen selber deren Rolle übernehmen zu können.
Diese Bedingung offener Kommunikation, des würdigen Gesprächs, das den kultivierten Genuß des Gesellungstriebes aller Menschen verschafft, entdeckt Petrarca und verpflichtet sich ihr in viel radikalerer Weise als es etwa Platon in seinen Dialogen vermochte. Petrarca entdeckt somit wieder, daß das einzelne Subjekt sich nicht aus sich heraus zu bestimmen vermag; was einer ist, erfährt er aus der Bedeutung, die er für andere als Partner hat. Demzufolge kennt Petrarca keine intensiveren Formen der Tätigkeit als die, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Dabei scheint es ihm fast gleichgültig zu sein, ob die Freunde leiblich präsent sind oder in der Ferne weilen bzw. überhaupt nicht mehr leben.
Er führt ausgedehnte Dialoge sogar mit Menschen, die lange vor ihm gelebt haben, die aber durch die von ihnen tradierten Werke und Taten wie unmittelbar gegenwärtige Dialogpartner in Erscheinung treten können.
Er schreibt ihnen Briefe, als erwarte er erst noch ihre Antwort. So entwickelt Petrarca die Gesprächskultur im Freundschaftskult vor allem als Briefschreiber. Erst im 18. Jahrhundert ist in vergleichbarer Intensität in Briefen kommuniziert worden, und ist die Bindung der Partner durch Freundschaft über alle anderen Formen gesellschaftlicher Bindung gestellt worden.
Ein besonderer Aspekt der Gesprächskultur ist für die Entwicklung der Literatur hervorzuheben. Mit ihr ergeben sich nämlich andere Formen und Strukturen des Erzählens, als sie Epik und Historiographie des Mittelalters kannten. Mündlichkeit und Schriftlichkeit des Erzählens gehen eine neue Symbiose ein. Die unter dem Druck des kontinuierlichen Sprechens in der mündlichen Erzählung entstehenden Eigentümlichkeiten, zum Beispiel sprunghafter Wechsel der Zeitformen oder Zwang zur gestischen und mimischen Begleitung der Erzählung durch den Erzähler, werden bei der Umsetzung in Schriftlichkeit als künstlerische Probleme entdeckt. So entsteht die Differenzierung von Ort und Zeit der erzählten Ereignisse und denen der Erzählung als Ereignis. Ihr Mittel ist die Differenzierung des künstlerischen Stils, die Differenzierung der Zeitformen, die Differenzierung von Form und Inhalt, von Konzept und Gestaltung.
Zwar lebte Petrarca noch im Bewußtsein der Vorrangstellung der Literatur gegenüber allen anderen Künsten; aber sein Lob für Giotto (»nostri aevi princeps«) oder das für Simone Martini (»il mio Simon«) belegen, wie deutlich er erkannte, welche Differenzierungsleistungen (im eben skizzierten Sinne) die bildenden Künstler seiner Zeit, im Unterschied zu den Literaten, zu entwickeln imstande waren; und Petrarca versucht, sich dieser Leistung der Maler zu vergewissern, indem er seine Metaphorik, seine Erzählweise und Darstellungsformen in Richtung auf eine Verbildlichung der Wortsprache verändert. Das macht auch verständlich, warum Petrarca selbst die von ihm verwendeten Begriffe nicht im Sinne scholastischer Verfahrensnormen bestimmt, sondern als Bildbegriffe mehrstufig – wie ein Landschaftspanorama – aufbaut.
Tiefe des Gedankens entwickelt er nicht mehr über die Verwendung geheiligter Formeln, er erzielt Tiefe im Sinne des bildlichen Ausdrucks als Erweiterung, ja Entgrenzung des Bildhorizonts, indem er die Übergänge vom Nahbereich über die mittlere Konfrontationsdistanz in die Tiefe des Bildes verschwimmen läßt – er erreicht damit schon fast ein ›sfumato‹ des Begriffs.
Das philosophische und theologische Talent Petrarcas hätte in jedem Fall hingereicht, im Sinne der ihm tradierten Disziplinen Begriffe zu entwickeln und zu gebrauchen. Er hatte die Lehren aus dem Realismusstreit gezogen: Alle Sprachen verdanken sich der Konvention, dennoch aber ist es unendlich mühsam, diese Konventionen zu verändern.
Petrarca bleibt bei der hauptsächlichen Verwendung des Lateinischen, weil die Mehrzahl seiner Adressaten mit diesem Konventionsgefüge vertraut ist, obwohl er durchaus versteht, daß es die Aufgabe der Dichter zu sein hat, die Konvention der Sprache nicht zur Fessel der menschlichen Äußerungsfähigkeit werden zu lassen.
Freundschaft bekundet die Bereitschaft, den Partner auch jenseits der sprachlichen Konventionen verstehen zu wollen und zu können. Das macht die Freundschaft unabdingbar für das Führen eines offenen Dialogs. Dolcezza gewährt er durch das Bewußtsein, selbst da verstanden zu werden, wo die Unzulänglichkeit des eigenen Ausdrucks den Eindruck nahelegt, als habe der Sprechende selbst nicht verstanden, was er sagen will.
Die studia humanitatis, die solche Bedingungen der Kommunikation zu erkennen erlauben, treten damit an die Stelle gemeinsamer Verpflichtung auf die unumstößliche Offenbarung des eindeutigen Sinnes.
Petrarca beteiligt sich deshalb nicht mehr am Kampf um Häresien, um Abweichungen von; dem als verbindlich gesetzten Sinn der Worte, der sich für ihn doch immer erst im offenen Dialog entwickeln kann. Jeder Dialog wird so zu einem Beispiel für das, was Menschen sich zu sagen vermöchten, wenn sie Gesprächskultur hätten – also einander in Freundschaft verbunden wären.
Das war Petrarca mit einer unglaublich großen Zahl von Menschen, auch über seine Lebenszeit hinaus; sie konnten mit ihm den Dialog aufnehmen, wie er ihn mit den Toten geführt hatte – darin liegt wohl auch eine Erklärung für seine fast einmalige Wirkung durch die Jahrhunderte.
Ich hoffe, hinreichend sichtbar gemacht zu haben, wie wir selbst, die Mitglieder der Jury und die Beteiligten an den jährlichen Preisverleihungen, unsererseits den Dialog mit Petrarca wieder aufnehmen könnten.
3 Zukunft als Verwirklichung von Vergangenheit – Gloria und Lorbeer
Eine der folgenschwersten Konsequenzen aus der durch Petrarca entscheidend geförderten Umorientierung von der Theologie zur Anthropologie als Basiswissenschaft ist der Verlust von Zukunft, wie sie die Heilsgeschichte garantierte.
Was heißt dann noch Zukunft, wenn sie nicht mehr als Erfüllung eines vorgegebenen Plans der Heilsgeschichte bestimmt werden kann? Eine offene Zukunft als das schlechthin Andere, völlig Unerwartbare wagte noch niemand zu denken; es ist ja bis heute die Frage, ob damit überhaupt etwas gedacht wird. In seiner Neubestimmung der Zukunft ist Petrarca tatsächlich der Inaugurator der Renaissance; Renaissance aber nicht als Wiedergeburt oder Auferstehung der Antike verstanden, sondern als deren Verwirklichung.
Der Historiograph Petrarca war weit davon entfernt, ein Historiker im heutigen Sinne zu sein, und das nicht, weil er unfähig gewesen wäre, etwa dem Beispiel der arabischen Historiker der Stauferzeit zu folgen, sondern weil für ihn die Geschichtsschreibung im Sinne seines Verständnisses von der Verwirklichung der Antike eine völlig andere Funktion zu erfüllen hatte. So sind etwa seine Darstellungen des Lebens berühmter Männer nicht als Arbeiten eines Historikers zu verstehen, sondern als die eines Zoographos, das heißt eines lebenschaffenden Künstlers. Für die Zeitgenossen lag darin, vor allem unter Berücksichtigung der damals tausendjährigen theologischen Debatten um die Einmaligkeit der Schöpferkraft des dreieinigen Gottes, eine ungeheure Zumutung, die selbst hundert Jahre später noch nicht ohne weiteres hingenommen werden konnte, als einer der führenden Renaissance-Künstler, Pisanello, sich selbst als Zoographos bezeichnete.
Petrarca wollte sich nicht darauf beschränken, die antiken Gestalten im Leben ihrer Zeit lebendig zu vergegenwärtigen; er glaubte, sie als seine Zeitgenossen zum Leben erwecken zu können. Dabei mußten ganz selbstverständlich diese antiken Gestalten Wesenszüge und Erscheinungsmerkmale annehmen, die mit ihrem historischen Leben nicht viel gemein hatten. Sie erstanden nicht wieder, sie wurden nicht wiedergeboren, sondern sie wurden als solche lebendig, die sie in ihrer Zeit nicht hatten sein können, wozu sie aber geworden wären, wenn sie im Zeitalter Petrarcas zu leben gehabt hätten. Anders gesagt: Die antiken Gestalten verwirklichten sich erst in der Zukunft ihrer eigenen Geschichte. Und als solche Zukunft der Antike verstand Petrarca sein eigenes Zeitalter.
Ein Aspekt dieses Gedankens war bereits in der Antike deutlich verstanden worden und entwickelte sich zum entscheidenden Handlungsantrieb: die Gewißheit, daß Menschen unsterblich sind, also eine prinzipiell unbeschränkbare Zukunft haben, wenn sie um ihrer Taten willen im Gedächtnis der Nachgeborenen lebendig blieben.
Ruhmsucht war das kräftigste Handlungsmotiv des antiken Menschen, weil Ruhm zu erwerben bedeutete, unsterblich zu werden. Es lag an den jeweils Lebenden, sich selbst die Unsterblichkeit zu garantieren, indem sie in täglicher Übung ihrer Erinnerung die heroischen Vorfahren immer noch gegenwärtig und lebendig hielten.
Wer diese Unsterblichkeitsgarantie kraft eigener Erinnerung an die Vorfahren einlöste, konnte damit hoffen, daß auch seine Nachfahren ihm selbst Unsterblichkeit gewähren würden.
In diesem Sinne will Petrarca mit seinen zoographischen Arbeiten zur Geschichte der antiken Gestalten ein Beispiel geben, von dem er hoffen darf, daß die ihm Nachlebenden im gleichen Sinne Petrarca selber Unsterblichkeit gewähren würden und seine Hoffnungen haben ihn ja nicht getrogen. Auch dieser Aspekt des Umgangs mit Geschichte war in der Antike bekannt: Der Dichter wird in dem Maße Ruhm erwerben, in dem er es versteht, den Ruhm seines Heros zu begründen und lebendig zu halten.
Was also ist Zukunft ohne heilsgeschichtliche Gewißheit? Sie wird erzwungen, wenn es gelingt, Geschichte als Dimension der Gegenwart zu erhalten. Die Zukunft jeder Gegenwart besteht in der immer weitergehenden Verwirklichung der Geschichte als Gegenwart. Dabei wird aber nicht nur Vergangenes im Gegenwärtigen wieder zum Leben erweckt, es werden vor allem aus dem Potential der Wahrnehmungen, Vorstellungen und Handlungsmöglichkeiten der Vergangenheit jene in der Gegenwart verwirklicht, die in der Vergangenheit selbst sich nicht hatten durchsetzen und verwirklichen lassen. Das unterscheidet Petrarca von späteren historizistischen Auffassungen, die ihre jeweilige Gegenwart nur mit den Versatzstücken der Vergangenheit möblierten, ja, eigentlich derart verbauten, daß Geschichte ganz dimensionslos wurde.
Welchen Bedeutungszuwachs erfahren vor diesem Verständnis der Zukunft Petrarcas Handlungen und Haltungen! In den ihm teuersten Vergil-Codex schreibt er die Namen seiner Freunde, die der Pest erlagen – er memorierte sie bei jedem Lesen in dem Codex.
Seine Triumphzüge, ein Petrarcascher Topos mit großer Wirkungsgeschichte, werden, als ein tatsächliches Triumphieren über die zeitliche Bedingtheit menschlichen Lebens und allen Tuns, zu weitaus mehr als bloßen Allegorien. Sie sind Prospekte der Zukunft, ja, Handlungsanleitungen dafür, wie sich eine Gesellschaft Zukunft sichern kann. Und seine historischen Epen, vor allem das große Epos ›Africa‹, lassen sich so als Träume von einer Vergangenheit verstehen, wie sie niemals gewesen, aber als Zukunft immer wirklich sein wird.
Verwirklichung bleibt nicht Begriff des bloß literarischen Kontextes, dafür zwei Beispiele.
Petrarca läßt sich am Ostersonntag des Jahres 1341 auf dem Kapitol zu Rom nach antikem Vorbild zum Dichter krönen. Das ist nicht Theater als Gesellschaftsspiel. Er trägt nämlich den Krönungsmantel des regierenden Königs beider Sizilien. Robert der Weise von Neapel war der Vorsitzende der Prüfungskommission, die die Krönungswürdigkeit Petrarcas klären sollte.
Die Prüfung bestand darin, festzustellen, ob Petrarca kraft seines Ingeniums der Rolle und Funktion eines gekrönten Hauptes seiner Zeit gewachsen wäre. Aus der überlieferten Krönungsrede Petrarcas ist herauszulesen, daß er sogar einen besser begründeten Anspruch auf den Lorbeer anmelden konnte als die vom Papst gekrönten Kaiser bzw. die dynastisch und machtpolitisch inaugurierten Könige. Er sah sich nämlich von der Geschichte selbst legitimiert. Denn als Dichter ist er der, der Geschichte schreibt, also vergegenwärtigt und verlebendigt. Das erklärt auch, wieso er sich als Dichter krönen lassen wollte und gekrönt wurde, obwohl sein dichterisches Werk im engeren Sinne bis dahin äußerst schmal gewesen ist, ja, eigentlich lag von ihm nichts anderes vor als die erste Fassung von »Africa«, also der zoographischen Darstellung von Leben und Werk des Scipio Africanus.
Petrarca wird also als Dichter gekrönt – insofern Dichter Verwirklicher der Geschichte sind. Mit 37 Jahren erreicht Petrarca mit der Krönung eine Anerkennung, wie sie von heute aus gesehen erst gerechtfertigt gewesen wäre, nachdem er alle jene Werke verfaßt hatte, in denen man den Dichter Petrarca auf dem Höhepunkt seiner Leistungsmöglichkeiten sieht.
1341 war er fast noch ein Literat ohne Literatur (eine Rolle, die die gegenwärtigen Konzeptkünstler erst wieder ganz zu würdigen in der Lage sind). Es gelang ihm offenbar, bereits seine Auffassung durchzusetzen, daß der Dichter in erster Linie durch seine Haltungen und sein Bewußtsein geprägt werde, aus denen sich dann erst sein Werk mit gewisser Zwangsläufigkeit ergebe.
Zu diesen Haltungen gehört das Verlangen nach Ruhm, das schon gerechtfertigt ist, bevor er mit seinem Werk tatsächlichen Ruhm beanspruchen kann. Die Vergegenständlichung des Ruhms ist der Lorbeerkranz, das Attribut der Nike und der Fama, die den Sieger begleiten, um wie Herolde auf sein ruhmvolles Tun hinzuweisen. Das lateinische Wort für Lorbeer – lauro – veranlaßte Petrarca wahrscheinlich auch zur Wahl des Namens ›Laura‹.
Der Name Laura in den entsprechenden Sonetten kann also für den Ruhm stehen, den man erwirbt, wenn die Liebe zu einem anderen Menschen von jenem als eine Leistung verstanden wird. Eine wenig christliche Auffassung von Liebe, die ja auch die höfische Literatur des Mittelalters schon vertreten hat.
Auch der im Namen einer Dame kämpfende Ritter sah das ja nicht als Dienst im christlichen Sinne, sondern im Sinne eines Lehnsverhältnisses, das er einging, weil es ihm den reichen Gewinn der Anerkennung einzubringen versprach. Petrarca versteht aber diesen Zusammenhang doch anders. Es geht nicht nur um die Anerkennung, die man bei anderen findet, sondern um die Anerkennung, die man anderen verschafft; um den Ruhm, den man ihnen gewährt, indem man sich unablässig in seinen Vorstellungen und Handlungen auf diesen anderen Menschen verpflichtet.
Dabei ist es von geringer Bedeutung, ob der geliebte Mensch das akzeptiert – ja, überhaupt davon weiß. Das zweite Beispiel: Im Jahre 1347 verwirklicht in Rom Cola di Rienzi für neun Monate das Leben in der antiken römischen Republik. Cola ist 1313 als Sohn eines Gastwirts und einer Wäscherin in Rom geboren. Auch er versteht sich als Dichter in der antiken Tradition des Rhetors (Petrarca hat zur späteren Verteidigung Colas Papst und Kaiser eindringlich darauf hingewiesen, daß Cola ein Dichter sei und deswegen nicht für seine Handlungen bestraft werden dürfe wie ein Dieb).
Durch seine rhetorische Begabung fällt Petrarca den rivalisierenden Familien Roms auf, sie wählen ihn zum Gesandten, der dem von den französischen Königen nach Avignon verschleppten Papst über die katastrophalen Verhältnisse in Rom berichten soll, um ihn zum Eingreifen zu veranlassen. In Avignon lernt Petrarca auch Cola kennen.
Auf Fürsprache von Petrarca verleiht Papst Clemens VI. Cola die Würde eines Notars der Städtischen Kammer in Rom. Petrarcas römische Gönner und Freunde in der Familie der Colonna unterstützen natürlich im eigenen machtpolitischen Sinne Cola. Die engere Verbindung mit den rivalisierenden römischen Familien verschafft Cola Einsicht in die römischen Vorgänge, die ihn mehr und mehr desillusionieren. Die Appelle an Papst und rivalisierende Parteien bleiben ohne Erfolg.
So versucht Cola schließlich aus eigener Kraft, der des Rhetors, das römische Chaos zu beheben. Er gründet im Jahre 1347 die antike römische Republik. Er beruft sich dabei auf die Volkssouveränität in der Wahl der eigenen Verfassung. Als Rhetor hat er die Macht, beim Volk eben die Verfassung der antiken römischen Republik durchzusetzen. Am l. August 1347 wird er zum Volkstribunen ausgerufen.
Dabei stellt er zum ersten Mal vor den gesamten Diplomaten in aller Eindeutigkeit den ungeheuren Anspruch dar, den er als Volkstribun mit seinem Versuch, die römische Republik zu verwirklichen, erhebt. Der päpstliche Legat, der bisher Cola unterstützt hatte, erschrickt vor diesem Anspruch, der in seiner Sicht sogar darauf hinausläuft, Cola als neuen Christus (also als den von Vergil verkündeten) akzeptieren zu müssen. Das Erschrecken kulminiert, als in dem Augenblick, in dem Cola den Lorbeer aufs Haupt setzt, eine weiße Taube über den Versammelten auf dem Kapitol kreist.
Nun beginnt der päpstliche Legat eine Einheitsfront aller anderen Parteien gegen Cola zu organisieren. Das wiederum erzwingt härtere Reaktionen Colas. Als Petrarca, der die Verwirklichung der antiken römischen Republik begeistert unterstützte und dadurch sogar die Freundschaft mit den Colonna verlor, am 20. November 1347 in Rom ankommt, vollzog man gerade auf Anordnung des Volkstribuns die Todesstrafe an sechs Mitgliedern der Familie Colonna. Auch bei diesem Versuch, Geschichte als Zukunft zu verwirklichen, ging es nicht um ein Gesellschaftsspiel zur Erbauung des Volkes und der Aristokratie. Man wollte irreversible Tatsachen schaffen.
So irreversibel waren die nun wieder nicht. Cola selbst trägt zu seinem Sturz bei durch »sullanisches« Gebaren. wie es bereits von Cicero als schwerstes Verbrechen des Republikaners gegeißelt werden war. Cola muß Ende November fliehen, versucht bei Kaiser Karl IV. Aufnahme zu finden (weil ja die ghibellinisch/kaiserlich orientierten Römer im deutschen Kaiser ihren Schutzherrn sahen), wird zwei Jahre ohne Urteil ins Gefängnis gesteckt, an den Papst ausgeliefert, aber insgeheim als stille Reserve für mögliche zukünftige Konstellationen in Rom gehalten; schließlich als römischer Senator in päpstlichem Auftrage nach Rom zurückgesandt und dort 1354 bei einem Volksaufstand erschlagen.
Nicht nur bis zur Zeit Petrarcas gab es keinen dem Colas vergleichbaren Versuch, die Vergangenheit als Zukunft einer Gegenwart zu verwirklichen. Wagner und Friedrich Engels haben nicht von ungefähr fast gleichzeitig Rienzi zum Heros künstlerischer Arbeiten gewählt.
Im Mai 1968 wurde in den Hörsälen der Universitäten in auffälliger Weise auf Cola di Rienzi Bezug genommen; allerdings vermittelt über die erste französische Revolution, deren Führer sogar bis in die Einzelheiten der Mode, der Festgestaltung, des Sprachgebrauchs und des rhetorischen Kanons ihre Affinität zur römischen Republik zum Ausdruck brachten.
Alle internationalistischen und sozialen Revolutionen haben sich am Beispiel der antiken römischen Republik orientiert, während die nationalen Kräfte ihre revolutionären Ansprüche stets am Beispiel des mittelalterlichen Königtums orientierten. Dieser Sachverhalt wird noch in der geschlossensten aller Programmarchitekturen im späten 19. Jahrhundert, dem Bau der Wiener Ringstraße, zum Ausdruck gebracht. Parlament, Kunstakademien und Theater sind klassizistisch geprägt, unter Verwendung der Architektursprache der römischen Antike; das Zentrum des national geprägten städtischen Bürgertums, das Rathaus, ist ein überdimensionales Echo dessen, was man für genuine Gotik, das heißt für die Architektursprache des mittelalterlichen Königtums hielt.
Wir sind im Tusculum und nicht in Rom bei dieser dritten Verleihung des Preises. Wieso Tusculum und nicht Rom? Zwar hat Petrarca Cola di Rienzi mit aller Kraft unterstützt, er hat aber, von einem Besuch zu Ende des Rienzi-Unternehmens abgesehen, selber unmittelbar an den Vorgängen keinen Anteil gehabt. Der Grundgedanke des Rienzischen Versuchs als einer Verwirklichung der Geschichte ist von Petrarca vor allem in seiner Beschäftigung mit Cicero entstanden. Hier im Tusculum hatte Cicero seinerseits durch den Bau eines Landhauses, eines Lyceums und eines Gymnasiums den Versuch gemacht, Aspekte der für ihn vorbildlichen griechischen Polis zu realisieren. Hier glaubte er, ein akademisches Lebenszentrum schaffen zu können, das den Vergleich mit jenen des 5. Jahrhunderts vor Christus in Attika nicht zu scheuen haben würde.
Cicero ist durch die Überlieferung seiner Person und Werke die uns – wie auch bereits Petrarca – am besten bekannte historische Persönlichkeit der Antike. Das ermöglichte Petrarca, sein eigenes Leben bis in kleinste Einzelheiten auf das des Cicero auszurichten. Er bildete Parallelen heraus und verstärkte Züge seines Lebensplanes so, daß er die größtmögliche Übereinstimmung mit dem Leben Ciceros aufwies. Petrarca hat also auch sich und sein eigenes Leben als Material der Verwirklichung von Vergangenheit in der Gegenwart eingesetzt. Daß er Cicero aber nicht nur nachahmte, zeigt die Tatsache, daß er in seinen intensiven Gesprächen mit Cicero diesen kritisiert, das heißt ihm klarzumachen versucht, daß der historische Cicero noch nicht in allen Aspekten der Cicero gewesen sei. der er hätte sein können, sein müssen.
Ein weiterer Gesichtspunkt für die Wahl von Tusculum ist Petrarcas Insistieren auf dem genius loci. Tusculum heute ist das alte Tusculum, soweit es in eben diesem Areal einmal existierte. Wir können den Ort heute sehr viel genauer fixieren, als es zu Zeiten Petrarcas möglich war.
Wir stehen hier, wo auch Cicero real leiblich präsent war. Er stünde vielleicht direkt neben uns. Wir können auf den Boden zeigen und wissen, daß er hier war oder vielleicht dort – wohin wir uns aber ebensogut umstandslos begeben können. Die Geographie, der Raum ermöglichen uns Konstanz in der Orientierung, wie sie in der Zeit, in der Geschichte nicht möglich ist.
Petrarca und seine Zeitgenossen stellten sich die Frage, ob Orientierung in Raum oder Zeit für den Menschen von ausschlaggebenderer Bedeutung sind. Die Antwort war deswegen so wichtig, weil man klären mußte, ob die Institution Kirche und ihr höchster Repräsentant, der Papst, als Garanten der Geschichtlichkeit des Lebens von Jesus Christus überhaupt wirksam werden konnten, wenn sie nicht in Rom residierten, sondern irgendwo in der Welt.
Fast durchs ganze 14. Jahrhundert hindurch waren die Päpste aus machtpolitischen Überlegungen der französischen Könige nach Avignon deportiert. War ›Rom‹ das Haupt der Welt, war der christliche Glaube noch bestimmende Macht, wenn ›Rom‹, repräsentiert durch Kirche und Papst, nicht in Rom, an jenem bestimmten Ort, anwesend gedacht werden konnte?
Petrarcas Antwort ist eindeutig, und sie wurde von seinen italienischen Zeitgenossen zumindest auch geteilt: Die Konstanz der Orientierung im Raum ist für den Menschen gerade als historisches Wesen unverzichtbar. Der Papst muß nach Rom zurück. Petrarcas Konzept der Verwirklichung der Geschichte hat nämlich die Konsequenz, daß das zeitliche Vergehen in seiner ganzen unerhörten Radikalität begriffen werden kann.
Was einmal war. hat gerade darin seine geschichtliche Bedeutung, daß es nie wiederkommen kann. Was in der Gegenwart von der Geschichte verwirklicht werden kann – und uns Zukunft garantiert –, ist gerade die historische Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Gewesenen.
4 Divisionem sententiae postulare – Selbstzerfleischung –
Im ›Saal der Neun‹ im Palazzo Publico/Siena sind uns von Petrarcas Zeitgenossen, den Gebrüdern Lorenzetti, zwei in sich thematisch geschlossene Wandmalereien überliefert:
Die Herrschaft der guten und der schlechten Regierung. Innerhalb der Allegorie der schlechten Regierung, die A. Lorenzetti in den Jahren 1337 bis 1339 ausführte, werden wir mit der Gestalt der Divisio konfrontiert.
Auf innerstädtischem Platz, vor der steinernen Stadtmauer mit Zinnenkranz, sitzt die Divisio als weibliche Gewandfigur. Das Gewand besteht aus zwei Stoffbahnen, die eine schwarz, die andere weiß, den heraldischen Farben Sienas. Auf die weiße ist in schwarzen Buchstaben das Wort »SI« eingeschrieben – auf die schwarze in weißen Buchstaben das Wort »NO« –, beide Worte auf einer Ebene in Brusthöhe. Ihr Kopf mit leicht wallendem blonden Haar ist nach links zur Schulter geneigt, die verkrampft hochgezogen wird; der linke Arm hängt starr herab. Der rechte Arm ist nach vorn seitlich ausgewinkelt. Die rechte Hand führt unmittelbar auf dem halbgeöffneten Schoß eine Rahmensäge. Diese Haltung und die Mimik – weit geöffneter Mund und maskenhaft geöffnete Augen in angstvoller Erwartung – verweisen auf das, was vor sich geht: Die nach der Titel-Inschrift erwartbare »divi-sio« wird als Eigenverstümmelung vollzogen.
Zunächst mag man aus Gründen der Symmetriebildung verführt werden anzunehmen, daß der Stellenwert der Divisio im Malgoverno dem der Concordia im Buon Governo entspricht. Dann käme der Divisio etwa die Bedeutung von Discordia zu.
Zwietracht unter den Bürgern, die die »Tyrannia« schürt und ausnutzt. Zwietracht aber ist nicht in dem Sinne ein Erzübel der schlechten Regelung der öffentlichen Angelegenheiten, daß die Bürger unterschiedlicher, unversöhnlicher Meinungen wären, sondern in dem Sinne, daß sie sich nicht gleichermaßen an das ›jus distributiva‹ wie das ›Jus comutativa‹ gebunden fühlen. Im Buon Governo flicht die »Concordia« jene Stränge, mit denen alle Bürger ans Recht gebunden sind: als Freie, solange sie den Rechtsfrieden einhalten; solange sie an einem Strang ziehen, sich der gleichen Sache verpflichten, also concordi sind.
Ans Recht gefesselt sind sie als an einem Strang Gezogene, sobald sie gegen den Rechtsfrieden verstoßen haben. (In der linken oberen Ecke des Freskos, das die Auswirkungen einer guten Regierung darstellt, ist das tradierte Zeichen für Rechtsfrieden, der Galgen mit dem am Strang Gehängten, ausdrücklich hervorgehoben.)
»Divisio« aber ist etwas anderes als »Discordia«, aus ihrem Erscheinungsbild teilt sich das mit: In der »Tyrannia« wird den Bürgern der Zwang auferlegt, willkürlich (nach dem Willen des Stärkeren) und nicht nach Recht und Gerechtigkeit Partei zu ergreifen; zu dekretieren, wer Freund und wer Feind ist, wer gut und wer böse, was wahr sei und was falsch. Wo Willkür und nicht Recht das Kriterium der Unterscheidung ist, herrscht Gewalt. (Die »Divisio« sitzt unmittelbar neben der »Guerra«, dem Bürgerkrieg, wie man im Hinblick auf die senesische Geschichte der damaligen Zeit übersetzen muß.)
Willkürlich erzwungene Parteinahme, die »Divisio«, ist kennzeichnend für »Tyrannia«, weil sie zu teilen fordert, was zusammengehört: Die vielen widerstreitenden Meinungen und Interessen der Bürger erst erfüllen eine Comune mit Lebenskraft, solange die Widerstreitenden sich gleichermaßen Recht und Gerechtigkeit verpflichtet fühlen.
Meinung kann aber nichts anderes sein als ein Hin und Her zwischen »SI« und »NO«, wahr und falsch, das jeden beherrscht, der eine Meinung hat. Wer den Streit der Meinungen stillstellt, zwingt jeden Einzelnen, sich mitten entzweizuteilen. Gewalttätig durchgesetzte »Divisio« macht die Bürger handlungsunfähig, weil sie vernichtet, worum es im Streit der Meinungen gerade geht: nämlich handeln zu müssen, obwohl nicht sichergestellt werden kann, was wahr und was falsch ist. Denn weil das nicht sichergestellt werden kann, entstehen ja verschiedene Meinungen.
Divisio macht handlungsunfähig, da sie der Fiktion entspringt, der Stärkere habe recht, denn durch ihn werde der Streit der Meinungen entschieden. Das ist eine ›Fiktion‹, weil die Lösung des Problems darin besteht, das Problem zu leugnen: Nur Tote sind des Streits enthoben.
Im übrigen: Die Zeitgenossen Lorenzettis – und vor allem Petrarca – stellen die Frage, wie man denn gegen sich selber recht haben könne:
Den Unsicherheiten des Herzens, des Urteils und des Glaubens kann man nicht dadurch entkommen, daß man in sich jene Gefühle, Urteile und Hoffnungen abtötet, derentwegen man dem Zweifel ausgesetzt ist. Petrarca weiß davon viele Lieder zu singen, zum Beispiel jenes berühmte von den »Remediis utriusque fortunae«.
Die Gegenfigur zur »Divisio« ist demnach eher in der »Dialectica« zu sehen, wie sie als Vierpaßmedaillon von Lorenzetti dem ›Buon Governo‹ zugeordnet wurde. Aber selbst Petrarca versteht unter Dialektik des Herzens immer noch das Verfahren, in einem rein formalen Disputieren eine Meinung, einen Glauben als die schließlich verbindlichen herauszuarbeiten.
Lorenzetti dagegen, in unmittelbarer Kenntnis der Schwierigkeiten senesischer Comunalpolitik, versteht aristotelisch die Dialektik als Motor der Meinungsdifferenzierung – nach dem aristotelischen Grundsatz, daß das Prinzip des Handelns nicht in der gestalteten, geschaffenen Welt liegt, sondern im Handelnden.
Die Vielzahl der Meinungen ist nötig, damit diejenige, die der Bürger schließlich unter dem Entscheidungsdruck befolgt, immer noch und nur eine Meinung bleibt und nicht zum Dogma nach vollzogener Divisio wird. Der Bürger als Rhetor darf die Dialektik nicht einsetzen, um Meinungen zu versöhnen, sondern um zu garantieren, daß auch die herrschende Meinung nichts als eine Meinung ist.
Die Senesen glaubten schließlich, ein von dem Meinungsstreit der Bürger nicht betroffener »auswärtiger« Regierungschef könne als »podesta« am ehesten die in jedem Einzelnen wie in der Bürgerschaft divergierenden Meinungen mit den Entscheidungszwängen der Tagespolitik vereinbaren.
Hat Lorenzetti für seine Vergegenständlichung der »Divisio« ein Vorbild gehabt? Soweit mir bekannt ist, kann er sich bestenfalls auf wortsprachliche Vorgaben gestützt haben. Wie auch immer diese Vorgaben gelautet haben mögen: Die bildsprachliche Vergegenständlichung von »Divisio« ist in dieser Form einzigartig, wenn vielleicht auch nicht einmalig. Sie wirkt auf den Betrachter, indem sie ihm die Wahrnehmung des eigenen physiologisch/psychologischen Zustands aufnötigt, den eben erst die Betrachtung der »Divisio« in ihm hervorrufen wird. (2)
Er hört die Säge knirschen; es überträgt sich auf ihn der Schmerz, den das ins Fleisch fetzende Sägeblatt verursacht – und doch sieht er nichts als eine freskierte Gewandfigur. Daß Lorenzetti »die anschauende Betrachtung« durch die Aktivierung anderer Wahrnehmungskanäle derart bis zur Umsetzung in Eigenwahrnehmungen des Betrachters steigern konnte, macht ihn zu einem Repräsentanten der damals wieder neuen Auffassungen von der Möglichkeit, Bildwirkungen zu erzielen. Sie war in der Antike bekannt: Platon führte gegen sie einen erbitterten Kampf, weil sie vom Denken uneinholbar und unkontrollierbar sei. Petrarca spürt ihre Gefährlichkeit, läßt sich aber auf sie ein, wie sein Lob Giottos belegt.
Um 1300 wird sie erneut entdeckt: Giottos Arenafresken beweisen es. Petrarca und Dante arbeiten mit dieser Möglichkeit, Wirkungen zu erzielen, wenn sie auch nur durch Worte Vorstellungsbilder evozieren können und nicht anschaubare Bilder wie die Maler. Die bildenden Künstler beginnen, die Wirkungen ihrer eigenen Vorstellungsbilder auf sich selbst (3) so zu vergegenständlichen, daß sich die Wirkung auf den Betrachter überträgt. (4) Das bedingt Veränderungen der künstlerischen Mittel und Auffassungen. Die Eigengesetzlichkeiten der künstlerischen Medien werden entdeckt, weil man erkennt, daß es unmöglich ist, die künstlerischen Mittel beliebig zu verwenden, um Bildvorstellungen in Gemälde durch bloße Abbildung identisch zu übertragen. Es müssen Übertragungsverfahren unter Berücksichtigung der Eigengesetzlichkeiten künstlerischer Medien entwickelt werden. Das bekannteste von ihnen ist das der ›Perspektive‹, das bereits im 14. Jahrhundert als Problem verstanden, aber nach nicht gelöst wird. Die Eigengesetzlichkeiten erzwingen die Unterscheidung von Konzepten und opera. Darzustellendes Konzept und bildliche Darstellung treten im 14. Jahrhundert verstärkt als Unterscheidung zwischen Begriff und Anschauung, zwischen Text und Bild auf.
Aber, die Texte ändern sich – sie werden selbst bildlich, was vor allem für die Lyrik gilt. Schon in Giottos Vorlage, dem Text der legenda aurea. ist diese Dominanz der Sprachbilder gegeben, da die legenda nicht professionelle Theologie, sondern die alltagssprachliche Beschäftigung mit dem Heilsgeschehen wiedergibt.
Zu Petrarcas Zeiten behauptete die Literatur noch vor der Malerei den Vorrang, weil die Literatur, vor allem Petrarcas Lyrik, in Worten bildsprachlich formulierte – und die Malerei erst versuchen mußte, diesen Programmen angemessene Ausdrucksformen zu entwickeln. Deshalb steht die »Divisio« nicht nur für soziale, politische und psychologische Probleme der Petrarca-Zeit; sie kennzeichnet vielmehr die Probleme der Kommunikation – vor allem die des wort- und bildsprachlichen Ausdrucks. (5)
Divisionem sententiae postulare heißt also zum einen, zwischen Darstellung und Dargestelltem, zwischen Zeichen und Bezeichnetem, zwischen Vorstellungsbild und sprachlichem Ausdruck zu unterscheiden. Zum anderen aber gilt es zu differenzieren zwischen Reflexion und Handeln. Petrarca kämpft mit diesem Problem der Divisio, weil er das Reflektieren bereits als ein Handeln versteht, Das ist sein Weg, den Lebenszusammenhang zu sichern. Er zweifelt selber daran, daß dieser Weg weit führe, weshalb er immer wieder sich direkt auf politische und soziale Konfliktlagen einläßt. Er reist als vermittelnder Diplomat, legitimiert durch die Autorität des Dichters, also legitimiert durch die Kraft der Reflexion. Daß auch der bildende Künstler ein Dichter sei, also reflektiere, begann man zur Zeit Petrarcas gerade erst zu vermuten.
Einheit der Lebensformen hieß für Petrarca auch Einheit der menschlichen Äußerungsmöglichkeiten, die gerade deshalb postuliert werden könnten, weil man sie durchaus als eigenständige, eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorchende erkannte.
Die theologischen Begriffsakrobaten der Scholastik bestanden auf der »Divisio«, ja, sie ordneten bereits in einem modernen Sinne spezifische sprachliche Ausdrucksformen einzelnen Berufen zu; ganz in dem Sinne, in dem man in unserer jüngsten Vergangenheit die Wissenschaften auf wortsprachlich repräsentierte Begriffsbildung beschränken wollte, um andererseits den Künsten bloße Kompetenz in der Ausbildung der Anschaulichkeit zuzugestehen. Petrarcas Bedeutung liegt in diesem Punkt für uns gerade darin, der erzwungenen »Divisio« entgegenzuwirken.
Er sah eine Gefahr darin, sich an Institutionen zu binden, weil sie – mit ihren spezifischen Berufsidioten – die Divisio der menschlichen Entäußerungsfähigkeit und der Lebensformen erzwingen. Dichter zu sein, war für ihn unter Berufung auf Ciceros Lob der Dichtkunst auch kein Beruf, sondern von Natur aus gegebene Fähigkeit, sich der Aufspaltung von Sprechen und Denken, von Handeln und Reflektieren zu widersetzen. Er bestand stets auf der Einheit von sapientia und eloquentia; »weise Beredsamkeit« lautet seine Formel – und nicht die Unterscheidung zwischen Bereichen, in denen man weise ist, also reflektiert, und solchen, in denen man als Rhetor andere Menschen in gewünschter Weise zum Handeln veranlaßt.
5 Das Buch als Instrument und Freund
Es kommt für einen Generalisten nicht darauf an, vieles zu wissen, sondern vieles zu lieben.
Es schüttelt sich heute die Feststellung schnell aus dem Ärmel, daß die Erfindung des Buchdrucks von allergrößter Bedeutung für die Entfaltung unserer Kultur gewesen sei. Man tut dabei aber so, als habe sich erst mit dem Drucken beweglicher Lettern ein allgemeines Bewußtsein vom Buch als Kulturinstrument ersten Ranges ausgebildet. Dem ist nicht so!
Selbst die Klagen über die kaum zu bewältigende Fülle der Bücher, die zur Kenntnis genommen werden wollen, liegen weiter zurück als bis zu dem Zeitpunkt, an dem es durch die neue Produktionstechnik von Büchern zum ersten Mal die Möglichkeit gab, Bücher in hohen Auflagen zu verbreiten. Die entscheidende Veränderung trat nicht mit dem Buch als Massenware auf, sondern ist entstanden, als im 19. Jahrhundert allgemein eine hohe Übertragungsgenauigkeit von Manuskripten in Bücher verbindlich wurde; das heißt zur Zeit, als das philologische Bewußtsein nicht mehr nur für die Gelehrten kennzeichnend war, sondern sich allen an der Bücherproduktion Beteiligten als Selbstverständlichkeit einprägte.
So klagt denn – wie andere vor ihm – auch Petrarca schon über Deformationen des literarischen Lebens, die von der unüberschaubaren Bücherschwemme verursacht worden seien. Das Angebot führte nämlich – »vor nicht allzu langer Zeit«, wie er sagte – dazu, daß die Menschen verführt wurden, Bücher wie Hausrat zu betrachten, vor allem als repräsentative Ausstattung des Hauses für Leute, die sich gern mit dem schmücken, was sie besitzen.
In seinen »Heilmitteln gegen die Anfechtungen des Lebens« gibt er solchen Leuten zu verstehen, daß Bücher von ihnen wie Gefangene gehalten würden, die, könnten sie ihrem Gefängnis, dem Bücherschrank, einmal entfliehen, ihre Besitzer wegen Freiheitsberaubung vor Gericht laden würden. Die Buchbesitzer verurteilten alle diejenigen Bücher zur Wirkungslosigkeit, die sie nur besaßen, aber nicht kennten, und denen sie nur den Eingang in ihre Bibliotheken, nicht aber in ihr Gedächtnis gestatteten. Nur solche Bücher habe man – Petrarca zufolge – unter seine Verfügung zu bringen, zu denen man eine persönliche Beziehung aufbauen könne.
In gewisser Weise findet er sogar Verständnis für Menschen, die sich weigerten, sich überhaupt auf Bücher einzulassen – sei es, daß sie gesehen hatten, wie sehr Bücherbesitz die Tatkraft fesseln kann (»eine schöne Kunst ist das, die aus einem Philosophen einen Büchermenschen macht«); sei es, daß sie durch maßloses Konsumieren der Bücher in den Wahnsinn getrieben worden seien und deswegen Bücher haßten. Petrarcas Sohn gehörte zu den Geschädigten im ersteren Sinne, wie der Vater verständnisvoll darstellt; ein ganz rarer Versuch Petrarcas, zu seinen außerehelichen Kindern väterliche Gefühle zu entwickeln.
Für gesellschaftliche Repräsentanten, die die Deformationen der literati als Büchermenschen für derart gravierend hielten, daß sie forderten, man möge alle Literaten aus ihrer Comune fernhalten, fand er kein Verständnis, denn für ihn war es selbstverständlich, daß – wie in allen Fragen der Lebensführung – auch im Umgang und Gebrauch der Bücher das rechte Maß einzuhalten sei. Diesen seinen Forderungen ist Petrarca selber nachgekommen, soweit er Bücher als Kulturinstrumente schrieb, entdeckte, sammelte und verbreitete. Aber das gelang ihm auch nur in einer verzeihlichen Selbsttäuschung. Er unterschied nämlich das Buch als Instrument vom Buch als Freund und Partner.
Er vermochte seine Bibliomanie vor sich selbst zu rechtfertigen. weil er behauptete, Bücher seien – wie Menschen – mit eigenständigem Charakter, einer eigenen Seele ausgestattet. Wer die zu spüren, gar sichtbar zu machen verstände, sähe sich genötigt, jedes Buch durch dessen Nutzung am Leben zu erhalten.
Aber, wie man unter den Menschen auch einige vor anderen auszeichne, so auch unter den Büchern. So hat er, wo immer er auch lebte und wo immer er auch hinreiste, einige Bücher stets bei sich gehalten. Darunter vor allem die »Bekenntnisse« von Augustin und einen Vergil-Codex.
Was war für Petrarca in der so oft von ihm beschworenen Freundschaft mit den Büchern das einzelne Buch? Bücher versammeln Worte und Wörter in einem ausgegrenzten Bereich, in dem sie ihr Leben entfalten. Ausgegrenzter Bereich – das ist Templum. durch seine Begrenzung herausgehobenes Areal, in das man nur eindringen darf, wenn man das für die Bewegung in diesem Areal vorgeschriebene Ritual beherrscht.
Das Buch ist also Tempel der Werte. Ihre Wirkungsform entdeckt Petrarca wie niemand vor ihm, und er setzt sich ihr aus. »Wie andere empfinden, lasse ich dahingestellt. Wenn ich von mir reden soll, so dürfte es nicht leicht sein, begreiflich zu machen, welche Wirkung auf mich in meiner Einsamkeit gewisse bekannte und vertraute Werte ausüben, die ich mir nicht nur vorzustellen, sondern auch laut auszusprechen pflege, um meinen schlafenden Geist zu wecken.« »Die Worte sind an sich schon heilsamer Balsam für das Ohr.«
Das heißt, Petrarca versteht Worte als Reizfigurationen, die beim lauten Aussprechen bestimmte Vorstellungsbilder, Gefühle und Gedanken evozieren. Die im Tempel des Buches aufgestellten Worte sind zunächst nichts anderes als gestaltete Segmente der materialen Umwelt, auf die sich der Buchbenutzer einläßt. Die Verknüpfung solcher materialer Umwelt-Segmente mit spezifischen Vorstellungen, Gefühlen und Gedanken wird seit der antiken Lehre der Rhetorik als Toposbildung verstanden. »Die Worte« sind also Topoi. Sie schließen sich zu Sinn-Syndromen zusammen. Das jeweilige gesamte Sinn-Syndrom wird beim Rezipierenden aktualisiert, sobald er auch nur einen Topos des Sinn-Syndroms anstößt. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Worte nicht von anderen materialen Bestandteilen unserer Lebensumgebung, die als Topoi der Architektur, der Kleidung, der Mimik und Gestik, der Malerei, Musik oder Plastik wirksam werden.
Marcel Proust konnte Sinn-Syndrome für sich bereits aktualisieren, wenn er eine Madeleine zum Tee verspeiste.
Da es Wort-Topoi in den Tempeln der Bücher gibt, die bei vielen Lesern einer kulturellen Gemeinschaft die gleichen Sinn-Syndrome auslösen, lassen sich in dieser Hinsicht Bücher als Instrumente verstehen; Bücher sind insoweit Instrumente, als sie Menschen zu Mitgliedern einer kulturellen Gemeinschaft werden lassen, wenn sie durch den Gebrauch derselben Bücher zur Entwicklung der gleichen Sinn-Syndrome veranlaßt werden.
Wenn Petrarca sagte, daß er es dahingestellt sein lassen müsse, was andere beim Lesen und Sprechen der Worte empfinden, dann wird auf die ganz persönliche Beziehung des Lesers zum Buch aufmerksam gemacht, die das Buch zu mehr als einem Enkulturationsinstrument macht. Mit den nur in den einzelnen Leser-Persönlichkeiten durch die Wort-Topoi evozierten Sinn-Syndromen charakterisiert sich die jeweils ausgezeichnete Freundschaft des Lesers mit dem Buch.
»Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas weiß, oder ob ich es liebe; ob ich verstehe, oder ob ich danach strebe.«
Zu verstehen ist nur das, was den Mitgliedern einer kulturellen Freundschaft gleichermaßen erschlossen ist. Zu lieben ist nur, wozu ich in einer persönlichen Beziehung stehe, die eben nicht genau so auch anderen zukommt. Etwas zu verstehen heißt, sich der Art der Wirkung von geschriebener oder gesprochener oder sonstwie vergegenständlichter Sprache bewußt zu sein. Nach etwas zu streben meint in diesem Zusammenhang, selbst die Fähigkeit entwickeln zu wollen, durch Gebrauch der Sprache Wirkungen hervorzubringen, die über das hinausgehen, was man selbst und was die Mitglieder der eigenen Kulturgemeinschaft schon wissen und verstehen.
So hat denn Petrarca stets beide Aspekte des Umgangs mit Büchern und des Gebrauchs von Büchern seine Arbeit bestimmen lassen.
Er trug zur Bildung und einer weitergehenden Differenzierung der Kulturgemeinschaft bei, der er angehören wollte, indem er die Fähigkeit seiner Zeitgenossen, wissen und verstehen zu können, zu erweitern trachtete. In dieser Hinsicht sind seine »philologischen« Arbeiten von kaum zu überschätzender Bedeutung.
Sicherung der Quellen, Respekt vor dem Originaltext durch die Garantie möglichst fälschungsfreier Kopien, Bekenntnis zur auch rechtlich verbindlichen Würde von Aussagen, die nicht durch Institutionen oder durch ihren allgemeinen Verwendungszusammenhang autorisiert sind, sondern sich nur auf den einzelnen Literaten als subjektiven Aussagenurheber berufen können – das entwickelte er zu Tugenden des literarisch interessierten Menschen.
Er anerkannte durchaus die Leistung Dantes und seiner Vorgänger zur Stauferzeit, das umgangssprachliche Italienisch (vulgare) auch als Literatursprache ausgebildet zu haben. Aber ihm kam es nicht auf die italienische Sprache als solche an, sondern auf die Bedeutung der literarischen Sprache für die Bildung einer Kulturgemeinschaft, und das heißt für die Freundschaft derer, die bestimmte sprachliche Mitteilungen in gleicher Weise verstehen. Er dachte nicht nationalstaatlich oder national-völkisch.
Die Mitglieder seiner Kulturgemeinschaft mochten in Byzanz oder in Schottland leben; worauf es ankam, war für Petrarca die Tatsache, daß sie über gemeinsames Wissen und Verstehen verfügten. Zwischen ihnen organisierte er immer erneut intensiven Austausch (natürlich auch in der Absicht, von ihnen Hinweise auf bisher unbekannte antike Schriften zu erhalten, die er als Quelle solcher Gemeinsamkeit hoch schätzte).
Mit dem Ziel, möglichst viele Zeitgenossen auf die gleichen Vorstellungen, Gefühle und Gedanken zu verpflichten, verfaßte er sogar einen Reiseführer für Jerusalemfahrten, die »Syrienfahrt«, obwohl er niemals selbst den Nahen Osten bereist hatte.
Das Buch als Kulturinstrument zu fördern, zwingt Petrarca immer wieder auf den offenen Markt.
Der zweite Aspekt im Nutzen (und Schreiben) von Büchern, sich nämlich Freunde zu schaffen, veranlaßt ihn ebenso regelmäßig zum Rückzug in die Einsamkeit. Es fördert die Intensität der Liebe zu den Dingen, wenn man sich ganz auf sie verlassen muß. Da reicht es nicht aus zu wissen und zu verstehen, was man braucht, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Dort – in der Einsamkeit – entfaltet sich das Bedürfnis, uneinschränkbar auch zu lieben, was unser Leben ermöglicht.
(1) Dabei waren die Arbeiten folgender Autoren die Quelle der Gedanken und Argumentationsstütze: Eckhard Kessler: Petrarca und die Geschichte, München 1978; Hans Conrad Peyer u. a.: Das Trecento, Zürich 1960; Walter Rüegg: Anstöße, Frankfurt a. M. 1974; Eberhard Müller-Bochart: Der allegorische Triumphzug, Krefeld 1957; Hanns Wilhelm Eppelsheimer: Petrarca, Frankfurt a. M. 1973; Friedrich Engels: Cola di Renzi, Wuppertal 1974; Eugen Wolf: Petrarca, Darstellung seines Lebensgefühls, Leipzig 1926, Reprint: Hildesheim 1973.
(2) Gonzales – Palicios teilt in »A. L. – La Sala della Pace«, Mailand 1965, S. 6, mit: »...permeato del concetto aristotelico del Bene Cumune che nella rielaborazione tomistica era stato divulgato ai primi del Trecento da un domeniciano fiorentino…« Nebenbei: Der Fiorentino Andrea di Buonaituto, der 1355 die Allegorie des weltlichen und geistlichen Regiments in der Spanischen Kapelle von S. Maria Novella so darstellte, wie die Dominikaner es sahen, frescierte völlig unverständlicherweise vor die Füße von Papst und Kaiser neben der Herde des guten Hirten auch zwei Hunde. Des Rätsels Lösung aus dem Angebot der Wort-Bild-Relationen lautet: Domini – canes = Dominikaner, die sich somit als Hütehunde des Herrn kennzeichnen lassen (vgl.: M. Meiss: The Spanish Chapel, New York 1964).
(3) Darin äußert sich der Anspruch auf Subjektivität, wie er damals programmatisch von Petrarca erhoben wird, entschiedener als in dem Autonomiebestreben der Künstler (vgl. J. Ritter: Subjektivität, Frankfurt a. M. 1967).
(4) Das gilt natürlich in Hinsicht auf jede Art von Wirkung, man sehe daraufhin Lorenzettis »Pax« aus dem »Buon Governo« an. Diese im 14. Jhdt. neu entdeckte Übertragungsleistung von der Darstellung auf den Betrachter gelang Lorenzetti derart, daß sie nur noch einer historisch früheren vergleichbar ist: der der Aphrodite vom Ostgiebel des Parthenon.
(5) Vgl. hierzu ›Text-Bild-Beziehungen‹, Band VII, S. 167 bis 173.
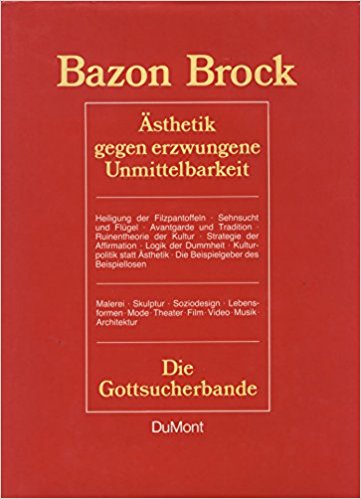 + 1 Bild
+ 1 Bild
