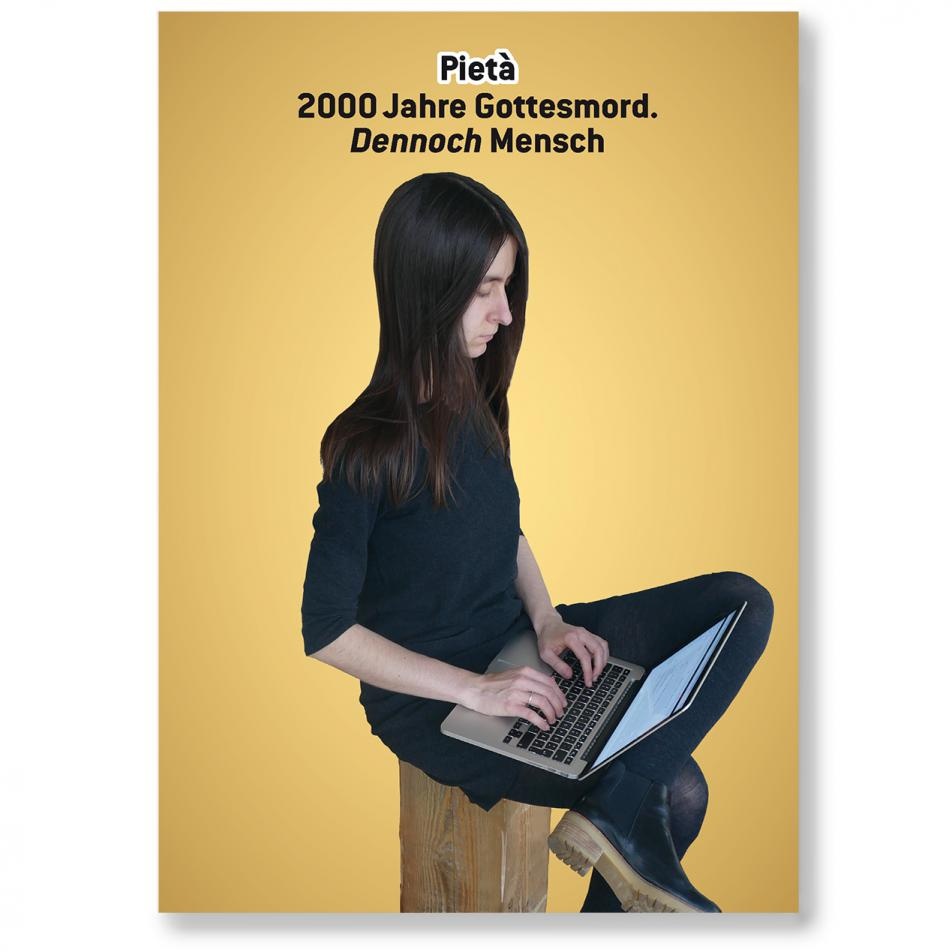Hoffentlich erinnern wir uns alle noch gut an die triumphierende Selbstgerechtigkeit, mit der der Chef von Goldman Sachs in der Finanzkrise nach 2008 das Verhalten der Banker rechtfertigte: er und seine Kollegen vollzögen schließlich den göttlichen Schöpfungsauftrag; und Geldschöpfung sei nun mal gegenwärtig die höchste und effektivste Form der Weltschöpfung.
Wenn wir dieses Leitmotiv der Banker nicht als ein Zeichen bloßer psychischer Störung abtun wollen, weil wir nicht bereit sind, zu akzeptieren, dass die Wirtschaft im Westen von Irren geführt wird wie einst das Dritte Reich vom Teppichbeißer Hitler, dann müssen wir dem Hinweis auf den Schöpfungsbegriff nachgehen.
Der lateinische Begriff creatio hat eine sagenhafte Karriere gemacht in unseren täglichen Appellen an Kreativität. Selbst das Hausmeistern wird kreativ zum facility management erhoben wie Gemüse zum Frischecluster und Ungeeignetsein zur alternativen Begabung. Als prägnanteste Form der creatio galt die Schöpfung aus dem Nichts. Ganz offensichtlich haben die Banker vornehmlich Gott als Zauberer zum Vorbild genommen. (In seiner neuesten Großschöpfung „Die Macht des Heiligen“ hat Hans Joas dem Begriffsfeld der Entzauberung, wie Max Weber es absteckte, eine neue Bedeutungsdimension eröffnet. Wer wie die modernen Äquilibristen in hell erleuchtetem Arbeitsfeld vor der unbestechlichen Kameraoptik vorbehaltlos die Geheimnislosigkeit des „Zauberns“ demonstriert – indem er es als Hochleistungsarbeit ausweist – eröffnet Klarheit, Durchsichtigkeit, Offenheit als die zeitgemäßen Formen des Geheimnisses.) Auch für die Banker galt aus Dreck Gold zu machen – das hieß damals abrissreife Häuser als gesicherte Kreditgarantie zu verbuchen. Der magische Moment des Simsalabim der Zauberer und des „Es werde Licht“ Gottes wird vom Evangelisten Johannes als „Begeistern“ umschrieben, denn der Geist Gottes bringt das Wunder hervor, dass aus nichts etwas wurde. ‚Und warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts?’, fragten die Philosophen. Endlich nun haben die Banker die definitive Antwort gegeben: Es gibt etwas und nicht nichts, weil man damit Billionengewinne erzielen kann.
Also auf den Geist kommt es an, auf den heiligen, wie wir ihn aus dem Konzept der Trinität als Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist kennen. Das Trinitätsschema gilt grundsätzlich für alle Beziehungsformen der Menschen auf der Welt: Es gibt die Menschen und das, was sie als Welt ansprechen oder als Gott oder als Geld. Wenn Menschen die Götter adressieren, dann ist das Entscheidende die mögliche Verbindung zwischen beiden (relatio). Also bezeichnet der Heilige Geist der Trinität stets die Vermittlung zwischen Menschen und ihren Adressaten. Andere Namen für solche Vermittlerqualitäten sind der Glaube, die Hoffnung, die Liebe oder das Medium Geld, das für alle Medien steht.
Wenn man sich fragt, ob es eine wegweisende Basiswissenschaft für alle anderen Disziplinen gibt, so muss dies mit Hinweis auf die Wissenschaftsgeschichte klar bejaht werden. Wissenschaftliche Aussagen schöpfen ihre Begründungszusammenhänge maßgeblich aus der Orientierung auf theologische Lehren und generieren dadurch ihre Geltungskraft. So gilt es, denjenigen Forschern die höchste Anerkennung zuzugestehen, deren Leistung darin besteht, die eigenen Hypothesen zu widerlegen. Dieses Grundsatzprinzip, welches erfolgreiche Wissenschaft als Methode zur Widerlegung von gesetzten Annahmen auszeichnet, ist bereits in der Theologie angelegt. Schließlich wird dort proklamiert, dass Glaube nur durch Zweifel begründet werden kann: Wer nicht zweifelt, kann auch nicht glauben.
Beispielhaft für diesen Zusammenhang steht die Forderung Luthers, dass nur derjenige Priester werden dürfe, der zuvor fünf Jahre lang eine Tätigkeit als Lehrer ausgeübt hatte, denn wie die Förster können die Lehrer der Früchte ihrer Arbeit nie gewiss sein, weil diese erst in Jahrzehnten sichtbar werden. Dies galt ihm als unumgänglich, um Gen. 1, also das Diktum, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, ernst zu nehmen. Die alte Struktur scio ut credo und credo ut scio bedeutet schlicht, dass derjenige, der einen Glauben zu verteidigen hat, wissen muss, was er glaubt. Wenn ein Mathematiker ein Axiom setzt, dann ist dies ein willkürlicher Glaubensakt (später Hypothese genannt), den es durch methodischen Zweifel zu untersuchen gilt. Um Wissen zu generieren, muss also notwendigerweise zuerst geglaubt werden.
Die grundsätzliche Annahme, dass Säkularität und Sakralität zwei entgegengesetzte Systeme seien, die es gegeneinander abzugrenzen gelte, übersieht deren wesentliche Gemeinsamkeiten völlig. Luther war nicht der Erste in der Geschichte, der diesen Irrglauben durchschaut hatte, immerhin griff er selbst auf eine breite humanistische Vorarbeit zurück. Diese war in den 1350er Jahren von Petrarca angestoßen worden – verstärkt durch die Exilierung der Konstantinopler Gelehrten nach dem Untergang des Byzantinischen Reichs – und wurde ab 1456 durch Marsilio Ficino wieder aufgegriffen. Diese humanistische Prägung wurde dann bestimmend für Erasmus von Rotterdam und erwies sich schließlich anschlussfähig für die reformatorischen Bewegungen, in deren Zentrum Luther und Melanchthon standen. Die grundlegende Konstante all ihrer Denkansätze blieb die Einheit von Glauben und Wissen als bekenntnis- und erkenntnistheoretische Denknotwendigkeit.
Der Heilige Geist als Vermittler, Medium, Katalysator – die Wirksamkeit des Sakralen im Säkularen
Wenn nun das Individuum als verwirklichtes Bild Gottes aufgefasst wird, bedeutet dies gleichermaßen, dass es keiner institutionellen Vermittlung mehr bedarf, um eben jenen Gott zu adressieren. Damit ist der wesentliche Schritt unternommen, um das Trinitätsschema im säkularen Bereich geltend zu machen – wenn auch in anderer Form als es die herkömmliche Fassung von 325 (Konzil von Nicäa) gebot. Mit Luthers Umdeutung wird die priesterliche Fürsprache obsolet, weil nun der Mensch selbst eine Entität darstellt, die auf eine andere – nämlich Gott – durch Gebet oder Anrufung bezogen ist. Diese Bezugnahme wird durch den Heiligen Geist gestiftet; er bildet die dritte Entität, durch die der Mensch und Gott verbunden sind. Entgegen dem Vorwurf der Moslems, dass dies ein Verstoß gegen das monotheistische Prinzip sei, muss klar gesagt werden, dass es einen Gott nur in der Trinität geben kann. Ohne die Möglichkeit der Anrufung könnte keine Orientierung auf ihn als Erlöser stattfinden, sodass die Bezugnahme durch den Heiligen Geist das göttliche Prinzip überhaupt erst sichert.
Der Heilige Geist füllte auf allen Ebenen jene Bedeutung aus, die später mit dem Begriff des Mediums abgedeckt wurde. In der Moderne spürten z.B. Joseph Schumpeter und John Maynard Keynes den Heiligen Geist dort auf, wo er in Form des Geldes als zentrales Medium im Kapitalismus in Erscheinung tritt. Geld und Geltung teilen nicht nur einen etymologischen Ursprung, sondern auch eine erkenntnistheoretische Einheit. Denn Geld ist überhaupt nur im Hinblick auf seine Geltung Geld: Wenn es nicht gilt, kann es kein Geld sein. Marx schließlich fand den Heiligen Geist in all unseren Beziehungen anwesend, manifestiert im Geltungsanspruch des Geldes. Selbst die führenden Ökonomen unserer Zeit müssen sich dieser Tage wieder auf die Theologie zurückbesinnen, um die Grundlagen ihres eigenen Tuns zu begreifen. In den USA wird dies noch viel selbstverständlicher gehandhabt als in Deutschland. Wenn sich die Chefs der drei obersten Banken im Nachgang des Börsenskandals als masters of the universe bezeichneten, dann taten sie dies in der Anerkennung der Tatsache, dass die Trennung zwischen Sakralität und Säkularität eine Illusion ist. Der Chef von Goldman Sachs konnte demnach mit absolutem Ernst rechtfertigen, der Vollstrecker göttlichen Willens zu sein.
Gnade und Willkürherrschaft
Im Zentrum des lutherschen Reformationsgedankens standen die fünf Solas (allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein Gnade, allein Gott gehört die Ehre). Ihre Geltung bot einen neuen Zugang zur alten Frage danach, ob einem Menschen die göttliche gratia (Gnade) zuteil wird oder nicht. Weder Werkschaffen noch Fleiß und Erfolg können noch Garanten für deren Zusicherung sein, weil die Anerkennung nicht mehr an Verdienst gekoppelt ist, sondern allein an die Autorität des Gnadengebers.
Das Paradigma „allein die Schrift“ gebietet nach Luther, dass einzig die Offenbarung des geschriebenen Wortes von Bedeutung ist und keine priesterliche Exegese an ihrer Stelle Deutungshoheit beanspruchen kann. Auch in heutigen Dimensionen wird dieses Prinzip umgesetzt, denn der heilige Text der Bundesrepublik mit absoluter Autorität ist das Grundgesetz.
Im Absolutismus wurde schließlich ein Konzept von Gnade eingeführt, das gratia als Machtgeste der totalen Willkürherrschaft durchzusetzen begann. Wer von einer solchen Brutalität betroffen war, konnte nur resignieren oder sich selbst zur willkürlich herrschenden Autorität aufschwingen. Nach heutigen Maßstäben bedeutet dies z.B. Recht und Gesetz zu missachten und allein dasjenige zu tun, was man für opportun hält. Durch derartiges Verhalten wird letztendlich ein ebenso absolutistisches System installiert wie dasjenige, dem man sich entziehen wollte. Inklusions- und Exklusionsverhältnisse sind die bestimmenden Größen dieser neuen Gefüge, die entweder als Vereine, als Regierungen oder als Mafia-Zusammenschlüsse in Erscheinung treten. All diese Formen geben sich als Parallelgesellschaften zu erkennen oder als streng regulierte Clubs, die ihre Macht darauf gründen, dass sie inklusiv nach innen und exklusiv nach außen wirken.
Trotz widriger Umstände: Dennoch Mensch
Doch wer die Machtstrukturen des Sozialen im Sakralrechtlichen organisieren will – ein Beispiel hierfür ist der als Regierungschef auftretende Papst – der muss damit rechnen, auf Widerstände und Kritik zu stoßen. Denn wir alle sind Gestalten eines anthropologischen Grundkonzeptes, das wir mit dem Begriff „Dennoch Mensch“ betitelt haben, hier abgebildet in drei zentralen Denk- und Bildmotiven. In dem Wörtchen „dennoch“ steckt das entscheidende Moment menschlicher Kritikfähigkeit, denn wer im Angesichte eines „dennoch“ lebt, der tut dies ja vor dem Hintergrund von Umständen, die das Leben scheinbar verunmöglichen. Als Lessing in seiner Emilia Galotti fragte, ob es einen Raffael ohne Hände geben kann, war dies eine abstrakte Überlegung, die ihre konkrete Beantwortung knapp 200 Jahre später fand. In den 1950er Jahren gab es Kriegsversehrte, die z.B. ihre Hände an der Front verloren hatten und trotzdem als Maler oder Bildhauer tätig waren; sie produzierten also Kunst, obwohl sie ihrer vermeintlich wichtigsten körperlichen Voraussetzungen beraubt waren. Diese Werke, die „mit dem Munde gemalt“ oder „mit den Füßen gemalt“ waren, zeichneten ihre Schöpfer aus als
Beispielgeber des Menschen, der dennoch lebt. Dies ist das erste tragende Motiv der alltagsspezifischen Orientierung auf das Verhältnis von Glauben und Wissen. Denn nach Kantischer Aufklärungslogik bewegt sich derjenige, der von einem Sachverhalt nichts weiß, in einer defizitären Sphäre. Er hat also einen gewissen Mangel auszugleichen und vollzieht das Schließen der Lücke durch das wirksam werdende „Dennoch“ des Glaubens. Wenn beispielsweise die Schöpfungsgeschichte durch die Erzählung des Urknalls negiert wird, der sich vor 13,7 Milliarden Jahren ereignet haben soll, dann wird sogleich die Frage eröffnet, was denn vor diesem Urknall war, und in diese Lücke der Erzählung fügt sich sogleich wieder das „Dennoch“ in Form der Schöpfungsgeschichte. Auch wenn man sie verdrängen will, kehrt sie als Denknotwendigkeit wieder.
Das zweite zentrale Motiv im Verhältnis von Glauben und Wissen ist ein methodisches. Wenn die beiden Prinzipien in konkreten Fragestellungen aufeinanderprallen, entstehen immer wieder Streitigkeiten über die Deutungshoheit und das bedarf praktikabler Bearbeitung. Wie eine solche nicht aussehen kann, zeigte Ambrogio Lorenzetti in seinem Freskenzyklus „Gute und schlechte Regierung“ von 1338/39. Im Gefolge der „schlechten Regierung“ tritt die Figur Divisio auf, die eine Entscheidung zwischen „Sí“ und „No“ treffen soll. Die beiden Wörter sind links und rechts auf ihrem Gewand appliziert und Divisio zersägt sich selbst entlang einer vertikalen Linie in der Mitte des eigenen Körpers.
Das strikte Beharren auf einer absoluten Unterscheidbarkeit von Ja und Nein fußt also auf dem Unwillen, beide als sich gegenseitig bedingende Entwürfe zu begreifen, und muss schließlich in Selbstvernichtung gipfeln. In dieser metaphorischen Szene, in welcher das Leben als Werkstatt realisiert ist, zeigt sich die dringende Notwendigkeit des „Dennoch“: Wenn die Forderung nach absoluter Entscheidbarkeit in jeder Lebenslage unweigerlich in Selbstzerstörung kulminiert, dann kann die einzige lebenserhaltende Option darin liegen, sich gegen vermeintliche Ausschließlichkeit zu behaupten. Es muss also möglich sein, ein Leben zu führen, das für unwahrscheinlich und absurd gehalten wird.
Das dritte Motiv lautet: „2000 Jahre Gottesmord. Dennoch Mensch.“ Dahinter steckt ein wegweisender Gedanke, den das Christentum in völligem Alleingang entwickelt und somit ägyptische, hethitische, persisch und griechisch-römische Traditionen hinter sich gelassen hat.
Während die gesamte antike Welt ihre Glaubenskraft aus der Vergöttlichung des Menschen schöpfte, gelang es den Christen, diese Idee umgekehrt als Menschwerdung Gottes zu formulieren. Während die von Homer dargestellten Heldenfiguren im Anschluss an ihre Großtaten noch völlig selbstverständlich als göttliche Gestalten verehrt worden sind, wird die Idee des christlichen Gottes auf ganz andere Art realisiert. In der leiblich-menschlichen Präsenz seines Sohnes Jesus Christus manifestiert sich dessen Menschsein effektvoll anhand von zwei Prinzipien: die Geburt als Marias Sohn und der Tod am Kreuz. Mit Luther wurde der Gedanke angestoßen, dass nur anhand der Idee des vermenschlichten Gottes ein vernünftiges Sprechen über diesen überhaupt möglich sei. Dieser Grundgedanke ist noch 1839 beim Gründervater der Soziologie Auguste Comte spürbar, für den es das zentrale Leitmotiv war, Theologie als Sozialwissenschaft umzusetzen.
Alle Aussagen, die wir über Gott treffen können, erreichen dementsprechend nur durch Beobachtung seines Ebenbildes, des Menschen, Aussagekraft. Er wird allein dann beschreibbar, wenn wir Gottesdienst als Menschendienst begreifen.
Dass jenes in Gen. 1 geschaffene menschliche Ebenbild aber keine bloße Abbildung Gottes verkörpert, sondern dessen Menschwerdung selbst bedeuten muss, ist eine Idee, die sich in der gesamten westlichen Welt als fundamentales Prinzip der Einheit von Glauben und Wissen durchsetzte. Diese wurde in ihrer Wirksamkeit erstmalig durch den Staatsrechtler Carl Schmitt beschrieben, der alle tragenden Begriffe des Rechtswesens auf deren theologische Ursprünge hin analysierte. Wer im finanzrechtlichen Sinne von Schuld spricht, hat damit unvermeidbar eine genealogische Brücke zur theologischen Erbschuld gebaut. Die Wirksamkeit solcher Begriffsanalogien zeigt sich jedoch nicht allein in abstrakten Gesellschaftssystemen wie der Sphäre der Rechtsprechung. Auch in den konkreten Tätigkeiten evidenzbasierter Künstler- und Wissenschaftler der Zeit äußerte sich, wie selbstverständlich die Sphären des Sakralen und des Säkularen ineinandergreifen. Für den Religionssoziologen Jacob Taubes muss es eine durchaus delikate Angelegenheit gewesen sein, die Beobachtungen Schmitts im eigenen Arbeiten verwirklicht zu sehen. Ganz ähnlich stand es um den expressionistischen Schriftsteller Theodor Däubler, aber auch um Walter Benjamin; und in besonderer Ausprägung zeugt das dadaistische Werk von Hugo Ball von der Entdeckung Schmitts, dass alle Begrifflichkeiten, innerhalb derer wir die Welt wissenschaftlich verhandeln, durch christliche Glaubensinhalte gestiftet sind.
Wer sich dem Irrglauben hingibt, dass allein die Sachzwanglogiken in streng rationalistischen Systemen wie z.B. innerhalb der Finanzwirtschaft Bestimmungsgrößen für das eigene Leben seien, der wird sich in ähnlich missgünstiger Lage wiederfinden wie die selbstzersägende Figur Divisio in Lorenzettis Fresko. Dies hingegen als Irrglauben anzuerkennen, würde eine fundamentale Einsicht in die Funktionsweisen unserer Lebenswelt bedeuten und wäre eine Bejahung der Tatsache, dass wir noch immer tagtäglich Theologie betreiben müssen, gerade, wenn wir sie durch Rationalität des Säkularen überwunden zu haben glauben.
Dieser Text basiert auf dem Vortrag vom 10.09.17 in der Epiphaniaskirche, Frankfurt a.M. Bearbeitet von Lisa Schmidt-Herzog.