In Literaturmagazin Nr. 12: Nietzsche, Reinbek 1980
»Ich bewundere dies Werk, ich möchte es selbst gemacht haben; in Ermangelung davon verstehe ich es«.
(Nietzsche über Wagners Parzival; zitiert nach: Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hrsg. v. Karl Schlechta, München, 3. Aufl. 1962 (im folgenden zitiert als: Nietzsche), Bd. II, S. 930)
1 Kunst als vereinfachtes Modell des Lebens – Nützliche Mißverständnisse des theoretischen Menschen
Nietzsche war zunächst Philologe, als solcher darauf angewiesen zu zitieren. Seine Vorbehalte gegenüber dem Umgang mit Zitaten ergaben sich gerade aus seinen besonderen philologischen Fähigkeiten. Er erkannte, daß die Sicherung eines historischen Textes nicht mit philologischen Mitteln möglich sei. Der Philologe wird in dem Maße Kulturphilosoph werden müssen, als er sich bemüht, die Zitate als historische zu sichern.
Historisch vergleichende Betrachtung (sie versteht Nietzsche als Bildungsarbeit) verlangt die Fähigkeit, die jeweilige Sprachgegenwart und Geistesgegenwart des Philologen mit dem historischen Text zu konfrontieren. Durch diese Konfrontation muß aber notwenigerweise das Zitat ›verfälscht‹ werden. Es erweitert sich um die historisch vergleichende Betrachtung, die notwendig ist, um es verstehen zu wollen. Was aber ist dann das Zitat noch wert? Es wandelt seinen Charakter zu dem eines Verweises auf einen historischen Sachverhalt, der als solcher nicht eindeutig erschließbar ist.
Durch sein Schopenhauer-Studium war Nietzsche die Schleiermachersche Auffassung des hermeneutischen Verstehens bekannt geworden. Mit Ausnahme seiner ersten großen Abhandlung (›Die Geburt der Tragödie …‹) übernimmt Nietzsche Schopenhauers Text-Typologien und radikalisiert sie immer weitergehender bis hin zur Form des Aphorismus, also zu vereinzelten Text-Segmenten, die untereinander nur noch durch den gemeinsamen Verweis auf den Text-Urheber Nietzsche zusammengehalten werden.
Folgerichtig gibt Nietzsche, vor allem in seinen späteren Schriften, soweit er sich auf fremde Gedanken und Sachverhalte bezieht, nur noch Verweise auf einzelne Autoren, ohne sich auf die konkrete sprachliche Gestalt von deren Aussagen und Texten einzulassen. Das muß den Nietzsche-Leser zunächst irritieren, da er nicht weiß, auf welche konkreten Texte der jeweils von Nietzsche angegebenen Autoren sich der Verweis bezieht. So erscheinen die Verweise, wann immer der Nietzsche-Leser sie auf konkrete Texte beziehen möchte, als unangemessen, ja, als Vergewaltigung, zumindest aber als radikal verkürzend.
Dieser Eindruck ist von Nietzsche bewußt erzeugt worden; sein Verfahren der Verwandlung von Zitaten in Verweise hat Methode, die den Namen »radikale Vereinfachung« trägt. Es liegt in der Natur dieses Vorgehens, daß Nietzsche, wann immer er sich auf andere Autoren einließ, im Grunde nur von sich selbst sprach. (In »Ecce homo« gibt er das ausdrücklich mit Bezug auf seine Beschäftigung mit Wagner und Schopenhauer zu verstehen.) Wenn er sich im folgenden mit Blick auf das Problem »Vereinfachung« zu Wagner äußert, dann meint er vor allem sich selbst und seine Vorgehensweise:
»Wagner bannt und schließt zusammen, was vereinzelt schwach und lässig war. Er hat – wenn ein medizinischer Ausdruck erlaubt ist – eine adstringierende Kraft … Er ist dennoch der Gegensatz des Polyhistors, eines nur zusammentragenden und ordnenden Geistes: Denn er ist ein Zusammenbildner und Beseeler des Zusammengebrachten, ein Vereinfacher der Welt!«(Nietzsche, Bd. I, S. 381)
Das philologische Zusammentragen und Ordnen scheint ihm also im wesentlichen nur eine Verdoppelung der Welt zu bedeuten; sie zu verstehen aber verlange ein Beseelen des Zusammengebrachten, ein Bilden solcher Zusammenhänge, die im Material der Welt bis dato nicht repräsentiert waren. Vereinfachung meint hier also Neuschöpfung; das Neuhervorgebrachte ist deshalb einfacher als die alte Schöpfung, weil vermutet werden muß, daß die Gesetzmäßigkeiten ihrer Entstehung dem bekannt seien, der eine neue Welt erschaffen konnte.
Hier zeigt sich, daß Nietzsche schwerlich ein Künstler gewesen ist, denn sonst wäre ihm aufgefallen, daß die Tatsache, sein Werk selbst erschaffen zu haben, für den Künstler keineswegs bedeutet, daß er dieses Werk besser verstünde als jemand, der dem Werk nur von außen entgegentritt. Nietzsches Zeitgenosse Marx hat in dieser Hinsicht weiter gesehen, da er verstand, warum sich dem Schöpfer selbst sein Werk entfremden muß. Nicht nur die kapitalistischen Produktions- und Distributionsbedingungen entfremden dem Schöpfer das Werk durch Enteignung. Jede Vergegenständlichung des Geistigen im Werk erzwingt Entfremdung, da die Materialien der Vergegenständlichung als Bestand der Welt Eigengesetzmäßigkeiten unterworfen sind, über die kein Künstler nach Belieben verfügen kann.
Auch die eigene psycho-physische Produktionsmaschinerie des schöpferischen Menschen ist als naturevolutionär entstandene seinem Zugriff weitgehend entzogen. Gerade die Psychologie der künstlerischen Kreativität scheint Nietzsche weitgehend verschlossen geblieben zu sein, ein Sachverhalt, der viele seiner Auseinandersetzungen mit Wagner in einem anderen Licht erscheinen läßt (siehe Motto). Wie anders hätte er zu der Auffassung kommen können, daß etwa ein von Wagner gestaltetes Drama gegenüber realen, außer-künstlerischen sozialen Ereignissen eine Vereinfachung darstellen könne?
»Die Kämpfe, welche die Kunst zeigt, sind Vereinfachungen der wirklichen Kämpfe des Lebens, ihre Probleme sind Abkürzungen der unendlich verwickelten Rechnung des menschlichen Handelns und Wollens. Aber gerade darin liegt die Größe und Unentbehrlichkeit der Kunst, daß sie den Schein einer einfacheren Welt, einer kürzeren Lösung der Lebens-Rätsel erregt. Niemand, der am Leben leidet, kann diesen Schein entbehren, wie niemand des Schlafs entbehren kann. Je schwieriger die Erkenntnis von den Gesetzen des Lebens wird, umso inbrünstiger begehren wir nach dem Scheine jener Vereinfachung, wenn auch nur für Augenblicke, umso größer wird die Spannung zwischen der allgemeinen Erkenntnis der Dinge und dem geistig-sittlichen Vermögen des Einzelnen. Damit der Bogen nicht breche, ist die Kunst da.« (Nietzsche Bd. I, S. 385)
Mit dem »Scheine jener Vereinfachung« ist nicht Anschein gemeint, sondern Erscheinung. Es mildert also kein sinnvolles Mißverstehen Nietzsches Behauptung, die Kunst ermögliche es, die uns leidend machende Spannung zwischen der allgemeinen Erkenntnis der Dinge und dem geistig-sittlichen Vermögen der Individuen auszuhalten. Wer anders als die jeweils Einzelnen wäre denn zu einer allgemeinen Erkenntnis der Dinge fähig? Also muß das von Nietzsche tatsächlich Gemeinte wohl so gesagt werden: Da wir zur allgemeinen Erkenntnis der Dinge auf Grund unseres geringen geistig-sittlichen Vermögens unfähig sind, bedürfen wir der künstlerischen Schöpfungen in solchen Vereinfachungen, die unserem geringen geistig-sittlichen Vermögen gerade noch entsprechen.
Aber die Kämpfe der Kunst sind keineswegs Vereinfachungen der wirklichen Kämpfe des Lebens und ihrer Probleme, sind nicht Abkürzungen der unendlich verwickelten Rechnungen des menschlichen Handelns und Wollens, sondern sind ihnen analog und stellen uns die gleichen Probleme wie das Leben. Die Kunstwerke ermöglichen uns aber allein, mit den verwickelten Rechnungen des Lebens so konfrontiert zu werden, wie wir es im Lebensalltag nicht zulassen können. Ihn bewältigen wir eben nur, weil wir in ihm nicht gelten lassen können, daß das Leben eine völlig undurchdringliche, verwickelte Rechnung ist. Das Alltagsleben erzwingt jene Vereinfachungen, die uns über die tatsächlichen Bedingtheiten unseres Lebens hinwegtäuschen. Unsere geistig-sittlichen Kräfte müssen ja nach Nietzsche immerhin dazu ausreichen zu bemerken, daß das Leben unendlich verwickelte Rechnungen aufmacht. Mehr werden wir und die Künstler auch gegenüber den Kunstwerken nicht feststellen können. Die »Erkenntnis von den Gesetzen des Lebens« ist genauso schwierig wie die »Erkenntnis von den Gesetzen der Kunstwerke«. Das »inbrünstige Begehren nach dem Scheine jener Vereinfachung« ist jedenfalls durch Kunstwerke nicht zu befriedigen.
Vereinfachungen als Zusammenbilden und Beseelen der heterogenen Bestandteile von Welt und Leben sind auch nicht mit jener Vereinfachung identisch, die zu Nietzsches Zeiten als entscheidende Methode naturwissenschaftlichen Arbeitens entwickelt wurde. Im naturwissenschaftlichen Experiment werden die »unendlich verwickelten Rechnungen« dadurch nachkalkulierbar, daß man die einzelnen Posten der Rechnungen bewußt auseinanderreißt, um sich jedem einzelnen Posten isoliert widmen zu können. Dabei geht aber, wie gerade Nietzsche immer wieder reklamiert, dem Naturwissenschaftler die Fähigkeit verloren, sich dem Gegenstand seiner Arbeit als einem Ganzen zu nähern. Er addiert nurmehr Teilaspekte, die keine Summe ergeben.
Solchen Vorbehalt äußert Nietzsche später auch gegenüber Wagners Werken – sie seien nichts als Additionen kleinmeisterlich gestalteter Partikel. Hatte Nietzsche also seinen Anspruch, Kunstwerke seien Vereinfachungen der verwickelten Lebensrechnungen, aufgegeben? Im Gegenteil, er hatte nunmehr nur noch sich selbst jene Vereinfachungsleistung vorbehalten, sich – dem philosophischen Begriffsbildner. Schon 1875 sagt er: »Das Dichterische in Wagner zeigt sich darin, daß er in sichtbaren und fühlbaren Vorgängen, nicht in Begriffen denkt, d. h., daß er mythisch denkt, so, wie immer das Volk gedacht hat. Dem Mythos liegt nicht ein Gedanke zugrunde, sondern er selber ist ein Denken. Er teilt eine Vorstellung von der Welt mit, aber in der Abfolge von Vorgängen, Handlungen und Leiden. Der ›Ring der Nibelungen‹ ist ein ungeheures Gedankensystem ohne die begriffliche Form des Gedankens. Vielleicht könnte ein Philosoph etwas ganz Entsprechendes ihm zur Seite stellen, das ganz ohne Bild und Handlung wäre und bloß in Begriffen zu uns spräche: dann hätte man das Gleiche in zwei disparaten Sphären dargestellt - einmal für das Volk, und einmal für den Gegensatz des Volkes, den theoretischen Menschen …« (Nietzsche, Bd. I, S. 413)
Der Mythos des Volkes und der Künstler wurde aufgegeben zugunsten des Mythos, den der theoretische Mensch Nietzsche (als Summe alles Menschenmöglichen) in seinem ›Zarathustra‹ dargestellt zu haben behauptete: »Ohne Bild und Handlung, bloß in Begriffen sprechen«, das ist die simple reduktionistische Auffassung von Vereinfachung, die angeblich durch Begriffsbildung ermöglicht wird – eine schon zu Nietzsches Zeiten nicht mehr diskutable Auffassung von Begriffsbildung. Nur als Reduktionist kann der Philosoph sein »ungeheures Gedankensystem« über der »ungeheuren Fülle und Wüstheit eines scheinbaren Chaos« etablieren. Den Herrn und Gebieter kann man eben doch nur reduktionistischen Systemen gegenüber spielen, die das »Chaos« der Welt zu einem bloß scheinbaren degradieren.
»Wagner rückte das gegenwärtige Leben und die Vergangenheit unter den Lichtstrahl einer Erkenntnis, der stark genug war, um auf ungewohnte Weite hin damit sehen zu können: Deshalb ist er ein Vereinfacher der Welt, denn immer besteht die Vereinfachung der Welt darin, daß der Blick des Erkennenden auf's neue wieder über die ungeheure Fülle und Wüstheit eines scheinbaren Chaos Herr geworden ist, und das in eins zusammendrängt, was früher als unverträglich auseinander lag. Wagner tat dies, indem er zwischen zwei Dingen, die fremd und kalt – wie in getrennten Sphären - zu leben schienen, ein Verhältnis fand: Zwischen Musik und Leben …« (Nietzsche, Bd. I, S. 386)
Das eben ist das Kennzeichen reduktionistischen Systemdenkens – in eins zusammenzuzwingen, was unverträglich auseinanderliegt. Liegt es tatsächlich auseinander, oder scheint es nur auseinanderzuliegen? Im ersten Falle wäre jedes systematische Zusammenschließen unsinnig. Im zweiten Falle wird dem Schein der Trennung nur der Schein des Zusammenhangs entgegengesetzt – oder, richtiger, parallel gesetzt werden können. Beide Erscheinungen der Sphären bleiben dann aber auch als Erscheinung gegeneinander isoliert und nicht ineinander überführbar. Das Verhältnis, das zwischen ihnen gefunden werden kann, ist nur als das der Analogiebildung bestimmbar. Nietzsche konstruiert aber zwischen der Sphäre »absoluter Musik« und der Sphäre bloßer »Lebenserscheinungen« nicht eine Analogie, sondern eine Vermittlung, wie sie herkömmlicherweise als Verhältnis zwischen Wesen und Erscheinung bestimmt wird.
Also:
In einer Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des Zitats zum Verweis möglicherweise nützlich im Hinblick auf die Ökonomie der Kommunikation. Wenn alle Kommunikation darin besteht, sich auf sinnvolle Weise mißzuverstehen, dann vermag das zum Verweis vereinfachte Zitat (das Sich-Einlassen auf andere), die Zahl der möglichen nützlichen Mißverständnisse wohl zu erhöhen. Das Mißverständnis muß aber produktiv sein, was keineswegs dadurch gewährleistet wird, daß das Disparate und Fremde zu einem angeblich Einheitlichen und Vertrauten wird, sondern dann gegeben ist, wenn das bis zum Überdruß Vertraute, das in ritueller Gewöhnung völlig problemlos Gewordene, sich erneut als Problem darstellt. Die Bewegungsdynamik der Geistesgeschichte besteht nicht darin, bisher Verhülltes und Problematisches immer weitergehend zu entwickeln und nach Belieben kalkulierbar werden zu lassen; vielmehr entwickelt sich solche Dynamik daraus, fremde Probleme zu eigenen werden zu lassen und die Fähigkeit zu erwerben, das scheinbar um und um Geschaufelte und Durchgesiebte zur Fundgrube eines Materials werden zu lassen, das bis dato nicht goldwert gewesen war.
Nietzsche zeigt darin positivistische Züge, daß er sich für einen Avantgardisten der immer weitergehenden Entschleierungs- und Enträtselungstätigkeit hält. Er glaubte, bereits die Entdeckungen gemacht zu haben, die erst der Mensch der Zukunft als die tatsächliche Vollendung jener Bewegung erkennen könnte, die sich von den Anfängen kulturschöpferischer Tätigkeit bis zu ihm hin vorangetrieben habe.
Was wollen die heute an Nietzsche Interessierten von ihm? Sie wollen auf ihn verweisen können. Wann immer sie sich auf seine Aussagen als Zitate beziehen, entdecken sie sehr schnell, daß sie wenig Spielraum zu sinnvollen Mißverständnissen bieten. Es haben sich denn auch nicht von ungefähr in der Nietzsche-Rezeption vor allem unsinnige Mißverständnisse eingestellt. Man verweist auf Nietzsche, um sich nicht konkret auf ihn einlassen zu müssen. Man verweist auf ihn als jemanden, der ein Beispiel dafür geboten habe, daß man alles auch ganz anders sehen und verstehen könne, als alle anderen es sehen und verstehen.
Damit wird Nietzsche auch das genommen, was ihn zu einem großen Philosophen unter vielen anderen großen Philosophen macht: nämlich das, was ihn mit ihnen gemein macht. Wir müssen endlich dazu kommen, Nietzsche in genau dem Sinne zu würdigen, in dem wir gehalten sind, die Arbeiten anderer bedeutender Philosophen zu würdigen. Erst, wenn man Nietzsche als einen ganz durchschnittlich guten Philosophen zu lesen lernt, wird sichtbar, was seine größte Leistung ist: die Kontinuität philosophischer Fragestellung nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar entscheidend neu begründet zu haben. In der Durchsetzung solcher Kontinuität liegt die eigentliche menschliche Kraft, sich dem überall drohenden Dimensionsloswerden der Zeit zu widersetzen, und sich nicht vom Schlag der Zeit die Einheit des von der Natur einerseits und den Menschen andererseits zusammengefügten Ganzen in Trümmer legen zu lassen.
»Damit ein Ereignis Größe habe, muß zweierlei zusammenkommen: Der große Sinn derer, die es vollbringen, und der große Sinn derer, die es erleben … In Bayreuth ist auch der Zuschauer anschauenswert … Es werden alle die, die das Bayreuther Fest begehen, als unzeitgemäße Menschen empfunden werden – sie haben anderswo ihre Heimat als in der Zeit …« (Nietzsche, Bd. I, S. 367)
Unzeitgemäß zu werden und seine Heimat anderswo als in der Zeit zu finden, heißt Kontinuität im Denken und Handeln gegen die Zeit zu entwickeln. Das Neue und Andere stellt sich von allein ein: unter dem Druck der Zeit, durch unaufhebbare Entfremdung und durch jene Abweichungen, die allein schon unser schlechtes Gedächtnis erzwingt.
Seien wir auch als Leser Nietzsches ansehenswert, indem wir den Sinn dafür entwickeln, daß auch er nur versuchte, das Unmögliche zu wollen. Das heißt, mehr als bloße Analogien bieten zu wollen. Daraus vermögen wir jenes von Nietzsche so hoch geschätzte griechische Pathos zu entwickeln, das sich bei denen einstellt, die einem Geschehen ausgeliefert sind, von sich aber behaupten, den Konsequenzen ihres eigenen Tuns zu folgen.
Der erst ist ein Anhänger der ›Fröhlichen Wissenschaft‹, der nicht kleinmütig, sondern mit dem Pathos des Erkennenden zu sagen versteht: »Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben.« Es ist das Pathos der Distanzierung aus zu großer Übereinstimmung. Nietzsche als Autor vermag zu solcher Distanz ihm gegenüber anzuleiten, gerade, wo es ihm gelingt, unsere Faszination nur noch zu steigern. Die Ambivalenz von Abstoßen und Anziehen, in der Art, wie ein Autor seine Zeichen setzt, ist das einzige verläßliche Anzeichen dafür, daß uns dieser Autor etwas zu sagen hat.
2 Gesund sein heißt, sich seine Krankheit selbst zu wählen
Nietzsche sah sich am liebsten in der Rolle eines Psychologen, und zwar als Arzt der Kultur.
Dem Arzt wird alle Äußerung anderer Menschen zum Symptom für Abweichungen, die als Krankheit definiert werden. Der Arzt greift nur ein, wenn sich ihm ein Patient mit der Aufforderung stellt, die Abweichungen im psycho-physischen Funktionszusammenhang rückgängig zu machen, auf den Stand vor der Abweichung zurückzuführen. Gesundheit aber kann nicht anders definiert werden denn als Nicht-Thematisierung der psycho-physischen Funktionszusammenhänge. Ein Mensch, der Leib und Seele thematisiert, veranlaßt durch Schmerz und Reduzierung seiner Lebensfähigkeit, ist damit bereits ein Kranker. Nur Kranke haben Organbewußtsein, nur Kranken erschließt sich Lebendigsein als psycho-physischer Funktionszusammenhang.
Nietzsches Vorbehalt gegenüber den Ärzten seiner Zeit (»man muß für seinen Arzt geboren sein – sonst geht man an ihm zugrunde«) entwickelt sich aus der Annahme, daß auch ein Arzt nur den psycho-physischen Funktionszusammenhang thematisieren kann, wenn er selber krank ist – oder es zumindest gewesen ist.
So wird Nietzsches ärztliches Pathos als Mensch, der tief gelitten hat, verständlich (›Ecce homo‹). Er begründet aus seiner eigenen Leidensgeschichte den Anspruch, besser als alle anderen Ärzte die Krankheiten seiner Zeit erkennen zu können, da er tiefer als alle anderen gelitten habe. Krankheit gilt ihm als Zeichen der Auserwähltheit. (Nietzsche, Bd. II, S. 1057)
Es ist bemerkenswert, daß das mondäne Fin de siècle einen ähnlichen Begriff von der aufklärenden und sensibilisierenden Kraft der Krankheit hatte und sich nicht scheute, diesen Begriff mit dem Namen Decadence zu belegen – was auch bei gefälligster Interpretation nur als »Verfallsbewußtsein« verstanden werden kann. Nietzsche polemisiert unablässig gegen die Decadence. Wie das, wenn doch das Bewußtsein von Krankheit und Verfall erst Aufklärung und Sensibilisierung für die psycho-physischen Funktionszusammenhänge der Individuen wie des Organismus ›Gesellschaft‹ ermöglichen?
Es gibt Patienten, die in Kenntnis ihrer Krankheit sich völlig aufgeben, die Krankheit über sich Herr werden lassen und damit das Bewußtsein ihrer Situation verlieren. Als solche sah Nietzsche die Dekadenten seiner Zeit, und in ihrer Bewußtlosigkeit sah er alles untergehen, was sie und ihr Tun zu Symptomen der grundsätzlichen und allgemeinen Befindlichkeit des Menschen in der Welt hätte werden lassen können. Von ihnen zu sprechen, heißt, sich auf weniger einzulassen als auf nichts. Dennoch gegen sie beständig anzurennen, hatte für Nietzsche nur die Funktion, sich selber vor der Überwältigung durch die Krankheit, vor dem Verlust seiner Sprachfähigkeit, zu schützen: Denn die wäre selbst für ihn der Untergang in die Bedeutungslosigkeit für andere gewesen.
Organisches Leben bestimmt sich als beständiger Aufbau stabiler Verhältnisse zwischen Fremd- und Selbstbezug. Fremd- und Selbstbezug sind als Sprachen verstehbar. Also sind Menschen darauf angewiesen, sich sprachlich zu äußern. Nietzsches ärztlicher Psychologenblick faßt, so scheint es, alle sprachliche Zeichengebung als Symptom. Der künstlerische Mensch als »Genie der Mitteilung« (Streifzüge 24) ist also ein Genie der Symptombildung. Damit wird der Patient sein eigener Arzt, der es aushält, sich selbst als krank erkennen zu müssen. Er bejaht seine Krankheit; will sie geradezu - wo er noch nicht in hinreichendem Maße sie symptomatisch fassen kann - weiter vorantreiben. Daraus versteht man ein durchgehendes Motiv von Nietzsches Psychologie: Der Heros der Zerstörung, der Alleszermalmer, der krankmachende Geist ist der tatsächliche Lebensbejaher, weil er in sich die Kraft spürt, sich auch den entsetzlichsten Krankheiten auszuliefern.
Nietzsches psychologische Torturen gleichen denen des Schamanismus. Schamane mit Anspruch auf soziale Führungsrolle als Arzt und Ratgeber wird man nicht durch die Wahl anderer, sondern durch Selbstwahl. Der Schamane setzt sich der selbstinduzierten Disfunktion seiner psycho-physischen Funktionszusammenhänge durch Einnahme von Giften aus, die alle anderen Nichtberufenen aufs entschiedenste meiden. Übersteht der Schamane diese selbstinduzierte Krankheit, so ist damit für ihn und die anderen seine Berufung bestätigt.
In einem wenigstens war Nietzsche ein schlechter Psychologe, denn er verstand nicht, warum ihm seine schamanistisch bestätigte Berufung in der Gesellschaft seiner Zeit keinen Führungsanspruch als Arzt und Ratgeber sicherte. Wie gerne wäre er's gewesen!
Peinlich berühren die ständigen Hinweise auf seine einmaligen Leistungen des Krankseins. Er selbst wollte diese Hinweise als zynische verstanden haben: Ein matter Zynismus für einen Mann, der von sich behauptet, der Welt ihr tiefstes Buch, den Zarathustra, geschenkt zu haben (1. Ecce homo). Es war nicht mehr als kindische Trotzköpfigkeit oder Zeichen dafür, daß auch Nietzsche immer wieder auf die Stufe des bloß dekadenten Patienten zurückfiel, daß es völlig außerhalb seiner Möglichkeiten lag zu verstehen, warum kaum jemand seinen »tiefen« ärztlichen Ratgeber benutzen wollte. Er imaginierte sich einen zukünftigen Menschen, der, da er bloß vorgestellt war, auch leichthin zum Zarathustra-Leser gemodelt werden konnte, der, »wenn er ein Buch von mir in die Hand nimmt, dazu die Schuhe auszieht, wie ich selbst annehme«. (Nietzsche, Bd. II, S. 1099)
Das ist Metapher für die rituelle Annäherung ans Höchste und Fernste – den Kaiser oder den Gott. Folgerichtig sah sich Nietzsche schließlich als den Gekreuzigten, der ihm bis dahin immer noch an den Leistungen des Leidens weit überlegen gewesen war. Merkwürdig: Nietzsche erlaubt sich beständig, Christus und die ihm Nachfolgenden als dekadente Patienten lächerlich zu machen, obwohl doch der Kreuzestod gerade für den Christen als Beweis des Aushaltens und Überwindens auch tödlichen Leidens verstanden wird.
Gerade der Psychologenblick legt für diese totale Verkehrung des christlichen Selbstverständnisses durch Nietzsche Motive nahe, die die besondere Fixierung Nietzsches auf das Christentum belegen. Ist es der Unterschied ums Ganze zwischen Christus und Nietzsche, wenn Nietzsche in der Begründung Christi für seine Leidensbereitschaft: »Nicht, wie ich will, sondern wie Du willst, Herr« eine entscheidende Zurücknahme des menschlichen Lebensanspruches sieht? Sich einem fremden – und sei es dem göttlichen - Willen zu unterwerfen, ist für Nietzsche gleichbedeutend mit dem Verzicht darauf, ein Mensch zu sein. Nietzsches Kreuzesworte lauten: »Nicht, weil Du willst, Herr, sondern weil ich es will – ich empfehle Dir mein Beispiel!«
So häufig auch Nietzsche die naturwissenschaftlichen Positivisten seiner Zeit gegen die Metaphysiker seines Berufsstandes ausspielte – und sich auch als Chemiker darstellte –, so wenig war er als Arzt bereit, naturwissenschaftlich erschlossene Krankheits- und Leidensursachen zu akzeptieren. Auch Arzt konnte er nur als Psychologe sein. Die Einsicht in die Trivialität des physisch Krankmachenden mußte er als persönliche Beleidigung empfinden, denn die Freiheit des menschlichen Willens läßt sich nur darin bestätigen, daß es ihm freisteht, sich der Selbstzerstörung auszuliefern. Auch darin ist Nietzsche ganz Typus des Märtyrers des Glaubens, des Glaubens daran, daß kein Gott sei. Da Märtyrerverhalten gleichermaßen einmal aus der Kraft des Glaubens an den Gott und zum anderen Mal aus der Kraft des Glaubens daran, daß kein Gott sei, entstehen kann, wird Nietzsches Auffassung von aller sprachlichen Zeichengebung als Symptombildung bezweifelbar. Er selbst hat das gespürt und sich teilweise eingestanden.
Seine Theorie der absoluten Musik belegt das. Sie zwang ihn zur Auseinandersetzung mit Wagner, die sein gesamtes Leben und Arbeiten so stark bestimmt hat wie keine andere, wie nicht einmal die mit dem pfäffischen Christentum, der Bismarckschen Reichsideologie, dem Antisemitismus oder der Emanzipation der Frau. Sein entscheidender Einwand gegen Wagner, den er bereits 1871 formulierte – als er sich noch der Hoffnung hingeben konnte, Wagner würde in ihm seinen Christus sehen –, ist der, daß Wagner auch die Musik und nicht nur Wort, Mimus, Bild und Gestus zum bloßen Symptom für das menschliche Unvermögen reduzierte, ein Ganzes und Begründendes als außersprachliche Gegebenheit noch zu denken.
Nietzsche postuliert die absolute Musik als solche außersprachliche Gegebenheit, damit zu verhindern sei, daß Natur und Kultur vollständig im willkürlichen Geflecht beliebiger Bedeutungen gefangen werden, Beute der Bildungsphilister (stolz ist er darauf, diesen Begriff dem öffentlichen Sprachgebrauch zur Verfügung gestellt zu haben). Auch in diesem Anspruch bleibt Nietzsche fixiert auf die, von denen er sich zu unterscheiden behauptet: von den Metaphysikern. Die Philosophie des Seins schreibt er als Philosophie der Musik um. Sphärenklänge, die sich keinem menschlichen Geist verdanken! Was er in dieser Komplettierung der von ihm so genannten Semiotik der Töne, Bilder, Worte und Gesten entwickelte, ist seine spezifische philosophische Leistung. Dem leidenden Nietzsche, dem alle sprachlichen Zeichen zum verweisenden Symptom wurden, entzog schließlich der Selbstbehauptungswille seines Organismus die Kompetenz, weiterhin sein eigener Arzt zu sein. Wir dürfen wohl inzwischen mit einigem Recht annehmen, daß die Entstehung einer schweren Psychose als Selbsterhaltungsmaßnahme des Organismus zu bewerten ist. Nietzsches Zusammenbruch ist, wenn nicht als ein definitiver Widerruf, so doch als Bestätigung unaushaltbarer Zweifel an der Begründbarkeit seiner Symptomlehre aufzufassen.
Was hat Nietzsche dazu veranlaßt, seine schon 1871 skizzierte Auffassung von den spezifischen Leistungen der Wort-, Bild- und Gestensprache und ihres gemeinsamen Bezugs auf das, was er »Absolute Musik« nennt, so stark zu vereinfachen, daß er schließlich nur noch allen Sprachgebrauch als Symptombildung verstehen konnte? Wahrscheinlich ist es seine Auffassung, daß die Leistung eines philosophischen Gedankens danach zu bemessen sei, wie groß seine Wirkung auf andere ist.
Nietzsche wollte sich seiner Leistung vergewissern, fand dafür aber keine Partner. Um sich selbst aber nicht der Unfähigkeit bezichtigen zu müssen, verfiel er darauf zu erklären, warum er keine Dialogpartner hatte finden können: deren Äußerungen oder bewußte Zurückhaltung wurden ihm zum Symptom prinzipiell unüberbrückbarer Differenzen zwischen sich und ihnen. Er konnte nurmehr – wie jeder Psychopath – sprachliche Äußerungen anderer zum Beweis dafür nehmen, daß man ihn nicht verstehen wolle und könne.
Und welche Mühen hatte er sich gegeben, von anderen, vor allem von Wagner, verstanden zu werden! Welche Rolle hatte er für sich dadurch erhofft, daß er glaubte, Wagner besser zu verstehen, als dieser sich selbst verstand? Aus diesem Bemühen wird wohl am besten verständlich, warum Nietzsche seine eigenen Theorien nicht weiterentwickelte, als sie bereits 1871 entwickelt waren, sondern sich darauf beschränkte, Wagner und anderen vorzuwerfen, sie hätten nicht die Kraft gehabt, ihm zu folgen.
3 Absolute Musik als Synonym für Lebendigsein
Dem Kern von Nietzsches grundlegender Theorie konfrontiert man sich am besten in seiner kleinen Schrift ›Über Musik und Wort‹. (Friedrich Nietzsche: Werke, Band I, Nachlaß 1869-1873, Leipzig o.J. Brock gibt im Literaturmagazin eine Zusammenfassung des zitierten Nietzschetextes, die im folgenden Text weggelassen wurde.) Sie ist ein Bruchstück einer Veröffentlichung, in welcher er Schlußfolgerungen aus der ›Geburt der Tragödie‹ für eine neuerliche Arbeit über die Griechen fruchtbar zu machen hoffte.
Andere solcher Bruchstücke faßte er unter dem Titel ›Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern‹ zusammen. Das hier zugrunde gelegte Bruchstück über ›Musik und Wort‹ aus dem Jahre 1871 könnte Vorrede zu einem Buch genannt werden, das nicht nur ungeschrieben blieb, sondern unschreibbar war, weil Nietzsche vor sich selbst glaubhaft zu machen verstand, daß er es bereits geschrieben habe.
In diesem Text beschränkt sich Nietzsche darauf, Wagners Musikproduktion als Aufregungs- und Erinnerungsmusik lächerlich zu machen. Um das zu erreichen, verkürzte er dessen Musiksprache zu einem beschränkten Bündel bloßer symptomatischer Äußerungen dafür, daß es Wagner unmöglich gewesen sei, absolute Musik zu schreiben. Dabei hätte er doch gerade in der zitierten Arbeit die Begründung dafür gehabt, daß absolute Musik nicht geschrieben werden kann, sondern aus der intellektuellen Anstrengung der Musizierenden (vom Zuhörer gar nicht zu reden) als ein Postulat hervorgeht. Musik zu machen bedeutet gerade, hinter alle Konventionalität des symbolischen Ausdrucks zurückzugehen, indem man sich dieser Konvention aussetzt, um sich beim Hören beständig zu zwingen, das vermeintlich Gehörte als bloße Konsequenz der Funktionen unserer Physiologie und Psychologie zu erkennen.
Die nicht in der Konvention aufgehenden »dunklen und unnahbaren Bestandteile der Vorstellungen« können eben in der Konvention nicht zur Erscheinung gebracht werden, sondern nur als jenseits der Konvention liegend postuliert werden.
Die Annäherung einer musikalischen Äußerung an die zu postulierende absolute Musik ist danach zu bemessen, wie weit es ihr gelingt, die Konventionalität der sprachlichen Symbolisierung zum Thema zu erheben.
Ein besonders leistungsfähiges Verfahren dazu stellt gerade die von Wagner extrem deutlich gemachte Eigentümlichkeit des menschlichen Sprachverhaltens dar, nämlich die Notwendigkeit, Begriffe und Anschauungen nicht isoliert voneinander bilden zu können. Die ständige Durchmischung wortsprachlicher, bildsprachlicher und körpersprachlicher Zeichengebung im Wagnerschen Musikdrama entspricht nicht einem Omnipotenzgebaren eines Künstlers, der zugleich Komponist, Dramatiker, Lyriker, bildender Künstler und Ballettmeister sein wollte; das Gesamtkunstwerk ist kein Über-Kunstwerk; (Vgl. hierzu ›Der Hang zum Gesamtkunstwerk‹, Band VI, S. 58-64) es läßt sich vielmehr in der künstlerischen Sprache auf die Bedingungen der Alltagskommunikation ein, und zwar nicht in erster Linie für den Zuhörer, sondern für den Musizierenden. Der Rezipient wird, wie der Dialogpartner der Alltagskommunikation, zu einem unverzichtbaren Partner. Er wird selber produktiv als jemand, der den Sinn der Kommunikation dadurch realisiert, daß er antwortet – und dadurch den Dialog überhaupt erst ermöglicht.
So hatte auch Nietzsche sich in seinem Verhältnis zu Wagner gesehen, ohne indes die naheliegende Schlußfolgerung zu akzeptieren, daß auch das, was er Wagner antworten konnte, nur mit den Mitteln der konventionellen Erinnerungsmusik und der physisch wirkenden Aufregungsmusik gesagt werden konnte. Was Nietzsche in seinem theoretischen Ansatz konzipiert, ist eine Antwort auf die Frage, warum Musik Wirkung erzielen kann, warum Sprache Medium des Gedankens sein kann, wenn doch Sprache und Gedanke, Zeichen und Bezeichnetes, Ausdruck und Ausgedrucktes niemals einander adäquat sein können; warum vielmehr gerade durch die unaufhebbare Differenz zwischen Denken und Sprechen in der Sprache mehr gesagt werden kann, als bei ihrer Konventionalität erwartbar sein dürfte.
Absolute Musik ist für ihn Synonym für das Lebendigsein. Er entdeckte, was später erwiesen wurde, daß der Organismus aus sich heraus – ohne durch Außenreize stimuliert zu sein – eine zunächst allgemeine und unbestimmte Entäußerung leistet, eine unbestimmte Bewegung auf seine Außenwelt hin.
Diese unbestimmte Suchbewegung des Lebendigen, diese Appetenz, wird in spezifische Reaktion umgesetzt, sobald der Organismus in seiner Umwelt solche Konfigurationen antrifft, die er als Reize der Umwelt auf ihn selbst, angeborenen Bedingungen zur Folge, erfahren kann.
Nietzsche behauptet das nun nicht nur für die Basisfunktionen des Lebensorganismus, sondern auch für dessen höhere Funktionen. Auch die Kultur ist in ihren bild-, wort- und körpersprachlichen Zeichenfigurationen als Auslöser für spezifische Entäußerungsformen des menschlichen Geistes aufzufassen. Alle konkreten und sprachlichen Äußerungen sind Auslöserreize für die Manifestation des Geistes oder des Denkens, indem sie dazu anhalten, die Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem, der Welt und unserer Vorstellung von ihr, zu unterscheiden. Das Resultat dieser Denkleistung oder Geistesbewegung kann nicht seinerseits wieder sprachlich vergegenständlicht werden, es kann nur aus der radikalen Thematisierung der bloßen Konventionalität der Zeichengebung gefolgert werden. Weil dem so ist, gibt es eben kein Museum oder Lexikon der ein für allemal erbrachten Leistungen des menschlichen Geistes. Sie müssen immer erneut erbracht werden, woraus sich eben die Dynamik des geistigen Lebens erzwingt. Das eben kennzeichnet jene Revolution, die Nietzsche gerade als Aufgabe der Kunst bezeichnete. Nietzsche hat Wagner nicht als Revolutionär der Gesellschaft gesehen, als jemanden, der politische Utopien etabliert. »Die gute Vernunft bewahre uns vor dem Glauben, daß die Menschheit irgendwann einmal endgültige ideale Ordnungen finden würde, und daß dann das Glück mit immer gleichem Strahle, gleich der Sonne der Tropenländer, auf die solchermaßen Geordneten niederbrennen müsse: Mit diesem Glauben hat Wagner nichts zu tun. Er ist kein Utopist. Wenn er des Glaubens an die Zukunft nicht entraten kann, so heißt dies gerade nur so viel, daß er an den jetzigen Menschen Eigenschaften wahrnimmt, welche nicht zum unveränderlichen Charakter und Knochenbau des menschlichen Wesens gehören, sondern wandelbar, ja vergänglich sind, und daß gerade dieser Eigenschaft wegen die Kunst unter ihnen ohne Heimat, und er selber der vorausgesandte Bote einer anderen Zeit sein müsse.« (Nietzsche, Bd. I, S. 431)
Auch Nietzsche selber gibt für sich zu verstehen, daß er nicht im Sinne eines platten Verständnisses der Funktion politischer Utopien (als Anleitungen zu gesellschaftlichem Handeln) gelesen werden wolle: »Das Letzte, was ich versprechen würde, wäre, die Menschheit zu verbessern.« Die Revolution aller Verhältnisse »in Sitte und Staat, in Erziehung und Verkehr« würde eben erst dadurch gewährleistet, daß man sich endlich auf den unveränderlichen Charakter und Knochenbau des menschlichen Wesens einließe; dazu gehören eben die fundamentalen Bedingungen unseres Selbst- und Fremdbezuges, die erst in der allenthalben demonstrierbaren Differenz von Sprache und Denken, von Zeichen und Vorstellung sichtbar werden.
Dieser Demonstration hat die Anstrengung des Künstlers zu gelten. Sie ist wirkungsvoll und lebensförderlich, wenn es ihr gelingt, eine Gemeinschaft derer zu errichten, die gleichermaßen sich der unaufhebbaren Bedingtheiten des menschlichen Geistes und Lebens bewußt sind und unter ihnen leiden. Wie entsteht eine solche Gemeinschaft? »Wie entsteht sie wieder?
Wagner fand immer nur eine Antwort: Wenn eine Vielheit dieselbe Not litte, wie er sie leidet, das wäre das Volk, sagte er sich. Und wo die gleiche Not zum gleichen Drange und Begehren führen würde, müßte auch dieselbe Art der Befriedigung gesucht, das gleiche Glück in dieser Befriedigung gefunden werden …
Von da aus darf er zurückschließen, wie verwandt seine Not mit der des Volkes sei, als es entstand, und wie das Volk dann wiedererstehen müsse, wenn es viele Wagner geben werde.«
Bis auf den heutigen Tag ist Künstlern keine andere Antwort eingefallen, und hießen sie auch Bert Brecht: Die Wirkung eines Kunstwerks zeigt sich darin, daß aus den wenigen Kennern viele werden, das heißt, daß aus den wenigen bisher unter den Bedingtheiten des menschlichen Geistes und Lebens Leidenden viele werden. Revolution des Ja: viel Leiden schaffen, damit die Revolte durchschlägt.
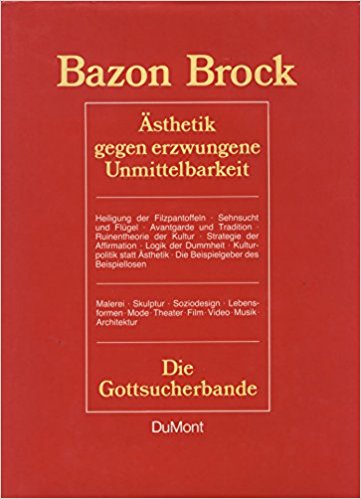 + 1 Bild
+ 1 Bild