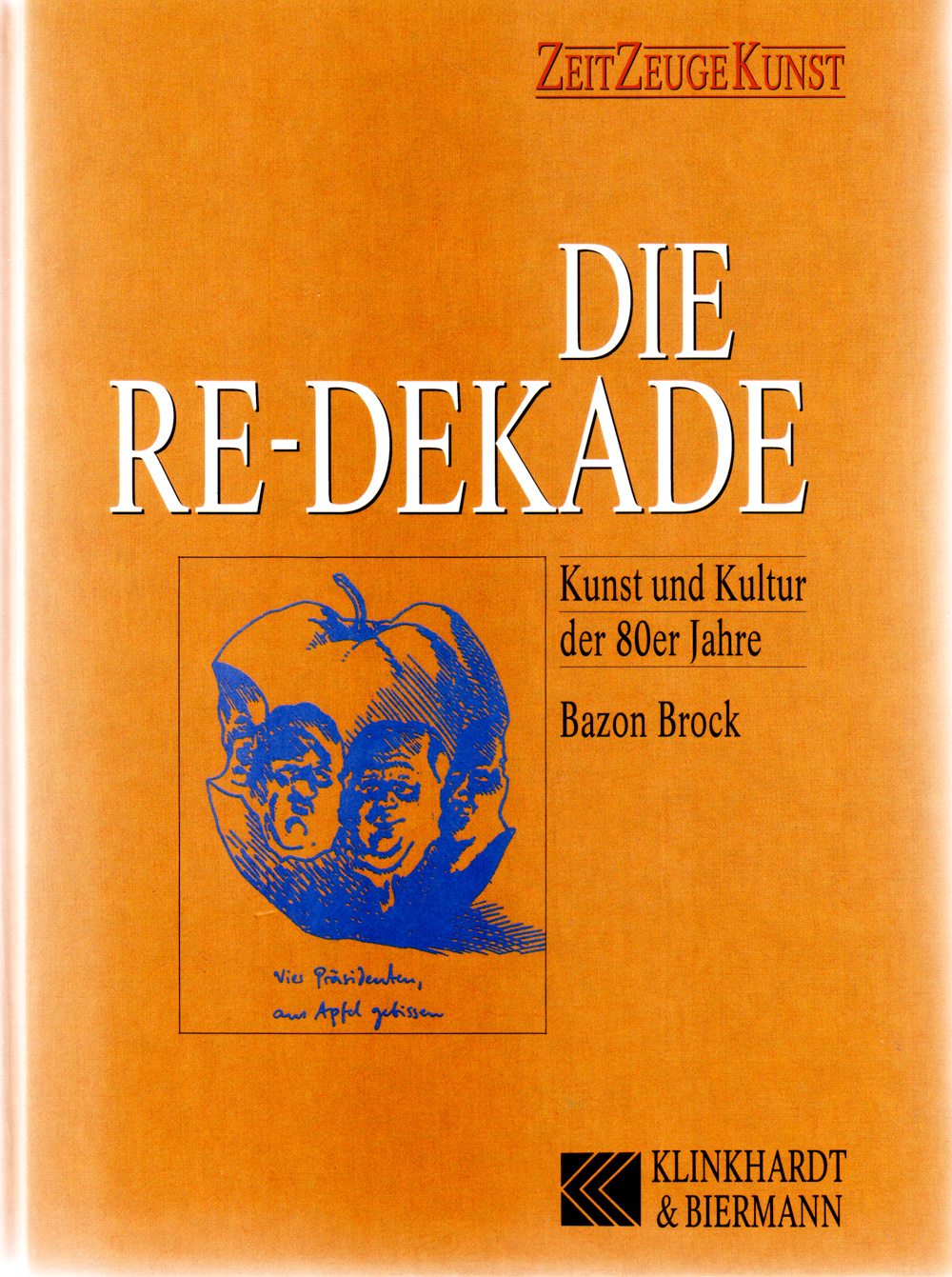In den 80er Jahren formierten sich die größten militärischen und ökonomischen Machtpotentiale der Geschichte. Zugleich aber verringerten sich die Möglichkeiten zur Beeinflussung und Steuerung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Prozesse. Macht konnte sich nicht mehr darin beweisen, die ihr eigenen Ziele gegen andere durchzusetzen. So sehr sich Präsident Reagan ins Zeug legte, die Mission der Westmächte als Kampf gegen das Reich des bösen Kommunismus im Stile der 50er Jahre wiederzubeleben, enthüllte er mit seinem Vorgehen nur die Ohnmacht selbst des Mächtigsten. Das amerikanische Zahlungsbilanzdefizit wuchs so weit an, daß die Wirtschaft als Basis militärischer und politischer Macht zusammenzubrechen drohte. Je effektvoller sich der Machtanspruch zu beweisen versuchte, als desto hohler erwies er sich; und zwar unabhängig davon, ob man Unterwerfungsmacht oder bloß Ordnungsmacht auszuüben beabsichtigte. Da half es wenig, daß sich Reagan die alten Strategien zur Rettung des christlich humanistischen Westens durch Unterwerfung der kommunistischen Bedrohung umformulieren ließ zur Verpflichtung, Macht müsse demonstriert werden, um der Welt eine Ordnung zu geben, denn er beharrte ja nach wie vor darauf, daß die zu gewährleistende Ordnung die des Westens zu sein habe. Allerdings konnte der Beweis ihrer Überlegenheit nur noch ökonomisch erbracht werden. Es galt also, diesen Beweis nicht länger durch eigene militärische Aufrüstung zu gefährden. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, militärisch abzurüsten. Den Gegner durch militärische Aufrüstung ökonomisch in die Knie zu zwingen, hatte sich auch für den Westen als kontraproduktiv erwiesen. Nun kam es darauf an, den Osten mit humanitärem Pathos zur Abrüstung zu verpflichten. Die Abrüstungsdebatten waren seit hundert Jahren geführt worden, aber schlußendlich am Einspruch der Militärs aller Lager gescheitert. Umso erstaunlicher, daß in den 80er Jahren gerade Militärstrategen zum ersten Mal offensiv Abrüstung betrieben – vor allem die atomare. Denn die Atomwaffen hatten es ihnen unmöglich gemacht, Kriege unter Anwendung aller Potentiale zu führen. In Vietnam, Afghanistan und in vielen Stellvertreterkriegen der Dritten Welt hatten diese Militärs Ohnmachtserfahrungen gemacht; sie wollten die Niederlagen nicht länger als militärisches Versagen zu ihren Lasten bewertet wissen. Sie stimmten nicht nur der Abrüstung zu, sondern forderten sie auch in der Vermutung, durch Abrüstung würden Kriege endlich wieder so führbar, daß das Militär als Machtfaktor erneut zur Geltung käme – ein Kalkül, das die Euphorie über die Abrüstungsvereinbarungen in den 80er Jahren erheblich dämpfte. Aber der Ohnmacht der Macht zu entgehen, ist wohl auch durch Reorganisation konventioneller Typen ihrer Ausübung wenig aussichtsreich.
Stasi, KGB, CIA und die gewaltigen Militärmaschinerien waren ja nicht nur durch ihre eigene Gigantomanie gelähmt worden, aufgrund derer sie allesamt sich bei der erstbesten Belastungsprobe als weitgehend machtlos erweisen mußten. Machtausübung selber war fraglich geworden, weil sie stets nur Gegenmacht produzierte, die nicht bereit war, sich an vorgegebene Regeln eines Machtkampfes zu halten. Solcher aller Regeln spottenden Gegenmacht, war man zum erstenmal in Vietnam begegnet und unterlegen, wenn man von den Erfahrungen absieht, die die deutsche Wehrmacht mit dem sogenannten Bandenkrieg und den Widerstandskämpfern hinter der Front gemacht hatte. Die Gegenmacht der chaotischen Regellosigkeit und Unberechenbarkeit, des Terrors und der Sabotage ist gerade dann besonders bedrohlich, wenn reguläre militärische Machtausübung auf eine hochkomplexe technische, organisatorische und wirtschaftliche Basis angewiesen ist. Das aber ist der Fall, und
deswegen würde jede Machtausübung die Zerstörung ihrer eigenen Basis betreiben.
Worin gründet dieser Mechanismus der Selbstzerstörung von Macht durch ihre Ausübung? Freud hatte ihn in einem anthropologisch verankerten menschlichen Antrieb zur Selbstzerstörung vermutet. Massenpsychologen und Organisationssoziologen meinten, totalitär werdende Macht sei ein Selbstwiderspruch, weil sie den Gegner nicht mehr außen finden könne, sondern ihn im System selbst mutwillig zu definieren habe und somit die Energien auch gegen das eigene Machtsystem richten müsse. Elias Canetti hatte in seinem Hauptwerk MASSE UND MACHT, das er zur Zeit des Aufbaus totalitärer Regime in Europa schrieb, einen anderen Ansatz gewählt, der in den 80er Jahren größeres Interesse fand als sein literarisches Werk. Natürlich läßt sich dieser Ansatz hier nur in einer Hinsicht und auch noch sentenzenhaft verkürzt anführen.
Meister solcher Sentenzenbildung war der 1987 verstorbene Jacob Taubes. Er forderte den Mut des Lesers, in jedem Buch den einen Satz aufzuspüren, um dessentwillen es geschrieben worden sei. Und er empfahl den Lesern, diesen Satz so volksweisheitlich wie möglich zu formulieren. „Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu“, sei zum Beispiel eine durchaus sinnvolle Zusammenfassung der kantischen Reflexionsanstrengung. Die volksweisheitliche Maxime philosophisch einzuholen, sei Leistung genug. Bei Canetti fällt es relativ leicht, eine „Taubes-Summe“ zu bilden: „Macht geht über Leichen.“
Zumindest für MASSE UND MACHT (das Werk müßte eigentlich „Masse gegen Macht“ heißen) steht im Mittelpunkt aller Canettischer Fragen, ob auch der Philosoph, der Anthropologe, der Kulturtheoretiker keine tieferen Einsichten über die Anatomie der Macht zu entwickeln vermag, als die Feststellung, Macht begründe sich in der Macht zu töten. Canetti entwickelte die Bedingungen der Möglichkeit, derartige Macht zu zähmen: Wenn wir uns aus der Lähmung vor der Endgültigkeit des Todes befreiten, entzögen wir der Macht die Verfügung über uns.
Wer den Tod nicht fürchtet, kann von der Macht durch Androhung des Todes nicht zur Unterwerfung gezwungen werden. Andererseits sind die Agenten der Macht selbst mächtig, weil todesmutig als Krieger und todesvergessen als Ideologen. Die Einzigartigkeit der Position Canettis in der zeitgeschichtlichen Situation, in der er MASSE UND MACHT schrieb, besteht nun darin, sich nicht wie Heidegger, Benn oder Jünger den Versprechungen überlassen zu haben, die etwa der Faschismus den Zeitgenossen machte, um dem Tod seine drohende Endgültigkeit zu nehmen, indem man die Lebenden darauf verpflichtete, die Toten, zumindest jene, die sich selbst geopfert hatten, präsent zu halten. Die Kulturvorstellung der Nationalsozialisten manifestierte sich nirgends so eindeutig wie in den Totenfeiern als vom Kollektiv bezeugte Vergegenwärtigung der Toten.
Die neoklassizistische Aura solcher Feiern (in Architektur- und Ritualformen) war nicht zufällig, da antike Griechen und Römer schon sehr ähnliche Strategien zur Überwindung des Todes entwickelt hatten. Erinnert sei an die Lokrer, die in ihrer Phalanx stets eine Position freiließen; sie stellten sich vor, daß in diesem Leerraum ihr toter Kulturheld Ajax als Mitkämpfer der Lebenden Gestalt annehmen würde. Die Mitglieder der antiken Polis waren zum Opfer ihres Lebens in der Schlacht bereit, weil ihnen die Gemeinschaft versicherte, das Andenken an die Toten auf alle Zeit lebendig zu erhalten.
Canetti durchschaute diese Verschwisterung des Lebens mit dem Tode als einen Trick der Machthaber, ihre Opfer nicht selber töten zu müssen, sie vielmehr dazu anzustiften, das Selbstopfer als kulturelle Pflicht zu akzeptieren. Die Macht blieb weiterhin auf den Tod gestützt; nun, in solchen Totenerweckungsfeiern zusätzlich legitimiert durch das Einverständnis der Opfer.
Daß Canetti auch eine andere, damals weit verbreitete Variante der vermeintlichen Überwindung des Todes, die der Wagnerianer und christlichen Apokalyptiker, nicht akzeptieren konnte, ist selbstverständlich. Auferstehung durch Untergang, Erlösung durch Vernichtung waren für ihn keine zeitgemäßen Formen der Transzendierung des Todes; so weit hatten bei aller sonstigen strikten Entgegensetzung die Analysen Nietzsches auch für Canetti Geltung. „Gott ist tot“, na und? Waren nicht gerade die Menschen immer nur Tote auf Abruf, solange noch Gott in ihren Gedanken und Vorstellungen lebte und ihnen nahelegte, sich bereitwillig auf den Tod einzulassen als eine unabdingbare Voraussetzung ewigen Lebens?
Bestand die Einzigartigkeit der canettischen Position nur darin, die von seinen Zeitgenossen freudig akzeptierten Formen der Transzendierung des Todes und damit der Macht abzulehnen? MASSE UND MACHT ist erst erschienen, als sich die westlichen Konsumgesellschaften ihrer inneren Logik gehorchend auf ganz andere Weise des Todes und der Toten entledigten. Hätte MASSE UND MACHT eine andere Wirkungsgeschichte gehabt, wenn das Werk 1938 erschienen wäre; oder konnte das Werk nicht vielmehr erst Wirkung erzielen, als man in ihm eine Rechtfertigung der Gleichgültigkeit und des Vergessens gegenüber dem Tod sehen konnte? Man las MASSE UND MACHT wie „Der Tod in Hollywood“, geschrieben aber von einem alteuropäischen Philosophen und Kulturtheoretiker. Man las MASSE UND MACHT als eine politische Satire – wahrscheinlich haben deswegen die für das Thema eigentlich zuständigen Fachwissenschaftler Canetti nicht als Theoretiker ihresgleichen ernstgenommen.
Dafür kann ich mich selbst als Beispiel betrachten. Ich veröffentlichte 1963 eine Reihe von Literaturblechen und Manifesten, zum Teil zusammen mit Hermann Göpfert in Frankfurt. Eines dieser Bleche, gestaltet wie die allgegenwärtigen Garagenhinweise auf Rauchverbote, ließ wissen: „
Der Tod muß abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muß aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter.“ Ein Passant, der uns in einem Frankfurter Parkhaus dieses Blech anschlagen sah, fragte mich unvermittelt: „Kennen Sie Canetti?“. Ich kannte ihn nicht. In gewisser Weise liegt eine Faszination für mich darin, daß ich mich beständig bemühe, ihm zu entgehen.
Als meine Freundin Huss, Buchhändlerin in Frankfurt, mit höchster Emphase von Canettis „Blendung“ sprach, in der Absicht, mich zum Lesen des Werkes zu überreden, verstärkte sich in mir der Widerstand gegen diese Empfehlung in dem Maße, in dem Huss Canetti wörtlich wiedergab. Das Werk gewann Macht über mich durch den Schrecken, den es verbreitete. Was da ausgesprochen wird, empfand ich als tödliche Bedrohung, als Aufforderung zur Unterwerfung unter die Macht des Todes.
Bei Huss sah ich Canetti leibhaftig. Mir wurde schlagartig klar, daß er eigentlich ein Machtmensch ist, eine herrscherliche Figur, zu Ausbrüchen neigend, ja jähzornig. In seinen unnachahmlichen Selbststilisierungen leugnete er diese Disposition nicht, sondern thematisierte sie, und das weckte mein Vertrauen zu ihm. Ich merkte, daß er von der Macht nicht redete wie ein Arzt von den Krankheiten der anderen; die hatte ich nämlich hinreichend oft sagen hören, was Thomas Mann seinen geheimrätlichen Klinikchef sagen läßt: „Mensch, stellen Sie sich nicht so an, sterben müssen wir ja schließlich alle.“ Mir hatte bei diesen Gelegenheiten nicht einleuchten wollen, wie Ärzte ihre Künste ausschließlich aus dem Widerstand gegen die Willkür der Todesdrohung begründeten, um am Ende zumeist in Gesprächen mit den Angehörigen der verstorbenen Patienten die „Schicksalhaftigkeit“ der Krankheit zum Tode als Trost anzupreisen.
Zu dergleichen Selbstbeschwichtigung verstand sich Canetti nicht. Alle seine Gesprächsbeiträge waren auf ihn selbst gerichtet. Er argumentierte nur gegen sich selbst und darin für sich selbst. Seine schamanenhafte Kraft, die Gesprächspartner zu verzaubern, zu entzücken, zu fesseln und zu konzentrieren, galt eigentlich ihm selber; und er verstand es, sich selbst zu fesseln und zu konzentrieren, sich also keine Auswege aus seinem Dilemma zu gestatten. Und das war gewiß von bedeutenderer Art als das Dilemma des hermeneutischen Zirkels und das der logischen Paradoxien, mit denen sich gebildetes oder gelehrtes Publikum seiner Geistesgegenwart versicherte. „Ein Jesus“, dachte ich, aber ohne den fremden Willen, dem er gehorchte. Er hatte die Macht, seinen Willen durchzusetzen, überzeugte sich selber aber mit äußerster Härte, daß er von dieser Macht keinen Gebrauch machen dürfe, um nicht denen gleich zu werden, die vor tödlich drohender Macht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren.
An diesem Nachmittag mit Canetti bei Huss hatte ich gegenüber MASSE UND MACHT ein ähnliches Evidenzerlebnis, wie es Canetti an den für sein Werk bedeutsamen Daten 1922, 1927, 1933 gehabt hatte. (7) Canetti schrieb dieses Werk, um sich in zweifacher Hinsicht zu rechtfertigen: er wollte ergründen und begründen, inwieweit er sich dem Anschluß an die Massen und ihre damalige historische Mission entziehen durfte, und er wollte wissen, inwieweit er sich ihnen anschließen mußte, in ihnen aufgehen und sich ihnen opfern durfte. So gesehen, liegt die Einmaligkeit der Position Canettis in der damaligen Zeit darin, im Unterschied zu allen anderen Autoren eine Apologie der Massen als Gegenmacht geschrieben zu haben. Die bürgerlichen Kulturtheoretiker, und ihnen folgte Canetti insofern, als er als bürgerlicher Intellektueller sich der Masse entzog, verstanden die Masse als willfähriges Medium der Macht oder der Gegenmacht, von Agitatoren geführt und verführt, eine blinde naturwüchsige Kraft der Erzwingung dessen, was weder durch Erkenntnis noch durch Verstehen, weder durch Arbeit noch durch Beten zur Erscheinung gebracht werden konnte: Universalia sollen Realia werden als Macht des Geistes, der abstrakten Begrifflichkeit, der Liebe, des Hasses, der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Die bürgerlichen Intellektuellen hatten diese Universalia geprägt; jetzt versuchten sie, sich der Verantwortung zu entziehen, jetzt, sobald die Massen die äquivalenten Realia zu diesen Abstraktionen auf der Straße verwirklichten.
Canetti ahnte, woher das Dilemma des bürgerlichen Intellektuellen rührte: aus der unkritischen Übernahme abstrakter Begriffsarbeit als Handlungsanleitung für das Leben der Menschen. Aber gingen diese Entfaltungen der Massen tatsächlich auf dieses prinzipielle Mißverständnis zurück? Waren die Massen so zu beurteilen? War dieses Urteil nur die Konsequenz der Selbstverblendung der bürgerlichen Intellektuellen, Konsequenz ihrer geheimen Machtgelüste, die sich nur deshalb in humanitären und sozialutopischen Konstrukten verkleideten, weil in den anderen Verkleidungen des Machtstrebens schon steinerne Gäste steckten; konnte man die Willkür der Masse nicht geradezu als genuinen Versuch werten, dem Zugriff der Macht zu entgehen; konstituierte sich nicht in der tatsächlichen Unbeherrschbarkeit der Bewegung der Massen eine Wirklichkeit jenseits der Macht, des Geldes und der Unsterblichkeit (als alteuropäische Form der Transzendierung des Todes)?
Denn wirklich ist nur das, worauf wir keinen Einfluß haben, sonst wäre ja die Wirklichkeit von den Phantasmagorien und Wahnvorstellungen der Paranoiker der Macht nicht mehr zu unterscheiden. Und die Bewegung der Massen entzog sich jedem Versuch, ihr einen fremden Willen aufzunötigen.
Canetti entdeckte die Masse als kritische Größe der Bedrohung von Macht, weshalb Machthaber aller Zeiten nichts so fürchten wie den Aufstand der Masse. Das gilt selbst für die Festmasse und andere von Canetti beschriebene Gattungen der Masse (8), die primär gar nicht auf Widerstand gegen die Macht orientiert zu sein scheinen.
Im Einzelnen kann die Genese des canettischen Gedankens nicht nachgezeichnet werden, aber die Bedeutung seiner Entdeckung läßt sich gerade heute ausmachen. Die Machteliten der Programmacher und Machthaber der Massenmedien sind unter der Logik ihrer zirkulären Selbstrechtfertigung, den Massengeschmack, den Massenwillen immer schon antizipieren zu müssen, Opfer ihrer eigenen Vorstellungen geworden, die Massen beherrschen zu können. Diese Machthaber wundern sich immer noch, daß zumindest von Zeit zu Zeit mit noch so vielen Marketingstudien und Massenpropaganda die Käufermassen und Wählermassen ihnen nicht gehorchen, ja daß im Gegenteil die Massen, wie zum Beispiel im Fall der Ökologiedebatte, die Machteliten zwingen können, sich Thematisierungen anzubequemen, die geeignet sind, jeden Machtanspruch zu widerlegen, weil diese Ansprüche nicht erfüllt werden können. Die bloß scheinhafte Legitimation der Macht als Erfüllung des Massenwillens liquidiert die Macht.
Eine Weltzivilisation, die sich bereits jetzt unabdingbar darauf einstellen muß, Verbindlichkeit in die Beziehung zwischen Menschen zu bringen und ohne die letztgültige Drohung mit dem ökonomischen, sozialen, militärischen Ernstfall auszukommen, kann gegen die über Leichen gehende Macht kaum noch etwas ausrichten.
Der tödliche Ernstfall ist keine Größe mehr, die sich ins Kalkül der Mächtigen einbeziehen ließe, es sei denn um den Preis von deren Selbstvernichtung. Der aber kann die Machtelite nicht zustimmen, weil auch ihr nicht mehr tatsächlich glaubwürdig die christliche Erwartung der Apokalypse als Weg ins ewige Leben oder irgendein anderes fundamentalistisches Dogma zur Verfügung steht; ihr aber andererseits auch nicht die Wiederaufnahme faschistischer Versprechen auf Vergegenwärtigung der Toten möglich ist.
Der massenmediale elektronische Unterhaltungszirkus hat immerhin das im canettischen Sinn gewünschte Resultat gezeitigt, die Zeit als Lebenszeit, als historische Zeit, als Weltzeit vollständig zerschlagen zu haben, weshalb niemand mehr an die Gegenwart der Toten glaubt und also auch nicht mehr an den Tod als einen Weg, über das Selbstopfer des Lebens Unsterblichkeit zu erlangen.
„Wer schreibt, der bleibt“, war einst die tröstliche Maxime der bürgerlichen Intellektuellen bei der Bewältigung ihrer eigenen Todesfurcht. „25 Jahre meins Lebens habe ich MASSE UND MACHT geopfert“, (9) schreibt Canetti. Eine Kaschierung des Selbstopfersyndroms aller omnipotenten Machtphantasten, in dieser Form aber kulturell rechtfertigbar? Das kann der Vorschlag nicht sein; denn
was wäre, wenn auch nur weitere zehn Prozent der Bevölkerung schreibend, malend, komponierend oder als Politiker, Wissenschaftler und Militärs überleben wollten? Wer sollte diese Werke memorieren und die Toten vergegenwärtigen? Vielleicht die Bewohner der Canettistraße, der Reaganallee, des Tellerwegs oder der Neckermanngasse, die eine semantische Polizei in monatlichen Besuchen abfragte, ob sie ihrer kulturellen Pflicht zur Vergegenwärtigung der toten Größen nachgekommen seien?
Auch wenn Canetti in den letzten Jahren seines literarischen Schaffens den Eindruck aufkommen ließ, er schreibe, um zu bleiben, liegt jenseits seiner Bedeutung als Literat das Zentrum seiner zukunftsweisenden Argumentation in MASSE UND MACHT bei dem Gedanken, daß gerade die fiktive Massenkultur (sie ist ja tatsächlich nur eine Fiktion)
eine andere Dauer zu verleihen vermag als die erzwungene Dauer der Tausendjährigkeit von Reichen und Werken: die Macht der Ohnmacht.
Wir bleiben in der Gattung bewahrt und auf Dauer gestellt insofern, als wir unsere prinzipielle Ohnmacht zu akzeptieren lernen. Die Ohnmacht als Kraft der kritischen, unbeherrschbaren Massen entdeckte Canetti. Aus ihr begründet sich alle Würde und aller Anspruch auf Humanität. Das Überleben, das Andauern der Menschheit als Gattung ist wichtiger als die Bewahrung der Erinnerungen an einzelne Menschen und Werke.
Ich will mich nicht damit beruhigen festzustellen, daß MASSE UND MACHT, mag es Canetti auch leugnen, mit Becketts Dialektik des Verstummens und Sartres existentialistischer Selbstbezichtigung der Macht mehr gemein hat, als wir bisher zu vermuten wagten: die Ketten der Selbstfesselung potentieller Täter im Zustand des Wartens und Verharrens, fast wie die Steine und Sterne. Warten, das ist die Dauer, der sich Canetti anvertraut. Eine gegen sich selbst erzwungene Dauer des Unterlassenen, des nicht zur Erscheinung Gezwungenen, des Verschwiegenen.
Die an ihre naturwüchsige Willkür gefesselte Masse erzwingt das Schweigen, den Zusammenbruch der programmatischen Erlösungstaten, die Ohnmacht der Handelnden vor der Wirklichkeit.
Wurden in den 80er Jahren nicht solche Positionen des Wartens sichtbar? Daß sich die Massenverkehrsteilnehmer bisher vornehmlich über das ihnen aufgezwungene Verharren in Warteschleifen nur geärgert haben, kann man nicht sagen. Die Reaktionen auf Vostells einbetonierte Cadillacs als Monument des „Ruhenden Verkehrs“, also des seiner eigenen Logik nach zum Stehen gebrachten Verkehrs, zeigen das; auch die Berliner, die sich über diesen Beitrag zum Skultpurenboulevard heftig erregten, leugneten nicht, daß dieses Denkmalnach-Denkmal ihre alltäglichen Erfahrungen als Verkehrsteilnehmer formuliere.
Es empörte sie aber die von Vostell nahegelegte Vermutung, dieses Warten und Verharren sei nicht mehr an die Erwartung einer Veränderung der Verkehrssituation, also einer prinzipiellen Besserung gebunden. Warten ohne Erwartung ist ein Ohnmachtserlebnis, das die Masse der Verkehrsteilnehmer nicht mehr an die Macht delegieren kann, da die vielen Verkehrsteilnehmer selber der Grund ihrer eigenen Ohnmacht sind. Selbst da, wo der Verkehr noch fließt, bewegt sich der zeitgenössische Reisende nicht fort. An jedem Reiseziel erwartet ihn die gleiche Situation.
Fortbewegung und Verharren sind identisch geworden im Warten ohne Erwartung. Die ehemals hilfreiche Ausgrenzung von Wartezimmern gegenüber Erfüllungsräumen von Erwartungen (den Behandlungsräumen, den Schlachtfeldern, in denen Zustände transformiert wurden) verliert ihren Sinn, wenn alle Zimmer zu Warteräumen werden und die Befindlichkeiten der Raumbewohner oder -nutzer durchweg denen der Patienten gleichen. Patienten sind Menschen, die sich ihrem Zustand gegenüber nicht anders als wartend verhalten können. Ihre Erwartung auf schließliche Genesung bleibt gegenüber der konkreten Forderung des Wartens abstrakt und ist auch nur noch bei relativ harmlosen Erkrankungen begründet. Die entscheidenden Krankheiten sind längst chronisch geworden, das heißt auf alle absehbare Zeit nicht veränderbar. Der Zeithorizont des chronisch Kranken ist auf das hoffnungtrübende Warten festgelegt, ohne daß die Zeit stillstünde. Dieses chronische Warten erzeugt eine andere Qualität von Dauer, als es die Zeitlosigkeit bleibender Werke vermag. Wer die Zeitgenossen beim Umgang mit solchen Werken beobachtet, fühlt sich an das Lektüreverhalten von Wartenden bei Ärzten und Frisören erinnert Man blättert das Daliegende durch, weil man ja zu warten hat. Das Lesen und Betrachten läßt das Warten zu einer aktiven Form des Verhaltens der Massen werden.
Und es kommt darauf an, das Warten nicht passiv erdulden zu müssen, sondern zu einer Form des Handelns zu erheben Unsere Bibliotheken und Museen, die Standorte der bleibenden Werke, sind Warteräume, in denen dies Warten als sinnvolles Handeln trainiert werden kann – sehr im Unterschied zu jenen Wartehallen, in denen Unterhaltungskünstler versprechen, die Zeit des Wartens totzuschlagen oder zumindest doch so attraktiv zu gestalten, daß dem Wartenden die Zeit nicht lang wird. Das Warten ohne die Erwartung der Maskierungen des Stillstands ruft als ihr produktivstes Resultat eine Ausweitung der Zeit, man möchte sagen eine Verlängerung der Zeit als Ewigkeit hervor. In den 80er Jahren wurde von den Wartenden in diesem Sinne „die Entdeckung der Langsamkeit“ (10) dankbar aufgegriffen. Robert Wilson, einer der Gestalter solcher Langsamkeit, fand Massenzuspruch bei all denen, die von der Coca-Cola-Pause als Zeitschnitt und Stillstellung enttäuscht waren und die durch die permanente Animation in den schönsten Wochen des Jahres nicht mehr zur Ruhe fanden. Gerne stimmten sie Neil Postman (11) zu, die Erinnerung an die Kindheit sei eine Erinnerung an das selbstvergessene Spiel, an das Gefühl endloser Fortdauer der Tage und Zeiten und der Wiederholung der gleichen Daseinsformen ohne die Angst, sie schon bald unter dem Druck der Ereignisse aufgeben zu müssen. Langsamkeit, Verharren, Warten, ein permanenter Transit in die Ewigkeit durch Stillstand und Stillstellung (klassische Therapiemaßnahmen) erzeugen, so meinte einer der produktivsten Kulturtheoretiker der 80er Jahre, andere Wahrnehmungs- und Kommunikationsformen. Dietmar Kamper (12) glaubte sogar, eine Verschiebung der Leitsinnhierarchien feststellen zu können: durch Zuhören kommuniziere man intensiver als durch jede andere Art von Wahrnehmungstätigkeit und Transformationshandeln. Abgesehen davon, daß die Medien das Angebot an Talk-Shows in den 80er Jahren enorm vergrößerten, weil sie die billigsten Produktionen sind, stießen sie wohl deshalb auf so große Resonanz, weil in ihnen der Leitsinn „Zuhören“ als Leistung der Teilnehmer besonders zur Geltung kommt. Dieser Typus einer Masse wurde von Canetti noch als Publikum analysiert. Die Medienwelt definiert Publikum aber nicht mehr im Unterschied zu den Akteuren; auf sie träfen eher Canettis Analysen der Festmassen zu, wobei sich allerdings die Feste der Erwartung doch erheblich von der Feier des Wartens unterscheiden.
Die jüdische Kultur ist eine Kultur des Wartens, das auf keine Weise die Erfüllung der Erwartung als Ankunft des Messias behaupten oder versprechen darf. Was hört der Zuhörende? Er hört sich selbst als Fremden und Anderen, dessen Aussagen er auf eine Weise zu kritisieren vermag, die er seinen eigenen Äußerungen gegenüber nicht vorzutragen wagte, weil der Beweis der Unzulänglichkeit und Haltlosigkeit der eigenen Überzeugungen schwer zu ertragen ist.
Im Zuhören wird die Kraft des Wartenkönnens allen erfahrbar, die mit sich nicht zurechtkommen und die auf Abhilfe sinnen, die nur möglich wäre, wenn die Wartenden nicht mehr sie selbst bleiben. Darauf verweist die in jeder Talk-Show mehrfach flehentlich oder herrisch, kumpelhaft oder auf Regularien pochend vorgetragene Bitte „Lassen Sie mich doch endlich mal ausreden“, was doch überhaupt keinen Sinn macht, da jeder weiß, wie endlos lange er noch reden könnte, ohne je ausgeredet zu haben. Das Zuhören ist ein Warten, für das ein Ende ebensowenig gefunden werden kann, aber es ist im Unterschied zum Ausredenwollen nicht darauf angewiesen, verstanden zu werden. Das zuhörende Warten vermag auch die unverständlichste und verschlüsseltste Mitteilung als sinnvoll zu erfahren, weil es die Zeit und die Erwartung des Wandels in ihr gerade dadurch zu transzendieren vermag, indem es mit dem Unverständlichen, dem Nicht-Erklärbaren, dem nie identisch Faßbaren von vornherein rechnet. Das zuhörende Warten äußert sich vor allem als Schweigen, das allerdings nie kommunikationsstrategisch eingesetzt werden darf; dann würde es zu wissendem Schweigen, dem peinlichsten Verhalten von Talk-Show-Beteiligten. Solche Überlegenheit wäre bloß wieder eine Machtgeste, der sich das zuhörende Warten gerade zu enthalten versucht.
Schon die 70er Jahre hatten durch die Ausdehnung von Theaterabenden auf mehrere Stunden das Rezeptionsverhalten der Zuschauer verändern wollen. In den 80er Jahren überbot man die Aufführungsdauer um das Doppelte. Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Heiner Müller, Peter Stein führten ihre Zuschauer allerdings insofern in die Irre, als sie mit ihrer Zeitstrukturierung die Zeit zu erfüllen versprachen. Jeder mußte annehmen, daß diese unglaublich langen und aufwendigen Inszenierungen irgendwo anders hinführen sollten als zur endlosen Dehnung und Wiederholung der theatralischen Mittel, die schon in der ersten halben Stunde vollständig ausgeschöpft waren. Das Publikum erlebte die Dauer des endlosen Wartens nur als andauernde erschöpfte Leere.
Wir werden in den 90er Jahren hinreichend Gelegenheit haben, das erwartungslose Warten zu trainieren.
Mit diesem Warten wird auch endlich für die Massen das zum Ereignis, was nicht geschieht Wir dürfen längst nicht alles tun, was wir können, echot es aus allen Zukunftsbekenntnissen. Soll nun denn doch das Unterlassen als Form des Handelns zumindest aufgewertet werden? Abwarten und Tee trinken!
Mit diesen Hinweisen werden natürlich nur kulturelle Phänomene in Erinnerung gerufen. Es sind aber genau die Phänomene, mit denen Macht in Zukunft zu rechnen hat, und an denen sie scheitern muß. Daß zum Beispiel Armeen wie die Bundeswehr der Dauer als Zustand des Wartens nicht gewachsen sind, zeigen die vielen Berichte über den Unwillen der Soldaten, den Dienstbetrieb als permanentes Herumgammeln ertragen zu müssen. Die psychologische Belastung des andauernden Wartens ist für die Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Armee bedrohlich. Diese angeblich so mächtigen Organisationen vermögen nicht einmal mehr sich selbst aufzurechtzuerhalten, geschweige denn auch nur die simpelsten Leistungen zu erbringen. So waren die zivilen Hilfsdienste gezwungen, das „schwere Gerät“ selber ins erdbebenerschütterte Armenien zu bringen und zu betätigen, weil die Rote Armee sich dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen zeigte. Von der US-Armee wäre kaum mehr zu erwarten, so sehr sich auch Reagan und Bush bemühten, mit der Invasion von Grenada und Panama das Gegenteil zu beweisen. Was die Militärs da noch zustande brachten, geht kaum über das hinaus, was eine gut geführte städtische Feuerwehr jederzeit zu erreichen vermag – von den Eroberungsfeldzügen fremder Märkte durch findige Unternehmer ganz zu schweigen.
Canettis Schlußfolgerung lautet: Mit der Abschaffung des Todes als Form der Machttranszendierung brechen alle Programmatiken zusammen, die Macht als Instrument von deren Verwirklichung rechtfertigen.
Es besteht nicht der geringste Zweifel, daß diese Programmatiken als Kampf des Guten gegen das Böse, des Westens gegen den Osten, des Kapitalismus gegen den Kommunismus, der Gläubigen gegen die Ungläubigen zusammengebrochen sind. Das Wiederaufleben des Fundamentalismus (13) aller Schattierungen ist nur ein fürchterlicher Reflex auf diese Tatsache; er wird sich nur so lange als Terror abstrakter Errettungsideen behaupten können, wie er Tod und Selbstopfer als Beweise der Macht auszugeben vermag. Das wird möglicherweise noch lange dauern, muß aber dennoch prinzipiell erfolglos bleiben, weil die so demonstrierte Macht sich am Ende gerade durch ihren Erfolg selber liquidieren wird. Umso bedauerlicher sind die sinnlosen Opfer, denen nicht vergönnt war, wartend den Beweisgang der Geschichte durchzustehen. So perfide es klingen mag, Kanzler Kohl war der erste Politiker der 80er Jahre, der das wartende Verharren als Form des politischen Handelns zum Thema erhob: „Wir sitzen die Probleme aus.“ Das war die Maxime der 80er Jahre schlechthin. Sie wäre erst als ein Handeln legitimiert, wenn sie sich gegen die Erwartung richtete, wir könnten mit der Verwirklichung bestens ausgedachter Pläne ans Ziel unserer Wünsche gelangen. Uneinsichtiger als die Aussitzer waren in den 80er Jahren die scheinbar so positiv denkenden Männer der Tat, die alle Probleme durch das fröhliche Anpacken zu lösen versprachen. Ihnen gegenüber erscheinen sogar die betenden und meditierenden Selbsterfahrungsgurus geradezu als aufgeklärte Geister.
• (7) Elias Canetti: Das Augenspiel – Lebensgeschichte 1931 – 1937, München 1965.
• (8) Elias Canetti: Masse und Macht, Hamburg 1977.
• (9) Edgar Piel: Canetti, München 1984.
• (10) Stefan Brecht: The Theatre of Visions – Robert Wilson, Ffm 1978.
• (11) Neil Postman: Das Verschwinden der Kindheit, Ffm 1983.
• (12) Dietmar Kamper: Hieroglyphen der Zeit, München 1988 u. ders. (Hg.): Das Schwinden der Sinne, Ffm 1988.
• (13) Th. Meyer: Fundamentalismus – Aufstand gegen die Moderne, Reinbek/Hg., 1989. Th. Meyer: Fundamentalismus in der Welt, Ffm 1989.