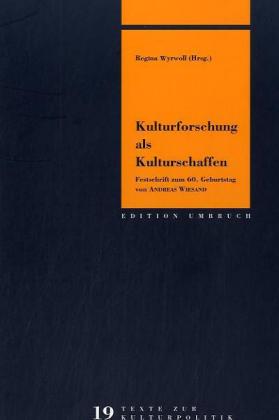Kulturforschung als Kulturschaffen.
Als durch die 90er Jahre Chefredakteur Markwort sein „Fakten, Fakten, Fakten!“ schallen ließ, erschien das manchem wie ein Echo der frühen 70er Jahre. Damals traten Forbeck/Wiesand vor allem den Kommunalpolitikern, die mit der Meinung hausieren gingen, daß sich nur sehr wenige Bürger für Opern, Theater, Bibliotheken, Archive und die Museen interessierten, mit der Frage entgegen: „Kennen sie überhaupt die Fakten?“ In der Tat konnte die Fakten niemand kennen, bevor sie nicht von Forbeck/Wiesand erarbeitet wurden. Wer es nicht miterlebte, kann kaum einschätzen, was es damals bedeutete, daß laut Wiesand/Forbeck mehr Bundesbürger in die Museen Deutschlands strömten als auf alle Sportfelder der Republik. Insbesondere will man kaum glauben, daß gerade die studentischen Kulturrevolutionäre Wasser auf die Mühlen der reaktionären Kommunenmauschler gossen, indem sie im Namen der Volksaufklärung verlangten, die genannten bürgerlichen Kulturinstitutionen zu schleifen. Forbeck/Wiesand fühlten sich von derartigen Killerphrasen geradezu herausgefordert, erst einmal klarzustellen, wie der Stellenwert kultureller und auch künstlerischer Arbeit nach jenen Kriterien zu markieren sei, die für besagte Politiker unzweifelhaft erstrangig zu sein hatten – nämlich den ökonomischen und den sozialen. Indem Forbeck/Wiesand mit ihren legendären Umwegsrentabilitätsberechnungen von Nutzungen kultureller Einrichtungen und durch erste Hinweise auf die volkswirtschaftliche Dimension des Kulturschaffens das ökonomistische Totschlagsargument, Kultur zahle sich nicht aus, widerlegten, wurde ihr Institut selber zu einer einflussreichen Größe des Kulturschaffens in Deutschland. Keine Rekonstruktion der damaligen, wahrhaft historischen Auseinandersetzung könnte von den Leistungen des Instituts für Kulturforschung Forbeck/Wiesand absehen: von ihrer ersten Darstellung der Kultur als Standortfaktor über die Richtigstellung der Kampfformel Kultur für alle als Kultur durch alle bis zur Darstellung von Politik und Wirtschaft als Kulturformen, gehörten sie zu den Pionieren der Selbstaufklärer, welche sich auch selbst in jene Urteil einbeziehen, die sie über andere fällen. Nur einmal hat sich, wie ich mich erinnere, dieses Vorgehen gegen Andreas Wiesands Urteilsvermögen gewandt. Da ihm in seiner Milde die Radikalisierung kultureller Positionen zu Kulturkämpfen völlig außerhalb seiner Erwartungen zu liegen schienen, reagierte er auf meine dauernden Vorhaltungen in den Endsiebziger Jahren, die Immigrationsfragen würden sich zum gewaltigsten innenpolitischen Problem, ja zu zerstörerischen Kulturkämpfen nach fatalem historischen Muster entwickeln, abwehrend. Im übrigen fand ich nur bei Wehner und Strauß unter den Bonner Köpfen für meine Polemik gegen den Multikulturalismus Aufmerksamkeit. Alle anderen, die wir zumeist beim Kunstsammler und Klinikchef Ott in Godesberg trafen, amüsierten sich bestenfalls über derartige Prophetien. Nichtsdestoweniger förderten Wiesand/Forbeck schon bald mein Vorhaben, mit einem Action Teaching in den Bonner Kammerspielen die Kulturkampffundamentalisten deutscher Provenienz wie Botho Strauß, Bohrer, Handke, Syberberg als Gottsucherbande darzustellen; Wiesand/Forbeck ermöglichten sogar eine Videodokumentation dieses Ereignisses durch Regina Wyrwoll, die unter dem Titel Wir wollen Gott und damit basta 1985 bei DuMont erschien.
Aber auch in dieser partiellen Blindheit für die Wirklichkeit jenseits persönlicher Erfahrungen und Erwartungen bewährte sich Wiesands Haltung; „Da habe ich mich grundlegend geirrt“, gab er Jahre später zu bedenken, weil dieses Eingeständnis impliziert, sich möglicherweise in anderer Hinsicht gegenwärtig auch zu irren, wenn man nicht polemosophisch in der Haltung und dialektisch in der Sache, also in summa strategisch, mit den eigenen Fehlurteilen zu rechnen bereit ist. Das nun zeichnet unsere beiden Kulturheroen Karla Forbeck und Andreas Wiesand weit vor allen Konkurrenten im Metier aus. Sie rechneten nicht nur als privat finanziertes Forschungsinstitut ständig in genereller Hinsicht mit dem Scheitern, angesichts der Billigkonkurrenz aus den Universitäten, und teilten somit das wirtschaftliche Schicksal der Kulturschaffenden, die Gegenstand ihrer Untersuchung waren; vielmehr konnten sie sich in Funktionen des Kulturschaffens bestätigt sehen, die sich seit den 1960er Jahren in den Bewegungen Kunst als soziale Strategie, Kunst als Investigation, Konzeptkunst, Action Teaching und Theorietheater, Bringing the war home – der nach Hause gekehrte Anpthropologe entfaltet hatten. Im Kern hieß das, daß die Künstler begannen, sich der wissenschaftlichen Feldforschung zu bedienen und die Wissenschaftler sich die performativen Praktiken der Künstler anzueignen. Das gemeine Verhältnis von Theorie und Praxis kehrte sich gründlich um; jede Praxis enthielt implizit, also unausgesprochen, enormes theoretisches Wissen und in jedem Theoretisieren als Darstellung explizitem Wissen wurde soviel praktisches Vermögen, etwa zur Kommunikation in performativen Akten erforderlich, wie das bis dato nur den darstellenden Künsten selbstverständlich war.
„Kultur ist ein Beziehungsgeflecht zwischen Menschen, zur Begründung von Verbindlichkeit in eben diesen Beziehungen“ – das hatte ich als Gesprächstenor für ein Treffen mit Frau Dr. Karla Forbeck telefonisch vorgegeben, als ich 1975 zum ersten Mal in der Hamburger Isestraße mich dem Sachverhalt Kulturforschung konfrontieren wollte. „Was kann verbindlicher sein, als Zahlen und harte Fakten“, meinte Andreas Wiesand, als er mit ironisch-stoischem Lächeln sein Gesicht zwischen die Schiebetüren schob, um Karlas Gast zu beäugen. Es war hochsommerlich hell in dem Besucherzimmer, obwohl vor den Fenstern voluminöse Baumkronen wogten. Es blieb immer hell, wenn Andreas anwesend war – die Arbeitsstimmung heiter, munter, leicht, aber der Ton eben verbindlich und moderat, auf Ausgleich bedacht, vermittelnd zwischen den Extremen, die zumeist durch Karla und mich ins Spiel gebracht wurden. Sollte es in diesem Feld auch weise Moderatoren und nicht nur törichte geben, so wäre Wiesand weise zu nennen. Ich hingegen betätigte mich in der Rolle des Radikators, der darauf abzielt, Positionen durch möglichst klare Entgegensetzungen zu bestimmen. Aber ein Radikator ist kein Extremist, wenn er den unterschiedlichsten Argumentationen bis in ihre affirmative Übertreibung, bis ins Extrem, folgt. Denn das schließt keineswegs sinnvolle Konsequenzen aus, weil vernünftige Einigungen nur solche sind, bei denen die entgegengesetzten Standpunkte gerade durch den Bezug auf die widersprechenden erhalten bleiben. Diese Art von Radikalismus war für mich zwar auch eine Frage des Temperaments, dennoch vertrat ich ihn als Tugend der Sophisten, die den polemischen Streit (und nicht wie fälschlich übersetzt den Krieg) zum Vater aller Entwicklungen des Verstandes und der sozialen Vernunft ausgerufen hatten. Ich war Polemosoph – Karla und Andreas begegneten mir als Philosophen, d.h. eigentlich als filosoff, also als strikt auf die Bewältigung der Lebenspraxis ausgerichtete Aufklärer unseres 18. Jahrhunderts.
Merkwürdig oder nicht: ich sah das Institut für Kulturforschung stets als noch gegenwärtig tätige Agentur der Enzyklopädie, mit der Diderot und die seinen ausdrücklich durch Wissenspraxis das praktische Wissen zu begründen versuchten, mit dem sich vernünftige und erfahrunsgesättigte Politik machen ließe, also ein Gemeinwesen im Interesse seiner Individuen führen ließe. Das Institut erschien mir als Inbegriff einer Zivilisationsagentur, deren Arbeit nach innen und außen in Zeiten permanenter Kulturkämpfe und pathetischer Gewaltlegitimation aus dem Opferstatus dringend gebraucht würde, zumal das bundesrepublikanische Behagen als weltoffen geradezu die Gewißheit erzwang, daß dieses Behagen in der Selbstwahrnehmung als durchgesetzte Liberalität in schier grenzenloser Toleranz schnell als ein säuisches Behagen sich äußern würde. Was den Humanisten noch als furchtbares Schicksal erschien, sich kulturell verhexen lassen zu müssen wie Odysseus Gefährten durch die bösartige Circe, galt den Bundesrepublikanern offenbar als ein Glück, endlich politisch gefördert, ökonomisch ermöglicht und sozial prämiert, die Sau rauslassen zu dürfen und aus diesem ewigen Ausnahmezustand der Feriensauereien niemals zurückkehren zu müssen. Andreas hatte diese deutsche Realitätsverleugnung als Organisator von Augsteins Wahlkampf kennengelernt und im Umgang mit den politischen Größen einen ziemlich realistischen Blick für die ganz unschöpferische Zerstörungskraft von illusionärer Einfaltspinselei bzw. Machtwahn gewonnen; Karla war in der Abwehr von Machtattitüden sich selbst als human-liberal und weltoffen beweihräuchernder Professoren geschult, seit sie bei Habermas über das Geschichtsbewußtsein schriftloser Kulturen promoviert hatte. Beide kannten die Musik der Kulturtambourmajore, seit Raddatz mit ihren Flötentönen den Einmarsch in die höchst bezahlten Positionen von Kulturrepräsentanz, genannt Kultur II, inszenieren wollte. Als ich Andreas traf, bewährte sich seine Erfahrung soeben glanzvoll, weil er ausgerechnet bei einem linken Wagnerianer zu promovieren vorhatte. Und Karla führte mir im bayreuthnahen Vaterhaus vor, wie man mit bodenloser Ambiguität und bitteren Ambivalenzen der Zeichen Wunder der Klarheit vollbringt.
Was machte die beiden, im Vergleich zu mir so unerschütterlichen Arbeiter in den Augiasställen der Politik derart immun gegen das Eingeständnis letztlicher Folgenlosigkeit des eigenen Tuns? Die Antwort scheint mir, gestützt auf immerhin 7 Jahre zeitlicher, sachlicher und sozialer Nähe zu Forbeck/Wiesand, einigermaßen klar. Sie erhoben sich weit über die Faktenhuber und Erbsenzähler des Metiers in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, zu den Gegebenheiten im Sozialen, Politischen und Kulturellen auch das Kontrafaktische zu rechnen. Dabei stützen sie sich auf das 1927 bündig formulierte Grundgesetzt der Sozialpsychologie: What people belief to be real is real in its consequences.; auf gut Deutsch heißt das: was immer Menschen in ihrer ideologischen Verblendung, in Wahnphantasmen, Wunderglauben, Irrationalität und Weltverleugnung für wahr halten, gewinnt durch die Konsequenzen dieses Glaubens im Lebensalltag unleugbare Realität. Man kann einem Menschen, der die ihn verfolgenden Geister durch Vernagelung der Türen und Fenster seines Hauses auszusperren hofft, zwar entgegenrufen, seine Furcht sei ganz unbegründet, weil es keine Gespenster gäbe; nichtsdestoweniger sind die vernagelten Fenster und Türen eine Realität wie das Haus und sein panikgeschüttelter Bewohner. Für die Beurteilung dieser Situation und der zu erwartenden Konsequenzen nützt es nichts, Ideologiekritik zu betreiben sondern nur, mit der Macht des Kontrafaktischen rechnen zu lernen. Das ist alles andere als evident. Zwar ist die normative Kraft des Faktischen seit Kaiserszeiten sprichwörtlich geworden, zumal gerade Juristen sich dieser Begründung von Geltung bedienten. Aber was heiß das angesichts der alltäglichen wie historischen Erfahrung, daß das Kontrafaktische sich mindestens genauso mächtig zur Geltung bringt, wie das Faktische? Mit Wilhelm II. schien in Deutschland jeglicher Geltungsanspruch aus der Normativität des Kontrafaktischen geradewegs zum Inbegriff hingabebereiter Idealität, der Deutschen Innerlichkeit, geworden zu sein. Kann man auch die Auffassung vertreten, daß die Evolution kulturelle Todesbereitschaft aus welchem wahnhaften Glauben auch immer als Fitnessvorteil prämiert, so hat das Normativwerden ihrer Wahnhaftigkeiten den Deutschen jedenfalls nicht zum Vorteil gereicht. Ihr Wunschdenken, ihre Ideologien und Allmachtsphantasien und vor allem ihre Begriffsgläubigkeit wirkten umso stärker, als zivilisierte Gemeinschaften, etwa aus Frankreich, den Irrsinn zu widerlegen versuchten. Das Kontrafaktische ist ja gerade gegen Widerlegungen immun, wenn es den besseren Einsichten triumphal entgegenbrüllt „Jetzt erst recht!“ Die Logik des Kontrafakts schließt beide Seiten in der Erkenntnis zusammen: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. In den wilden Zeiten der Studentenbewegung ließen sich gerade ältere Herrschaften von talking heads über die traurige Realität ihres eigenen unproduktiven Daseins hinwegphantasieren, die schlichtweg die Verwirklichung des Sozialismus, Humanismus und Kommunismus mit dieser Logik des Kontrafaktischen in unerschütterlich wiederholten Satz begründeten, wer nicht an Wunder glaube, sei kein Realist. Obwohl diese Logik des Kontrafaktischen offensichtlich Berliner Dialekt als ein Authentizitätsmerkmal der Dialektik vorgab, überzeugte die Repräsentanten deutscher Idealität das Diktum, demzufolge es umso schlimmer für die soziale Wirklichkeit werde, je weniger sie mit den Ideen in Übereinstimmung zu bringen sei.
Ich entsinne mich noch sehr gut, welches Gefühl der Unterlegenheit mich beschlich, wenn Andreas angesichts solcher Exzesse der Logik des Wahnsinns mit besagter stoischer Ironie sich geradezu bestätigt sah, während ich meinen Affekten auch gegen meinen Willen Lauf geben mußte. „Dein Beharren auf noch so guten Argumenten ist für die Kommunikation unerheblich oder vielmehr kontraproduktiv“, hielt mir der Jüngere väterlich-souverän entgegen. Daß er recht hatte, erfuhr ich immer prompt: die Leutchen reagierten aufgebracht gegen meine Intervention und aus voller Überzeugung ihm zustimmend, selbst wenn er wortwörtlich dasselbe wie ich vortrug. Dann führte er mich an die Grenzen der Selbstrechtfertigung durch Verstehen mit der unnachahmlich heiteren Erkärung: „Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht das gleiche.“ Bis heute habe ich keine tragfähigere Darstellung der Macht des Kontrafaktischen entgegengehalten bekommen und ich lernte bei Andreas, das nicht mehr verstehen zu wollen, sondern nur noch, meinen Zielen entsprechend, zu kommunizieren.
Darin schließlich manifestiert sich die Strategie der Evolution menschlicher Kulturen auch und gerade durch und mit der Entwicklung von Künsten und Wissenschaften, daß man der Kommunikation mehr zutrauen darf als dem Verstehen, also dem Schaffen größere Evidenz zuspricht als der Evidenzkritik durch Wissenschaft. Wer sich aber nicht bloß als reaktives Bündel solcher evolutionärer Kräfte akzeptieren kann, scheint nach dem Muster der Künstler, Evidenz gerade durch Evidenzkritik erzeugen zu sollen und nach dem Muster der Wissenschaftler, Nichtverstehen verständnisvoll kommunizieren zu müssen. Andreas Wiesand demonstriert bis auf den heutigen Tag selbstsicher den Glauben, die beiden Haltungen tatsächlich in personam vertreten zu können. Er ist einer der wenigen Menschen, durch die ich mich vertreten sehen könnte.