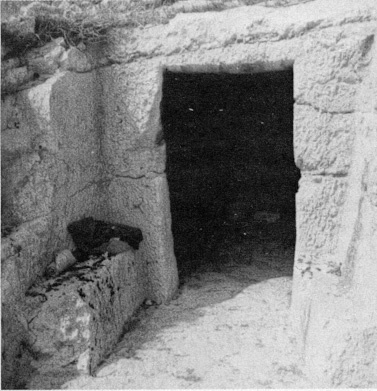Aufsatz für den Katalog 'Kindertagesstätten' des Internationalen Design-Zentrums, Berlin, 1976, hrsg. von Linde BURKHARDT (mit der Widmung 'Zur Erinnerung an Fritz GIESELMANN, den Lehrer').
2.1 Theoretisch versus sinnlich?
Nicht wenige Versuche, gegenwärtig über die Verbesserung der speziellen und allgemeinen, der schulischen wie der beruflichen Lernsituation oder die Verbesserung privater wie gesellschaftlicher Kommunikation und Interaktion nachzudenken, führen zum Postulat von mehr Sinnlichkeit. In manchen Formulierungen wird der Begriff der sinnlichen Qualität umstandslos mit dem von Kreativität schlechthin gleichgesetzt. Man glaubt damit, der Kritik an der Theoretisiererei gerecht werden zu können, die angeblich in den vergangenen Jahren derart überhand genommen habe, daß man sich nur noch in das vermeintliche Extrem und Gegengewicht zur theoretischen Reflexion, nämlich die sinnliche Wahrnehmung retten zu können glaubt. Dem oppositionellen Begriffspaar von Theoretisiererei und sinnlicher Direktheit werden gleichsinnig die Begriffspaare Kalkül und Spontaneität oder Vermitteltheit und Unmittelbarkeit sowie Verstand und Gefühl zugeordnet.
An dieser Konstellation, die gegenwärtig wieder einmal als eine deutsche Spezialität sichtbar wird, sind alle in sie eingehenden Annahmen falsch, ja widersprechen den damit verbundenen Absichten diametral. Zum einen war das zitierte Überhandnehmen der Theorie eben nur eine Theoretisiererei und keine Theoriebildung, so daß von einem Primat der Theorie in den vergangenen Jahren gar keine Rede sein kann. Zudem sind Kreativität und Unmittelbarkeit auch für die Anstrengung des Begriffs, also auch die Theoriebildung höchst schätzenswerte, ja notwendige Tugenden. Umgekehrt ist die unmittelbare, spontane, kreative Sinnlichkeit selber nur theoretische Leerformel, da Sinnlichkeit schlieißlich als höchst komplexe Fähigkeit erst erworben werden muß, eine keineswegs natürliche Eigenschaft darstellt und also das ganze Gegenteil von spontan ist.
Im übrigen haben alle Aussagen über sinnliche Wahrnehmung, wenn sie gelungen, also gut begründbar sind, wiederum den Status von theoretischen Aussagen. Ohne Begriffsbildung und Begründung ließe sich wenig über das spontane, gefühlsmäßige, sinnliche Wahrnehmen ausmachen. Die Opposition von theoretisch und praktisch ist genauso gegenstandslos wie die Opposition von theoretisch und sinnlich. Was mit dieser Opposition sinnvollerweise ausgedrückt werden kann, aber nicht ausgedrückt wird, ist die Tatsache, daß es ausgesprochene und unausgesprochene Begründungen gibt. So würde man das Handeln und Verhalten aus praktischer Erfahrung eben nicht als ein theorieloses, also begründungsloses verstehen können, sondern nur annehmen dürfen, daß die in der Erfahrung in Anspruch genommenen Begründungen nicht ständig zum ausdrücklichen Thema erhoben werden, wie das für alles theoretische Arbeiten gilt. Die Unterscheidung kann also nicht in der Entgegensetzung von Theorie und Praxis, von Vermitteltheit und Unvermitteltheit, von Verstandesoperation und sinnlicher Wahrnehmung liegen, sondern nur in der Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Gebrauch von Begründungen. Ohnehin werden Begründungen nicht schon deshalb akzeptabel, weil sie theoretisch explizit gemacht werden, und umgekehrt sind Begründungen nicht deswegen schon abzulehnen, weil auf sie nur in der Erfahrung Bezug genommen wird.
Wer also gegenwärtig in schätzenswerter Absicht die Bedeutsamkeit der sinnlichen Wahrnehmung für die Orientierung der Menschen in der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt nachdrücklich vertreten will, brauchte sich damit nicht als theoriefeindlich zu gebärden. Denn diese Bemühungen werden nur dann einen gewissen Erfolg zeitigen, wenn es gelingt, die in der Rede von der sinnlichen Wahrnehmung schon vorausgesetzten Begründungen ausdrücklich zum Thema zu machen und damit zu zeigen, daß die sinnliche Wahrnehmung erst voll entfaltet werden kann, wenn die Individuen in der Lage sind, die entsprechenden Begründungen in Anspruch zu nehmen und damit gegen die konkurrierenden Ansprüche anderer Begründungen zu behaupten. Denn wenn heute jemand versuchte, nur mit den ihm 'von Natur aus' mitgegebenen sinnlichen Fähigkeiten zu agieren, wäre er schnell als zu einfältiger Trottel aus allen Lebensbereichen ausgesperrt. Selbst eine relativ harmlose Liebesaffaire, die nach dem Volksmund in erster Linie sinnliche Unmittelbarkeit im Fühlen und Wahrnehmen provoziert, macht den so Verliebten in eben demselben Volksmund zum Narren.
Wer sich heute wie zu allen Zeiten nur mit offenen Sinnen und spontaner Wahrnehmung vor ein Kunstwerk, eine Architektur oder ein Stück Landschaft setzt, macht die Erfahrung, daß ihm außer der beständigen Wiederholung des Satzes "das ist ja wunderschön" kaum eine Antwort auf diese angeblich so mächtigen Impulse verbleibt. Andererseits dürften ja wohl auch die Künstler, Architekten und Landschaftsbauer zu eben ihren Leistungen gerade nicht gekommen sein, indem sie bei sich nur unmittelbar spontane Sinnlichkeit in Gang setzten. Es ist durch nichts begründbar, warum die Herstellung solcher Kunstprodukte als Arbeitsresultate prinzipiell anders verlaufen sollte als deren sinnvolle Aneignung.
Die eben geäußerte Kritik als zutreffend vorausgesetzt, könnte man denen, die mehr Sinnlichkeit und weniger Theorie postulieren, immerhin zugestehen, daß sie Sinnlichkeit und Begrifflichkeit nur in ein rechtes Verhältnis zueinander bringen wollten. Aber gerade diese Absicht läßt sich mit den gegenwärtig begründbaren Aussagen über die prinzipielle Einheit von Anschauung und Begriff, von Sinnlichkeit und Erkenntnis, Gefühl und Verstand, Natürlichkeit und Kultürlichkeit, von Herzensbildung und Geistesbildung nicht vereinbaren.
2.2 Erkenntnis in sinnlicher Wahrnehmung
Die mir erteilte Aufgabenstellung, nach der "Bedeutung der Sinnlichkeit für den Menschen" zu fragen, ist nur eine der vielen Fragen ums Ganze. Denn nichts bestimmt einen lebendigen Organismus weitergehend als dessen Sinnlichkeit, d.h. dessen Fähigkeit, einen Außen- wie auch Selbstbezug herzustellen. Die instrumentelle Ausrüstung jedes Organismus, solchen Außen- wie Selbstbezug herzustellen, sind die Sinnesorgane.
Die Entwicklung der einzelnen Organismen kann man als eine evolutionäre Entfaltung jener Fähigkeit bezeichnen, in immer differenzierterer Form Außen- und Selbstbezug aufzubauen, was vor allem heißt, sich der sinnlichen Wahrnehmung anderer Organismen immer spezifischer und immer auffallender anzubieten. Von dem Herausbilden immer farbigerer Erscheinungen von Körperoberflächen bzw. der olfaktorischen und akustischen Signaldifferenzierung hängt die Integration der Organismen in ihre Lebensgemeinschaften sowie die eigene Fähigkeit zur selektiven Zuwendung auf die Umwelt ab. Diese Fähigkeit zur Unterscheidung läßt sich als Fähigkeit zur Erkenntnis definieren, so daß sinnvollerweise von sinnlich gebundener Erkenntnis gesprochen werden kann, ja gesprochen werden muß, wann immer von Erkenntnis gesprochen wird.
Die in der europäischen Geistesgeschichte überlieferte Unterscheidung zwischen Sinnlichkeit und Erkenntnis wurde nur allzu umstandslos als eine Unterscheidung zwischen passiv-rezeptiver Verarbeitung von sinnlicher Wahrnehmung einerseits und aktiv-reflexiver, verstandesmäßiger Bearbeitung von Bewußtseinsdaten andererseits verstanden; ja, man glaubte, die Lebensäußerungen eines Organismus vollständig daraus bestimmen zu können, daß der Organismus auf Außenreize reagiere. Immerhin hat sich diese Reiz-Reaktionstheorie nicht ohne Widerspruch durchsetzen können. Da man aber der Physiologie in dieser Frage die höchste Aussagenautorität zuerkannte, blieb es letztlich bei der Reiz-Reaktions-Theorie bis zu der epochemachenden Entdeckung von Erich von HOLST in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts. HOLST gelang der Nachweis, daß das Zentralnervensystem selber Impulse produziert, die ohne zu- oder ableitende Nerven als Energiequelle für die spezifische Bereitschaft des Organismus zum Handeln, d.h. zu Lebensäußerungen fungieren.
Die Reflexe des Organisums als Antwort auf von außen kommende Reize, sind also nur eine, und zwar zweitrangige Leistung. Die erstrangige Leistung des Zentralnervensystems als Impulsgeber für artspezifische Handlungsbereitschaft hat zur Klärung des klassischen Konflikts zwischen der Auffassung einer mechanistischen Einbindung des Organismus in die Umwelt im Reiz-Reaktions-Spiel und der vitalistischen Auffassung von dem nicht-kausal erklärbaren Funktionieren des organismischen Außenbezugs geführt. Das Zentralnervensystem des Organismus produziert artspezifische Handlungsbereitschaft, die sich als ein unbestimmtes, suchendes Erwarten des Organismus ausdrückt; die suchende Erwartung gilt solchen Reizfigurationen der Umwelt, die auf die unbestimmte Handlungsbereitschaft als Auslöser zum bestimmten Handeln wirken. Das unbestimmt suchende Erwarten wird als Appetenzverhalten (in der Verhaltensforschung) oder als Aufmerksamkeitszuwendung (in der Lebensphilosophie) bezeichnet. Appetenz und Auslöserreize müssen also zusammengesehen werden, d.h. aktive Zuwendung zur Außenwelt und passive Aufnahme der Außenwelt stellen eine Einheit dar. Diese Einheit definiert sowohl instinkt- wie kulturell gesteuertes Verhalten, d.h. instinkt- wie kulturell gesteuerte Selektionsfähigkeit. Lernen wird so definierbar als Erwerb von Unterscheidungsfähigkeit zwischen den in der natürlichen und sozial-kulturellen Umwelt angebotenen Wahrnehmungs- und Handlungsmustern.
Unter dieser Voraussetzung läßt sich für die Gestaltung der sozialen und natürlichen Umwelt von Menschen folgende Aussage treffen: Eine soziale wie natürliche Umwelt wird dann als Lebensraum akzeptiert, wenn diese Umwelt Gestaltfigurationen in hinreichender Anzahl und Vielfalt so anbietet, daß diese Gestaltfigurationen als Auslöser für konkrete zielgerichtete Handlungen und Verhaltensweisen von Menschen dienen können. Auch im kulturellen Raum gilt (wie für die natürliche Lebensumgebung von Tieren), daß nur bestimmte Gestaltmuster solche Auslöserfunktionen übernehmen können. Welche Gestaltfigurationen das sind, hängt davon ab, wie durch den einzelnen Menschen einzelne Umweltsegmente mit Vorstellungen und Gefühlen besetzt werden konnten.
2.3 Toposbildung - der Zwang zur Vergegenständlichung
Die Einheit von Umweltsegment und Vorstellung bzw. Gefühl läßt sich im Begriff des Topos fassen. Bei der Ausbildung der Lebensfähigkeit eines Menschen kommt es entscheidend auf solche Topoi-Bildung an. Das ist von der Pädagogik immer schon gesehen worden, am nachdrücklichsten beispielsweise in der pädagogischen Verwendung der Märchen, die nichts anderes sind als Topoi-Reihungen. So werden der Hohlweg wie der Forst, die Hütte wie der Palast als Gestaltpattern durch Anbindung von Vorstellungen bzw. Gefühlswertigkeiten zu Topoi verdichtet. Das bloße Zitieren eines solchen Topos vermag dann bereits die latente Erwartungshaltung und Handlungsbereitschaft in konkretes Handeln zu überführen, zu dem auch schon der in der Phantasie antizipierte Handlungsablauf rechnet und der sich beim Kind konkret vor allem im Spiel äußert. Eine Lebensumgebung als die seine anzuerkennen, wird also dann möglich, wenn in ihr solche Topoi wiedererkannt werden können, durch die dann eigene Vorstellungen, Gefühle, Erwartungen aktiviert werden.
Die Verhaltensforschung hat für die Tiere, die Gestaltpsychologie für den Menschen den Nachweis erbracht, daß die natürlich wie kulturell eintrainierte Topoi-Bildung auch dann ihren Sinn erfüllt, wenn die in die Topoi eingehenden Gestaltpattern nicht immer die gleiche Dichte aufweisen. Es kann sogar angenommen werden, daß die Auslöserfunktion dieser Pattern erhalten bleibt, wenn die Gestaltkomplexität und Informationsdichte nach Null tendiert (Absenkung der Reizschwelle). Für die kulturell antrainierte Topoi-Bildung aber ist anzunehmen, daß sie vergessen oder verloren gehen kann, zumindest uninteressant wird, wenn über längere Zeiträume hinweg der Rückgriff auf die ursprünglich komplexen Gestaltfigurationen verhindert wird: Der Teufel fängt eben auch nur in der Not Fliegen, der Mensch gibt sich nur in extremen Situationen mit minimalen Gestaltqualitäten zufrieden. Wenn diese Not- und Entzugssituation über längere Zeit andauert, sind die reduzierten Gestaltmuster als Auslöser nicht mehr leistungsfähig. Entweder weicht man dann in von der realen Lebensumgebung völlig losgelöste Phantasien aus, d.h. in den Wahn, oder man verfällt in Aggression, in der sich die gestaute Handlungs- und Reaktionsbereitschaft entlädt. Bevölkerungsgruppen, die in gewissen großstädtischen Lebensräumen unter solchen Reduktionen der Gestaltqualitäten leiden, verfallen zwangsläufig in überdurchschnittlichem Maße in die Extreme Aggression oder Wahn.
Die kulturell antrainierten Topoi-Bildungen sind im Unterschied zu den instinktgesteuerten sehr viel instabiler, nicht zuletzt deswegen, weil sozial lebende Menschen beständig die Erfahrung machen, daß ihre Mitmenschen in jeweils unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlicher Wertigkeit an die allen vorgegebenen Gestaltfigurationen der Umwelt Vorstellungen und Gefühle anbinden, so daß der einzelne nie sicher sein kann, welchen Grad der Verbindlichkeit die ihm zur Verfügung stehenden Topoi haben. Diese Verbindlichkeit ist auch dann nicht garantiert, wenn zum Beispiel im Städtebau die Topoi-Angebote institutionalisiert werden. Kaum jemand wird beispielsweise die Gestaltungsvorstellungen einer Baubehörde allein deswegen als hinreichend akzeptieren, weil diese Gestaltungsvorstellungen die einer Institution sind. Die Planungsbehörden argumentieren aber immer noch mit der Notwendigkeit der Vereinheitlichung von Gestaltungsvorstellungen, weil ohne solche Normierung die soziale Lebensumgebung in ein Chaos individuell nutzbarer Gestaltungsangebote zerfallen würde. Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch immer heraus, daß die angeblich verallgemeinerten Gestaltvorstellungen einer Behörde nur die Institutionalisierungen ganz privater Vorstellungen von Funktionsträgern sind. Das Argument, daß ökonomische Voraussetzungen solche Vereinheitlichung der Gestaltvorstellungen erzwingen würden, wird überall da widerlegt, wo man trotz technischer Standardisierung den einzelnen Bürgern überläßt, die für sie allein sinnvollen Topoi in Bauwerken, Kleidung, Wohnungseinrichtungen, Arbeitsplatzgestaltung usw. zu vergegenständlichen. Vorausgesetzt allerdings, daß diese Bürger kulturell so weitgehend trainiert sind, daß sie wissen, wie sehr sie wenigstens für ihren engeren Lebensbereich davon abhängen, die für sie allein effektiven Topoi präsent zu halten, und, was mindestens so wichtig ist, daß sie genügend Vergleichsmaßstäbe und Vergegenständlichungsmöglichkeiten kennen, um diese Vergegenwärtigung zu leisten.
Neben der Institutionalisierung wird vor allem die Ritualisierung von Verhalten und Handeln stets mit dem Zwang zu höherer Allgemeinverbindlichkeit der ausgewählten Handlungs- und Verhaltensmuster begründet. Aber kaum jemand dürfte sich darüber täuschen, daß ihn beispielsweise die Ritualisierung eines Essens in Gesellschaft schon veranlassen könnte, die gereichten Speisen tatsächlich zu genießen, wenn die einzelnen Gestaltfigurationen (Zubereitung und Präsentation der Speisen) und die konkrete Essenssituation nicht seinen im Laufe der Lebensgeschichte ausgebildeten Topoi-Erwartungen angenähert sind; es sei denn, ein Teilnehmer an einem solchen ritualisierten Essen mit ihm bisher nicht bekannten Speisen nützt die Situation dazu, einen neuen Topos zu bilden. Darüber hinaus gibt es mehr oder weniger ausgeprägt bei allen Menschen einen Topos, den man als Genuß der sozialen Anwesenheit von anderen Menschen bezeichnen könnte.
Prinzipiell gilt, daß eine soziale Situation nur in Extremfällen durch die Aktualisierung eines einzigen Topos genutzt werden kann. Zumeist sind die Topoi miteinander zu Sinn-Syndromen verflochten. Marcel PROUST hat aber als einer der ersten gezeigt, daß der Einstieg in diese Sinnsyndrome jeweils über einen einzigen Topos verläuft (das vielzitierte Beispiel des Verzehrens eines Gebäckstücks). Auch hat die Untersuchung der konkreten Assoziationsverläufe und der Traumsequenzen gezeigt, daß die Erlebnisdichte von der Anzahl der differenzierten, also ausgrenzbaren Topoi abhängt, die bei einem gegebenen Anlaß aktiviert werden können. Umgekehrt heißt das, man befände sich in einem gravierenden Irrtum, wenn man annimmt, daß eine Lebensumgebung nur im Hinblick auf die Aktivierung eines Topos ausgelegt zu sein brauchte, ein Grundirrtum heutiger Gestaltung von Neubausiedlungen bzw. ein Grundirrtum vieler didaktischer Planungskonzepte.
Die lineare und nicht simultane Lernzielsetzung und Lernzielkontrolle werden durch diesen Irrtum in ihrer Brauchbarkeit stark eingeschränkt.
Wenn in den einzelnen Lernschritten jeweils nur ein Topos manifest gemacht wird, ja geradezu gegen die vielen latenten ausdrücklich abgehoben wird, verhindert man die Verknüpfung der Topoi zu stabilen Sinnsyndromen. Das ist das Hauptproblem jeder Planung, da sie Sinnkomplexe notwendigerweise auflöst und damit eindimensional wird. Solche Eindimensionalität hat in ihrer Instabilität nur eine Konsequenz, daß nämlich die Planung permanent revidiert werden muß, wodurch sie sinnlos, weil unverbindlich wird.
Damit kein Irrtum entsteht, sei hervorgehoben, daß auch das Denken und die Operationen des Verstandes von solchen Topoi-Verknüpfungen abhängig, also prinzipiell nicht anders aufgebaut sind als die Operationen der Sinnlichkeit. Wir haben ja Erkennen als Unterscheidungs- und Verknüpfungsvermögen definiert, man kann aber den sinnlichen Außen- und Selbstbezug der Organismen in gleicher Weise wie die Verstandestätigkeit als ein solches Unterscheiden und Verknüpfen fassen, wobei nur die Mittel und Verfahren der Unterscheidungs- und Verknüpfungsleistungen durch die Sinne und durch den Verstand verschieden sein mögen. Außerdem sind, wie schon gesagt wurde, den Verstandesoperationen das Unterscheiden und Verknüpfen selber expliziter Gegenstand, obwohl selbst das nicht nur für den Verstand gilt, denn im Selbstbezug der Organismen, wie er sich zum Beispiel im Lust- oder Schmerzgefühl ausdrückt, kann die Notwendigkeit der Unterscheidung ebenso explizit sein wie in Verstandesoperationen.
Den gleichförmigen Aufbau, wenn nicht die vollständige Einheit von sinnlicher Wahrnehmung und Verstandesoperationen belegt auch die Tatsache, daß beide nur in Vergegenständlichungen sozial und kulturell nutzbar werden. Selbst ein gesprochenes Wort oder eine mimische Bewegung ist noch als solche Vergegenständlichung anzusehen, ohne die weder Sinnlichkeit noch Verstand getätigt werden können. Zudem können erst solche Vergegenständlichungen für die einzelnen Individuen die Kontinuität von Handlungen und Vorstellungen garantieren.
2.4 Kopf, Herz und Rumpf - Die Hierarchie der Lernziele
In den tradierten Auffassungen dieses Problems gab es infolge der Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Beziehung des Organismus zur Außenwelt und zu sich selbst eine Hierarchie der Wertigkeiten, die sich in den verschiedenen Lerntheorien auch heute noch zur Geltung bringt. Bei der Unterscheidung der Lernziele in kognitive, emotional-affektive und instrumentelle ist diese Wertigkeit noch unmittelbar gegenwärtig, insofern den kognitiven Fähigkeiten ein höherer Wert zuerkannt wird als den emotionalen und den instrumentellen. Das scheint der Werthierarchie einer Leistungsgesellschaft zu entsprechen, in der instrumentelle (früher körperlich genannte) Arbeit den niedrigsten Rang einnimmt, die Arbeit der Sinnesorgane (früher auch Leidenschaften, heute Hobby genannt) einen mittleren Rang einnimmt, die Arbeit des Verstandes (früher Geistesarbeit genannt) in jedem Fall den höchsten Rang einnimmt. Diese Wertigkeitsskala wurde verschiedentlich in Analogien ausgedrückt, etwa in Analogie zu den Körperfunktionen als Hierarchie von Bauch, Herz und Kopf oder in Analogie zu den Lebensstufen als Hierarchie von Kindheit, Jugend und Reife oder in Analogie zu den Klassen als Hierarchie von Dreckarbeit, Dienstleistung und whitecollar-Arbeit oder auch in Analogie zu den Lebenssphären als Hierarchie von Lebensreproduktion, Spiel und Muße sowie den politischen, philosophischen, theologischen Tätigkeiten, die über Lebensziele orientieren. Diese Werthierarchien bestimmen unausgesprochenermaßen heute noch alles Lernen, insofern Sinnlichkeit, d.h. die Affekt- und Gefühlskompetenz nur dem spielerischen, nicht zweckgebundenen kindlichen Lebensbereich zugeordnet wird, bei den gesellschaftlich bedeutsameren Handlungsbereichen (der Produktion und der Steuerung) jedoch zugunsten der Funktionskompetenz und der Sprachkompetenz fast vollständig eingeschränkt wird.
Freilich behaupten solche Lerntheoretiker, daß mit der Differenzierung von Arbeit, Sinnlichkeit und Verstand, von instrumentellen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten nicht gesagt sei, daß die unterschiedenen Ebenen gegeneinander völlig isoliert sind, so daß ein gewisses Minimum an Wechselbezug zwischen den drei Ebenen immer angenommen werden müsse. Die Unterscheidung der Fähigkeiten kennzeichne nur ihre jeweils schichtenspezifische Dominanz oder ihre tätigkeitsspezifische Bedeutung. In jedem Falle aber würde sich die nur wenigen Mitgliedern der Gesellschaft ermöglichte schulische und praktische Optimalausbildung all dieser Fähigkeiten so auswirken, daß der größte Teil der Gesellschaftsmitglieder nicht in der Lage sei, Sinnlichkeit und Verstand in ihrer Lebenswelt integrativ einzusetzen.
Dieser Auffassung zufolge müßten die in der gesellschaftlichen Hierarchie der Geltungen und der Machtverteilung ganz oben rangierenden Mitglieder unserer Gesellschaft die höchste Form von Integration der drei Fähigkeiten erbringen können. Dem widerspricht nicht nur das konkret beobachtbare Beispiel, daß Angehörige der oberen gesellschaftlichen Ränge genauso wenig zur Differenzierung ihrer Sinnlichkeit fähig sind, weder im Wahrnehmungs- noch im Gestaltungssinn, wie die Angehörigen der unteren Ränge es sein mögen (so lassen sich umstandslos Beispiele allenthalben vorführen, daß ökonomisch potente, mit bester Bildung ausgestattete Oberschichtler sich mitten in der Großstadtanarchie von Lärm, Dreck und Merkmalslosigkeit wohlfühlen oder daß politisch und ökonomisch führende Oberschichtler ihre Wohnungen in der gleichen Weise, d.h. total klischiert, einrichten wie der vielverschriene Kaufhauskunde). Dem widerspricht auch die soziologische Beobachtung, daß heute die Gruppe der unselbständig Arbeitenden über mehr Freizeit verfügt als die Gruppe der Manager und Spitzenfunktionäre, die bei einer durchschnittlichen 70-Stunden-Woche kaum noch in der Lage sind, von der ihnen zugeschriebenen Freistellung von Lebenszwängen und Freisetzung aus vorgegebenen Lebensordnungen Gebrauch zu machen. Insofern haben wir nicht nur keine kulturell führende Oberschicht, sondern überhaupt keine kulturelle Führungsschicht, hingegen wächst der Bedarf nach Integration der kulturellen Leistungen von Arbeit, Sinnlichkeit und Erkenntnis gerade durch die Tatsache, daß die große Gruppe der nichtselbständig Arbeitenden heute über das größte Maß an freigesetzter Lebenszeit verfügt. Diese Gruppe kann aber deswegen nicht kulturell führend werden, weil sie aus naheliegenden Gründen noch nicht die Fähigkeit besitzt, produktiv die Integration von Arbeit, Sinnlichkeit und Verstand zu bewältigen. Der Hauptgrund liegt darin, daß diese aktive Integrationsleistung wiederum nur als Arbeit verstehbar wäre, während die traditionelle, nun auch den unselbständig Arbeitenden verbindliche Auffassung meint, die kulturelle Integration von Arbeiten, Sinnlichkeit und Verstand ließe sich nur als mußevoller Konsum in der Beliebigkeit des Spiels und der Unterhaltung vollziehen.
2.5 Die Integration von Arbeit, Sinnlichkeit und Verstand
Es soll hier aber mit Nachdruck festgehalten werden, daß man sich über den Grad der Entfaltung jener Fähigkeiten von vornherein täuschen muß, wenn man die Entfaltung am Grad der Fähigkeit zur künstlerischen Produktion und Aneignung mißt anstatt an kultureller Produktion und Aneignung. Die Kunst ist nur ein Bestandteil von Kultur, d.h. nur ein Bestandteil der Bewältigung von Lebensanstrengung. Aber selbst die künstlerische Produktion dürfte in erster Linie als kulturelle zu verstehen sein, nämlich als spezifische Form der Bewältigung von Lebensanstrengung der Künstler; zudem intendieren die meisten Künstler, ihre Arbeitsresultate gerade als kulturelle Angebote zu verstehen, d.h. als Instrumente der Lebensbewältigung für Nichtkünstler. Als solche Instrumente haben die Künstler-Tätigkeiten mit allen anderen kulturellen Tätigkeiten zu konkurrieren, d.h. sie dürfen nicht hinter den Stand der allgemeinen kulturellen Leistungen zurückfallen. Die von Künstlern angebotenen kulturellen Fähigkeiten sind, das ist unbestritten, in bestimmter Hinsicht optimal, etwa in Hinsicht auf den Anspruch von Subjektivität, auf den Anspruch der Integration von Arbeit und Leben und im Hinblick auf die Erarbeitung eines Lebenszusammenhangs als Biographie. Erst in der Übernahme dieser Künstler-Leistungen durch die Nicht-Künstler gelänge die Aneignung von Kunst als Kultur. Da Kultur als die Gesamtheit der Anstrengungen zur Bewältigung der Lebenspraxis verstanden wird, kommt es entscheidend darauf an, die kulturellen Standards in der Alltagswelt von Menschen aufzusuchen; d.h. auch die Freizeit kann nur als Bestand der Alltagswelt und nicht als gerade aus ihr ausgeklammerte bewertet werden. Das kulturelle Leben ist also das Alltagsleben, dessen Tätigkeitsbegriff in der Berufs- wie in der Freizeitsphäre Arbeiten heißt. Das hat es im übrigen für das Bürgertum auch in der Zeit immer schon bedeutet, als der Berufswelt nicht die Freizeit, sondern die Privatheit entgegengesetzt wurde. In dieser Privatheit erarbeitete man sich mit äußerster Anstrengung, die der des Berufslebens nicht nachstand, die historisch tradierten wie aktuell sinnvollen kulturellen Angebote im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit für die Bestimmung von Lebenszielen und Lebensorganisation. Wer da glaubt, daß das dem Bürgertum nur möglich gewesen sei, weil es sich eine Arbeitssphäre aussuchen konnte, die diesen Bedingungen angemessen war, dürfte sich dem Studium des konkreten bürgerlichen Lebens nicht sehr weitgehend gewidmet haben. Es gibt hinreichend Äußerungen solcher Bürger, die sich gegenüber dem Terror solcher Zwänge in Beruf und Privatsphäre genauso ausnehmen wie die Äußerungen eines aufgeklärten und selbstbewußten Arbeiters von heute. Die Inhumanität von Beruf und Privatsphäre, der das Bürgertum ausgesetzt war, spiegelt sich in einer Unzahl von literarischen, theatralischen, philosophischen und künstlerischen Themenstellungen. So ist zum Beispiel bis heute kein Theaterstück bekannt, das den Terror der Lebenszwänge für einen heutigen Arbeiter so extrem und genau formuliert wie etwa Strindberg den Terror der Lebenszwänge für bürgerliche Individuen der Jahrhundertwende formuliert hat. Das kann nicht nur an dem Fehlen adäquater künstlerischer Potenzen liegen. Vielmehr ist anzunehmen, daß durch das Klassenkampfmodell dem heutigen Arbeiter gerade die entscheidende Anstrengung und auch Leistung in der Bewältigung dieser Anstrengung als eine bloß allgemeine und nicht individuell zu leistende erklärt und abgenommen wird. Man kann aber gerade als Marxist den Individuen nicht die Anstrengung vorenthalten, Lebensziele und Lebensorganisation selbst zu entwickeln und ihren Widerspruch zu den Lebensgegebenheiten als lebenslangen unaufhebbaren Konflikt bzw. als lebenslangen Bewältigungsversuch ohne Aussicht auf definitive Lösung auszuhalten. Mit anderen Worten, wer Arbeit richtigerweise nicht als Selbstzweck versteht, sondern als gesellschaftliche Verwirklichung der Individuen, kann damit das Maß der individuellen Anstrengung bzw. die einzelne Arbeitsleistung nicht reduzieren. Natürlich ist der Einwand richtig, daß einem Fließbandarbeiter eine derartige Anstrengung nicht zuzumuten ist. Er kann Freizeit nicht auch noch als kulturelle Arbeitszeit verstehen. Er kann sie nur zur annähernden Regeneration seiner körperlichen und psychischen Gesundheit nutzen. Deshalb muß es weiterhin sein Ziel bleiben, derart inhumane Arbeitsbedingungen, denen sich schon aus der Okonomie der menschlichen Lebenskraft alles übrige Handeln zu unterwerfen hat, abzuschaffen. Aber dieser Sachverhalt enthebt das Gros der heutigen Arbeitnehmer, die nicht am Fließband arbeiten, nicht der Verpflichtung, selber kulturelle Arbeit zu leisten. Daß diese Arbeit bisher nicht in dem notwendigen Umfang geleistet wird, liegt keineswegs daran, daß die kulturellen Standards von einer Elite der Müßiggänger geprägt seien. Das Defizit an kultureller Leistung besteht nicht nur für die Klasse der unselbständig Arbeitenden, sondern im gleichen Umfange für die Funktionsklassen der Manager, selbständig Gewerbetreibenden und der Beamten und Angestellten. Der gesellschaftspolitische Impetus, der den Mangel an kultureller Aktivität damit entschuldigt, daß inhumane Arbeitsbedingungen unüberwindbare Hinderungsgründe seien, geht an den empirisch belegbaren sozialen Tatbeständen zumindest unserer Gesellschaft vorbei.