Geschrieben für ›artscribe‹ im September 1986 anläßlich der Eröffnung des Museum-Neubaus.
Im September 1946, also vor genau vierzig Jahren, ließ das Londoner Foreign Office in der britischen Zone des von den Siegermächten besetzten Deutschlands das Land Nordrhein-Westfalen gründen. Gegen alle Erwartung hat sich diese synthetische Konstruktion als sinnvoll und stabil erwiesen.
Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 wurde Nordrhein-Westfalen das größte und mächtigste Bundesland. Die beiden Rheinstädte Köln und Düsseldorf wurden zu den kulturellen und administrativen Zentren; in den Städten Essen, Oberhausen, Duisburg, Dortmund ballte sich die wirtschaftliche Produktion.
Wenn sich auch in der jüngsten Vergangenheit durch strukturelle Veränderungen die Wirtschaftsmacht der Bundesrepublik in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg rasanter entwickelte als in Nordrhein-Westfalen, so ist zumindest für den kulturellen Bereich unbestritten, daß der Raum Bonn, Köln, Krefeld, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Wuppertal die größte Ansammlung von sehr aktiven Kulturinstitutionen nicht nur in der Bundesrepublik darstellt.
Selbst New York kann bei etwa gleich großer Bevölkerungszahl und geographischer Ausdehnung mit der Ballung von Museen, Theatern, Galerien, Universitäten in diesem Zentrum Nordrhein-Westfalens nur schwer konkurrieren. Die kulturelle Dynamik dieser Region wird durch die Konkurrenz der Städte Köln und Düsseldorf bestimmt. Köln, das eine glorreiche Vergangenheit als Herzstück des römischen Weltreiches diesseits der Alpen besitzt, war seit dem Mittelalter nicht mehr Sitz einer weltlichen Macht; die Kultur der Stadt Köln wurde von den Repräsentanten der einen, weltumspannenden katholischen Kirche geprägt. Düsseldorf hingegen verdankt seine kulturelle Identität weitgehend weltlichen Landesherren und deren höfischer Kultur. Bis auf den heutigen Tag machen sich diese unterschiedlichen historischen Kräfte geltend.
Das jüngste Beispiel für diesen ›Kulturkampf‹ zwischen Köln und Düsseldorf bot in diesem Jahr die Eröffnung der Museumsneubauten in beiden Städten. Im Frühjahr eröffnete die Landesregierung den Neubau für ihre Kunstsammlung, die zu den qualitativ erstrangigen nicht nur in Europa gezählt werden muß. Der Museumsneubau in Düsseldorf ist jedoch eine große Enttäuschung in erster Linie deshalb, weil der famose Museumsdirektor Werner Schmalenbach von der gefährlichen Obsession beherrscht war, seine Sammlung möglichst vollständig in ›natürlichem‹ Oberlicht zu präsentieren. Dieser Ideologie des natürlichen Lichts fallen jetzt sogar die bedeutendsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts zum Opfer; sie wirken in den kleinteiligen und gleichmäßig lichtdurchfluteten Museumsräumen wie ihre eigenen Plakate.
Um so gespannter war man auf den gewaltigen Neubau des Kölner Wallraf-Richartz-Museums / Museums Ludwig. Nicht nur auf den ersten Blick läßt sich sagen, daß die Kölner den Wettkampf mit Düsseldorf gewonnen haben. Auch in den meisten Einzelheiten erweist sich die Konzeption und Ausführung des Kölner Museums als weit überlegen. Die Architekten Peter Busmann und Godfrid Haberer haben in ihrer zehn Jahre langen Arbeit für den Neubau zum Teil gegen bereits verbindliche Planungen eine sowohl städtebauliche wie auch architektonische Lösung gefunden, die man als vorbildlich bezeichnen darf. Die Architekten setzten durch, daß das Areal zwischen Rheinufer, Hauptbahnhofsgelände, Domchor und dem Römisch-Germanischen Museum als Einheit gestaltet werden konnte. Die Rheinuferstraße, ein Hauptverkehrsweg, wurde in einen Tunnel abgesenkt, so daß jetzt das neugestaltete Areal des Museums zum Rhein hin mit einer verkehrsfreien Uferpromenade abschließt.
Jedermann kann sich vorstellen, wie schwierig es sein muß, einen Neubau im unmittelbaren Vergleich zu dem herrlichen gotischen Dom zu konzipieren. Auch diese Aufgabe haben die Architekten mit Bravour bewältigt. Das gelang wahrscheinlich gerade deshalb so gut, weil sie mit ihrem Bau einen ganz zeitgemäßen Kontrast zur Sakralarchitektur des Domes wählten. Die dominierenden Materialien Zinkblech und Ziegelstein legen eher die Assoziation an eine Fabrik nahe; auch das Architekturkonzept einer longitudinal ausgerichteten Staffelung der gewaltigen Baumasse, deren einzelne Segmente von wogenden Sheddächern gekrönt werden, unterstützt die Anmutung des Baus als prätentionslose Profanarchitektur vom Charakter einer Fabrik.
Vor mehr als hundert Jahren haben die protestantischen Preußen, denen die Rheinlande nach dem Wiener Kongreß von 1815 zugefallen waren, auf der anderen Seite des Doms, unmittelbar an ihn angrenzend, einen damals zeitgenössischen Profanbau, nämlich den Hauptbahnhof, in Konkurrenz zum Dom erbaut, um das Repräsentationszentrum des katholischen Kölns mit den neuen Mächten der Zeit zu konfrontieren. Der profane Bahnhof geriet zu einer Kathedrale des Verkehrs, und der Dom wurde zu einer Art Verkehrsknotenpunkt zwischen diesseitiger Menschenwelt und dem Reich Gottes.
Der Museumsneubau mit seinem wesentlich von dem Israeli Dany Karavan gestalteten Umfeld, dem Heinrich-Böll-Platz, läßt sich nun als eine zeitgemäße Kathedrale der Kunst verstehen, in der die zahllosen gotischen Altarbilder größere Wunder tun als die im Dom verbliebenen Sakralwerke. Gleichzeitig erhält der Dom ein wenig den Charakter eines Museums der Religiosität, in dem die Gläubigen selber mit ihren Ritualen und Vorstellungen zu musealen Ausstellungsstücken werden.
Das Innere des Museumneubaus wird, so könnte man sagen, von klassischen Auffassungen einer Museumsarchitektur geprägt. Die Räume haben eine hinreichende Höhe, sind zum großen Teil gut proportioniert, bieten viele große Hängeflächen. Die Lichtführung (Oberlicht und Kunstlicht gemischt) erlaubt Abschattungen in den einzelnen Räumen, so daß die Räume für das Auge wohltuend strukturiert erscheinen. Die Ausleuchtung ist nicht gleichförmig wie in Düsseldorf, die Malereien und Skulpturen können durch Abschattungen Plastizität entwickeln.
Der Bau wird im Innern von einem zentralen Treppensaal beherrscht, der sich durch alle Stockwerke erstreckt. Diese Treppenanlage verbindet und strukturiert nicht nur räumlich die einzelnen Ausstellungskomplexe des Museums, sie stellt auch gedanklich die Verbindung zwischen den so unterschiedlichen Ausstellungsobjekten des Gesamtmuseums her. Die Treppenanlage fordert dazu auf, die historischen und die unmittelbar zeitgenössischen Bestände des Museums wechselseitig aufeinander zu beziehen.
Wer die historisch chronologisch gehängten Bestände des Mittelalters und der Epochen von 1600 bis 1900 aufwärts durch das Museum in Richtung auf die dort präsentierte klassische Moderne bis zur Pop Art durchwandert, kann auf diese Weise Fragestellungen der historischen Kunst an die Moderne richten, er kann zum Beispiel fragen: Welche Äquivalente für Kunst im sakralen Kontext hat die Moderne zu bieten? Was wurde in unserem Jahrhundert aus dem Historienbild? Wie entwickelte sich die Ikonographie? Und ähnliches. Wenn der Betrachter hingegen im obersten Stockwerk mit dem Rundgang durch die Moderne beginnt, um dann beim Abstieg die historischen Bestände zu durchschreiten, dürften sich ihm von den Werken der Moderne her vor den historischen Ausstellungsstücken neue Wahrnehmungen für die Besonderheit künstlerischer Konzepte, malerischer Valeurs, Kompositionsprinzipien und ähnliches ergeben.
Der Wechselbezug von historischen Beständen und Moderne prägt ja das Wallraf-Richartz- Museum / Museum Ludwig, und es ist den Architekten gelungen, mit ihrer Architektur den Museumsbesucher zu animieren, der Beziehung zwischen alt und neu und neu und alt auch tatsächlich nachzugehen. Dabei wirkt das Museumsinnere nicht als abgeschlossener Kasten; die Nord- und Ostfront eröffnen gut kalkulierte Beziehungen zwischen dem Inneren des Gebäudes und seinem äußeren Umfeld. Hierbei sind den Architekten wirkliche Glanzleistungen gelungen; die gläserne Restaurantfassade ist zum Beispiel so angelegt, daß sie für den im Inneren stehenden Betrachter die drei gewaltigen Bogensegmente der Eisenbahnbrücke über den Rhein als Skulptur ins Museum einbezieht.
Der Neubau umfaßt 20000 qm Gesamtfläche und gehört zu den größten Museumsneubauten im Nachkriegseuropa. Trotz dieser gewaltigen Dimensionen reicht der Platz nur für die Präsentation eines Teils der Museumsbestände aus; die Raumnot macht sich in einigen Bereichen des Museums bereits bemerkbar. So scheint vor allem das Areal für aktuelle Wechselausstellungen etwas zu klein geraten zu sein; aber die Architekten hatten ja auch noch die Aufgabe zu lösen, in den Komplex unterirdisch die gewaltige Anlage einer Konzerthalle für 2000 Besucher mit den dazu gehörenden Funktionsräumen zu integrieren. Auch das ist ihnen auf bewundernswerte Weise gelungen.
Am meisten muß man aber bewundern, daß der Bau einerseits als Architektur in diesem wichtigsten städtebaulichen Areal Kölns prägnant und charaktervoll ist, ohne zu protzen oder auch nur zu dominieren, und daß er andererseits in seinem Innern so weit wie möglich hinter die präsentierten Kunstwerke zurücktritt und dennoch gut proportionierte und sinnvoll strukturierte Räume bietet. Stilistisch könnte man ihn im Innern als sanftes Neo-Art-Deco empfinden.
Und alles das verdanken wir, so behauptet jedenfalls eine sehr effektvolle Kulturpropaganda, der Tatkraft eines Mannes, des Aachener Schokoladenfabrikanten Peter Ludwig. Dieser in Ost- und Westeuropa hoch dekorierte Unternehmer schenkte 1976 der Stadt Köln einen Teil seiner Sammlung von Kunst der Gegenwart und versprach, einen anderen Teil als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen, wenn die Stadt sich bereit finden würde, an prominentester Stelle im Stadtbild einen Museumsneubau zu errichten und diesem Museum den Namen ›Ludwig‹ zu geben. Das geschah denn auch – warum es geschah, ist bis heute unerfindlich.
Der Museumsneubau hat 280 Millionen DM gekostet, abgesehen davon, daß der Bauplatz an dieser prominenten Stelle nicht mit Gold aufzuwiegen ist. Bei großzügigster Schätzung haben die angeblich mäzenatischen Gaben des Herrn Ludwig an die Stadt Köln den Wert von einem Zehntel der Bausumme. Diesen verschwindend kleinen Teil an den Gesamtausgaben hätte doch die Öffentlichkeit selbst aufbringen können, zumal es in Köln viele kompetente Museumsfachleute gibt, die in jedem Fall mit den von Herrn Ludwig ausgegebenen Millionen Kunstwerke sehr viel größerer Qualität erworben hätten. Hinzu kommt, daß die Öffentlichkeit, wie seit Jahren auch in Zukunft, wissenschaftliches Personal, Restauratoren, klimatisierte Räume und die anderen umfangreichen Infrastrukturen für die Betreuung der Sammlung aufbringt. Das alles und dazu die nicht unerheblichen Versicherungssummen ersparte und erspart sich Herr Ludwig mit der Einbringung seiner Bestände in Museen. In Basel, Wien, Aachen ist er ähnlich vorgegangen, überall gibt es Ludwig-Museen mit Ludwig-Schenkungen, vor allem aber mit Ludwig-Dauerleihgaben, über die letztendlich doch zu verfügen Herr Ludwig in allen diesen Museen seinen unübersehbaren Einfluß sichert. Museumsdirektoren werden nur mit seiner Zustimmung ernannt, aber natürlich von der Öffentlichkeit bezahlt. Durch die Arbeit der öffentlich bezahlten Wissenschaftler werden die Schätze in Ludwigs Besitz natürlich enorm aufgewertet. Ludwig scheut sich nicht, die unvergleichlich intensive und langjährige Arbeit öffentlich bezahlter Wissenschaftler zu nutzen, um seinen Besitz mit enormer Wertsteigerung gegen alle Zusagen unter kommerziellen Gesichtspunkten zu verkaufen.
Gegen alle diese Machenschaften des Herrn Ludwig wäre nichts einzuwenden, solange man sie als gelungene Machtdemonstration eines ruhmsüchtigen Privatmannes auffassen und einschätzen würde. Die Kulturpropaganda feiert indessen Ludwig als einen um das öffentliche Wohl verdienten Mäzen, wovon gar keine Rede sein kann. Die Kulturpropaganda geht so weit, wie jüngst der Kölner Reiner Speck, zu behaupten, daß durch Ludwigs Tätigkeit der Zugang von jedermann zur Kunst und deren »abenteuerlich, naiv begeisterte Aufnahme« erreicht worden sei; ja, es wird der Eindruck erweckt, als gäbe es in der Bundesrepublik ohne Ludwig keine aktive Galerieszene, keine engagierten Museen und Verlagshäuser. Das ist natürlich alles Unsinn, von dem man bisher nicht annehmen mußte, daß er die Meinung von Herrn Ludwig tatsächlich widerspiegelt. Jetzt aber wagt es Herr Ludwig von Interview zu Interview mehr und mehr, den wahren Hintergrund seiner Aktivitäten zu enthüllen. Ihn treibt nicht Leidenschaft oder gar Kennerschaft für die Kunst. Viele haben sich ohnehin schon gefragt, warum Ludwig beispielsweise von einem so bedeutenden Maler wie Baselitz nur ein paar Werke zusammengebracht hat, die als einzelne in einer Sammlung kaum eine Bedeutung haben können. Sein Vorgehen ist bloß reaktiv von Gelegenheiten und Situationsbedingungen abhängig.
Es ist hier nicht der Platz, die Sammlung unter diesem Gesichtspunkt zu würdigen oder vielmehr zu kritisieren. Es gibt in der Bundesrepublik zahlreiche Sammler, die qualitativ hochwertigere Sammlungen von Gegenwartskunst besitzen. Ludwig ist nur durch die schiere Quantität der von ihm zusammengetragenen Stücke ausgezeichnet. Die merkwürdige Beschränktheit seines Urteils macht sich nicht nur gegenüber zeitgenössischer Kunst bemerkbar. Herr Ludwig hat sich seit seiner Promotion über Picasso nach eigenem Bekunden mit diesem Maler seit vierzig Jahren so intensiv beschäftigt wie mit keinem anderen; was dabei allerdings für die Sammlung herausgekommen ist, sind bis auf wenige Ausnahmen zweitrangige Werke von Picasso. Der Grund für dieses auffällige Vorgehen des Sammlers Ludwig ist neben seinem mangelnden Gefühl für Qualität jetzt unverstellt sichtbar geworden. Den zahlreichen Aussagen Ludwigs ist zu entnehmen, und er spricht das jetzt auch unumwunden aus, daß er eine Revision der Kunstgeschichte unseres Jahrhunderts anstrebt: »Es ist für mich nicht vorstellbar, daß sich die Aufgabe von Bildkunst in Gegenstandslosigkeit erschöpft.« Er hat eine starke Aversion (aus mangelndem Verständnis) gegen die sogenannte gegenstandslose, abstrakte Kunst. Seine angebliche Leidenschaft für die Pop Art wie für die Spätvarianten des Sozialistischen Realismus der Ostblockkünstler bezieht er aus der Tatsache, daß in diesen Kunstwerken wieder Menschen, Dinge, Lebenssituationen so dargestellt werden, wie das der naive Alltagsmensch von einem wirklichen Könner als Künstler erwartet.
Herr Speck teilt als Propagandist Ludwigs mit, daß er sich für die Menschenbilder in Kunstwerken deshalb so stark interessiere, weil sich bei der Menschendarstellung von selber der Zwang zur Gegenständlichkeit einstelle. Herr Ludwig revidiert die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts im Sinne der Ideologie der fehlgeleiteten Kunst, die ja weiß Gott keine Erfindung der Nazis gewesen ist. Die Nazis haben sich dieser im Volk verbreiteten Auffassung instinktsicher bedient, um ihnen mißliebige Künstler ins Exil oder in Lager oder in Berufsverbote verbannen zu können und deren Werke, gestützt auf die angebliche Zustimmung des Volkes, aus dem Verkehr ziehen zu dürfen. Herr Ludwig verkündete gerade voller Stolz, daß er und seine Frau sich von einem überlebenden Staatskünstler der Nazis haben portraitieren lassen und daß er dafür sorgen wolle, diesen Künstler Arno Breker wie andere Künstler der Naziepoche wieder hoffähig zu machen. Die Argumente, die er dafür vorträgt, sind abenteuerlich, seinem Mangel an Qualitätsgefühl (Arno Breker ist eben ein miserabler Bildhauer) entspricht ein ebenso großer Mangel an Aufrichtigkeit und Rationalität. Ludwig behauptet: Breker und andere Kunst der Nazizeit nicht in öffentlichen Museen zu zeigen sei ein »Versuch, die Öffentlichkeit zu entmündigen. Dahinter muß doch die Vorstellung stecken, daß von den Werken der Nazizeit eine unzumutbare Beeinflussung ausgehen könnte. Ich habe es gehaßt, daß die Nazis versucht haben, ganze Kunstrichtungen der Öffentlichkeit vorzuenthalten, ich fand das einen Rückfall in die blanke Barbarei, und ich finde es auch heute barbarisch, Quarantänelisten von Künstlern aufzustellen, die man keinesfalls zeigen darf«. Daran ist alles falsch, vor allem der Vergleich von Nazizeit und Gegenwart.
Die Nazis haben ja nicht Kunstwerke nur »vorenthalten«, sondern die Werke vernichtet und die Künstler verfolgt. Davon kann auch beim bösesten Willen in der Gegenwart nicht die Rede sein. Breker nicht öffentlich auszustellen, sondern ihn nur mit ungeheurem Erfolg von Privatgalerien zeigen und handeln zu lassen bedeutet keineswegs, Quarantänelisten aufzustellen. Ihn nicht öffentlich zu präsentieren, weil seine Werke die hinreichende Qualität vermissen lassen, heißt nicht, die Öffentlichkeit zu entmündigen, sondern im Gegenteil ihr Urteilskriterien an die Hand zu geben. Die Nazibarbarei auf eine Stufe mit den heutigen Entscheidungen von Museumsdirektoren zu stellen ist entweder eine leicht durchschaubare Lüge oder eben das Resultat mangelnder Fähigkeit zu rationalem Urteil, zu qualitativer Differenzierung und eines Mangels an historischen Kenntnissen. Da man schwerlich annehmen kann, daß ein führender Repräsentant der deutschen Wirtschaft und des Kulturlebens die Bundesrepublik durch historisch unhaltbare Vergleiche zu diskreditieren versucht, muß man ja zu dem Schluß kommen, daß Herrn Ludwig alle Voraussetzungen für ein differenziertes Kunsturteil fehlen. Das eben bestätigt auch die Beschäftigung mit den Kriterien seiner Auswahl für die Sammlung in zahllosen Einzelheiten.
Ludwig ist kein Skandal für die Bundesrepublik, auch wenn viele so denken wie er, die immer schon eine heimliche Vorliebe für die Staatskunst ihrer politischen Gegner im Ostblock hatten; in deren Machtbereich und in deren Kunst blieben sie vor den Zumutungen der sogenannten abstrakten Moderne verschont. In der Bundesrepublik verboten ihnen das Grundgesetz und die Institutionen der Demokratie, mit der Strategie der Diskriminierung von Kunst als entarteter Kunst fortzufahren. Sie waren deshalb den Ostblockfunktionären dankbar, daß sie im Sinne der Ludwigs die Zumutungen der abstrakten Kunst der Moderne als unbedeutende Afterkunst aus der Öffentlichkeit zu verbannen schienen. Ludwig: »Postmodern – was heißt das anderes, als traditionell zu sein?« Jetzt fühlt sich Ludwig stark genug, der Öffentlichkeit sein Verständnis der traditionellen Kunst aufnötigen zu dürfen. »Das ist sicher auch dem Zeitgeist gemäß«, sagt er, und darin hat er nun wirklich einmal etwas Sinnvolles gesagt.
Man darf gespannt sein, wie lange die Kuratoren der Sammlung Ludwig im neuen Kölner Haus noch in der Lage sind, mit dem ihnen überreichten Danaergeschenk so umzugehen, daß ihre Qualitätskriterien und ihre Urteile über die Entwicklung der Kunst der Moderne das Gesicht der Sammlung bestimmen. Für die Eröffnungspräsentation des neuen Kölner Museums ist ihnen das über weite Strecken gelungen, vor allem durch Betonung von Werken, die nicht aus der Sammlung Ludwig stammen und deren Qualität unbestritten ist. Wenn sich im angedeuteten Sinn der Fall Ludwig zu einem Skandal der Kulturpolitik entwickeln sollte, dann ist dafür nicht Herr Ludwig zur Verantwortung zu ziehen, sondern die Repräsentanten der Öffentlichkeit, die Herrn Ludwig vorschieben, um ihre mit Ludwig konformen Urteile über die moderne Kunst nicht selber verantworten zu müssen.
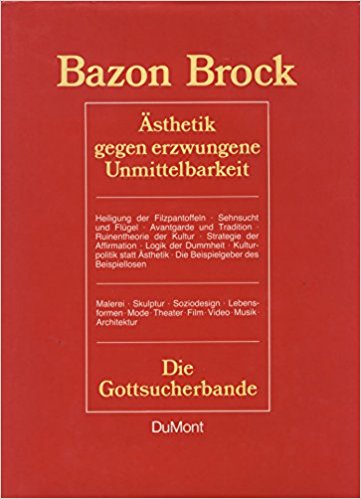 + 1 Bild
+ 1 Bild