Der Vorschlag, die Vielzahl der unterschiedlichsten Ausstellungsbeiträge dieser documenta in einem Zusammenhang zu sehen, geht von einer Frage aus, die immer wieder vom Publikum gestellt wird, nämlich von der Frage nach den Bedeutungen.
Die Besucherschule wendet sich an diejenigen, die diese Frage ernstnehmen und wissen möchten, was das für Bedeutungen sind, die diese merkwürdigen Objekte an den Wänden und auf dem Boden dieser Ausstellung von moderner Kunst repräsentieren.
Bei dieser Frage gehen wir von etwas aus, was eigentlich alle kennen, daß nämlich Bedeutungen nicht in den Dingen stecken wie ein Keks in einer Schachtel oder wie etwas in einer Schachtel. Ja, Bedeutungen stecken ebensowenig in der Weise in etwas, wie vielleicht ein Pfefferstreuer in einem Futteral steckt, der normalerweise gar nicht im Futteral steckt, aber ›hineinbugsiert‹ sein könnte. Viele Besucher einer Ausstellung moderner Kunst haben den Eindruck, als ob die Künstler in ihre Objekte Bedeutungen ›hineinbugsieren‹, so daß man von außen gar nicht vermuten kann, welche Bedeutung da drin steckt.
Also, wenn Dinge nicht die Bedeutungen in sich enthalten, wie etwa eine Schachtel einen Keks, was heißt dann Bedeutung, wo kommen die Bedeutungen her?
Und da gibt es nun die erste einfache aber verbindliche Vorgabe, verbindlich nicht nur für den Bereich der Kunst, sondern auch in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Wissenschaft. Wir sagen, Bedeutungen entstehen für alle Menschen bei jeder Art von Tätigkeit nur dadurch, das Menschen in der Lage sind, Dinge voneinander zu unterscheiden. Dinge unterscheiden zu können, ist die Voraussetzung dafür, daß etwas eine Bedeutung haben kann. Beim Unterscheiden geht es natürlich um die Gesichtspunkte der Unterscheidung. Fahren Sie als Verkehrsteilnehmer eine Straße mit ihrem Auto entlang und unterscheiden nun die Verkehrsschilder im Hinblick auf die Größe oder auch im Hinblick auf das Gewicht der Verkehrsschilder, dann wissen Sie alle, daß unter diesen Unterscheidungsgesichtspunkten (Gewicht oder Größe) die Verkehrsschilder für Sie als Verkehrsteilnehmer keine Bedeutung haben. Erst wenn Sie die Schilder danach unterscheiden, was die Schilder Ihnen für Ihr Verhalten als Teilnehmer im Straßenverkehr sagen, werden die Schilder für Verkehrsteilnehmer bedeutsam.
Die formalste, die simpelste Art des Unterscheidens besteht darin, einfach etwas auszugrenzen. Das demonstriert die Gruppe Haus-Rucker & Co. auf der documenta 6 mit ihrem großen Aufbau auf dem Orangerie-Absatz. Da wurde ein Rahmen vor die Landschaft gehalten, und dieser Rahmen, dieser Bilderrahmen grenzt nun aus dem Horizont etwas heraus, nämlich das, was sich jetzt vom Gesichtspunkt des Betrachters her im Bilderrahmen befindet gegenüber dem, was sich außerhalb des Bilderrahmens befindet.
Das war eine kulturgeschichtlich außerordentlich bedeutsame Leistung, unterscheiden zu können durch das bloße Ausgrenzen von etwas. Bilderrahmen waren in der Kunst solange bedeutsam, wie man sich des Problems der Ausgrenzung bewußt war. Die Ausgrenzung kann man auch bezeichnen als Unterscheidung zwischen Bild und Nichtbild, da daß das, was jetzt im Rahmen zu sehen ist, das Bild ist, und was außerhalb des Rahmens ist, eben das Nichtbild ist.
Wenn man unterscheidet, dann ist die Frage nach der kleinsten Möglichkeit der Unterscheidung von großer Bedeutung, so wie das etwa der Maler Gerhard Merz in seinem Bild zeigt. Das Publikum sagt: »Na ja, dieses Bild sieht aus, wie ein Rechenpapier, Millimeterpapier, es sind so Linien gezogen, blau, rot und gelb.« Von nahem betrachtet zeigt sich, daß die Linien unterbrochen sind, daß es merkwürdige Schwellungen gibt, und auf die kommt es dem Künstler an. Das klingt zunächst merkwürdig, ist es aber gar nicht. Es geht um die kleinste Möglichkeit des Unterscheidens, d.h. wie ähnlich können sich zwei Dinge sein, so daß man sie noch unterscheiden kann; und Merz sagt dazu: »Ich will tatsächlich unterscheiden zwischen einem von mir mit der Hand hergestellten Liniament dieser Art und etwa dem, das eine Maschine herstellt.«
Das hat zunächst alles mit Kunst noch gar nichts zu tun, diese Frage erörtern wir jetzt noch nicht. Wir betrachten nur zunächst Formen des Unterscheidens als Voraussetzung dafür, daß Bedeutung entsteht.
Will man etwas herstellen, das sich von etwas anderem unterscheidet, dann ist man gezwungen, sich zunächst auf das zu beziehen, wovon man sich unterscheiden will. So geht Louis Cane vor, der über sein Bild im Katalog schreibt: »Ich wollte ein Bild herstellen, das sich von einem vorgegebenem Bild unterscheidet, nämlich von diesem Bilde Giottos, das Giottot 1305 in Assisi als Fresco gemalt hat.« Louis Cane sagt weiter: »Ich wollte mich von diesem Bild unterscheiden, deswegen musste ich mich aber erst auf dieses Bild beziehen. Ich kann mich mit meinem Bild ja nur von diesem bestimmten Bild unterscheiden, wenn etwas von diesem Bild in meinem Bild vorkommt, also eine gewisse Ähnlichkeit beispielsweise der Struktur, des Aufbaus des Bildes vorkommt … Um das zu erreichen, habe ich den Giotto durchgepaust, also z.B. die vier Vertikalstrukturen, die bei Giotto durch die Säulen ausgedrückt werden, eins, zwei, drei, vier, die habe ich übernommen in mein Bild, eins, zwei, drei, vier.« Und Cane hat dieses Gibelelement von Giotto in sein Bild aufgenommen. Aber wenn man jetzt etwa die Horizontallinien ansieht, dann merkt man, wie Cane von Giottos Vorlage abweicht. Die linke Horizontallinie geht bei Cane nämlich von links unten nach rechts oben; im Giottobild aber genau umgekehrt; da beginnt das Unterscheiden. Man kann auch weiterverfolgen, wie Cane Giotto gesehen hat, um seine eigene Arbeit davon zu unterscheiden. Die Linie, die Cane nachzieht, führt nämlich im Giottobild vorne von der linken Säule bis nach hinten ins Bild hinein an die hintere Säule. Sie ist also die Bodenlinie, die im Raum selber verläuft. Und die wollte Cane aufnehmen. Giotto hatte sich damals in den Anfängen des perspektivischen Malens bemüht, einen Raum von außen so darzustellen, daß man zugleich sein Inneres erfährt. Das war relativ einfach darzustellen, weil die Mauern der Kirche zerstört sind, also eine natürliche Möglichkeit besteht, ins Innere hineinzugucken. Es geht darum, das Innere darzustellen: Vielmehr den heiligen Franz, der im Inneren dieser Kirche im Längsschiff vor Christus kniet. Cane unterscheidet seine Bildvorstellung (nachdem er eine Ähnlichkeit mit dem Giottobild hergestellt hat), indem er anders als Giotto nicht von außen nach innen sieht und so das Innere des Raumes darstellt, sondern indem er einen Längsschnitt durch das ganze Gebäude macht. So erhält er eine Feldunterteilung und drückt durch die unterschiedlichen Farben aus, in welcher Weise diese Felder Bedeutung haben.
Im rechten Feld zum Beispiel sieht man Christus in der Aura bei Giotto; das übernimmt Cane auch durch die Form des hellen Farbfeldes. Der heilige Franz kniet als realer Mensch in einem realen Raum; der reale Raum ist bei Cane durch ein dunkleres Braun ausgedrückt; Franziskus gehört aber als Heiliger sozusagen zur Hälfte schon zum göttlichen Bereich von Christus, deshalb ist das Raumfeld von des Franziskus geteilt.
Vereinfacht kann man sagen, daß Giotto als erster die mittelalterliche Bedeutungsperspektive (wichtige Dinge werden im Bild groß dargestellt, weniger wichtige kleiner) durch Raumperspektive ablösen wollte: der Ereignisraum sollte als Bildfeld so gesehen werden können, wie wir natürlicherweise reale Ereignisse zu sehen glauben. Dabei entdeckte Giotto als erster Maler der Neuzeit folgendes Problem: Gegenstände stehen im Raum; und zugleich bilden die Gegenstände das Raumgefüge erst aus. Giotto fragte sich, wie ein und derselbe Gegenstand (die Kirche, in der der heilige Franz kniet) als Gegenstand im Raum und als raumbildender Gegenstand abgebildet werden kann. En Innenraum wie der der Kirche wird durch die ihn umgebenden Mauern gebildet. Von außen gesehen formulieren dieselben Mauern aber die Kirche als einen Gegenstand im Raum. Die Verbindung beider Sichten leistet Giotto mit dem Trick, die Kirche als Ruine darzustellen. Cane vermittelt den Gegenstand im Raum und den raumbildenden Gegenstand durch die psychologische Wertigkeit der beiden von ihm gewählten Farben; die dunklere steht für den geschlossenen Innenraum, die hellere für die Außenwelt, die mit Bezug zu Giotto auch als geistiger oder spiritueller Raum der Gotteswelt verstanden werden kann. Profan ausgedrückt: Cane vermittelt zwischen der Wahrnehmung des Raumes und Raumvorstellungen.
Auch das soll nun keine Interpretation sein und auch kein Hinweis auf den Kunstanspruch des Bildes von Cane, sondern nur zeigen:
Wenn man unterscheidet, um Bedeutung aufzubauen, dann muß man sich zunächst auf das, wovon man sich unterscheiden will, beziehen: Man muß Ähnlichkeiten herstellen.
Es folgt ein anderes Beispiel des Unterscheidens, der Art und Weise, wie unterschieden wird; wir rubrizieren die Künstler nicht, wir teilen sie nicht in Kästchen ein, sondern verweisen auf Beispiele. Betrachten wir etwas Gotthard Graubner. Jeder, der auf diese Bilder guckt, sieht, das muß etwas mit Farbe zu tun haben, kein anderes Problem liegt näher. Diese delikaten Farboberflächen geben eigentlich gar keinen anderen Hinweis. Nun, was unterscheidet Graubner hier im Hinblick auf die Farbe? Im Alltag sehen wir Farben immer nur in Verbindung mit Dingen, und alle Dinge haben irgendeine Form. Wir sehen also Farbe immer nur als Eigenschaft von Dingen, die eine Form haben, Farbe nur in Verbindung mit Form. Die Säule ist grau, der Pullover ist rot, das Auto ist schwarz.Farben treten im Alltag immer nur in Beziehung zu Formen auf. Graubner unterscheidet von dieser Art der Farbwahrnehmung solche, die unabhängig von Formen oder geformten Dingen getätigt werden können; er versucht herauszuarbeiten und zu zeigen, daß Farbe auch sichtbar werden kann, ohne bloß Eigenschaft eines geformten Dinges zu sein.
Eine ganz merkwürdige Art des Unterscheidens als Voraussetzung für den Aufbau von Bedeutungen zeigt der Maler Edgar Hofschen, und er steht hier für eine Anzahl von Malern heute. Da wird nicht wie bei Haus-Rucker & Co. ganz formal durch Abgrenzung oder wie bei Cane durch Bezug auf ein anderes Bild unterschieden. Hier unterscheidet der Maler Hofschen insbesondere zwei Zustände eines Bildes oder die verschiedenen Entwicklungsstufen eines Bildes. Das Bild entsteht durch das Sichtbarmachen des Unterscheidens verschiedener Entwicklungsstufen des Bildes selbst. Hofschen nimmt hierzu eine ungrundierte Leinwand, trägt auf der Rückseite durchschimmernde Formen auf, dreht das Bild um, und fängt nun, auf seine eigene Vorgabe von der Rückseite her antwortend, an, die Vorderseite zu bearbeiten. Dabei gibt er sich eine willkürliche Regel, nämlich: »Drehe das Bild nicht mehr um und bearbeite nicht mehr den Anfangszustand, nämlich die Rückseite.« Er antwortet also auf sich selbt, er unterscheidet sein Bild in einem späteren Stadium von einem früheren, das auf der Rückseite fixiert bleibt.
Wie wichtig das Unterscheiden ist, um Bedeutungen aufzubauen, demonstriert auch Kriesche mit seinem Video-Environment. Kriesche baut zwei Räume mit dem Rüken aneinander. Die Räume sind einander sehr ähnlich, d. h. in beide Räume führt rechts eine schmale Tür, und neben der Tür ist eine Kamera angebracht und im Raum sitzt, dem Betrachter zugewandt, je ein Mädchen auf einem Stuhl. Dasselbe Mädchen, offensichtlich von der Kamera aufgenommen, wird auch noch auf einem Fernsehschirm neben dem sitzenden Mädchen gezeigt. Nun gut, so weit, so wenig. Man geht um die Sache herum, sieht auf der anderen Seite genau dieselbe Konstellation. Plötzlich aber merkt man, daß das Mädchen auf dem Fernsehschirm sich bewegt hat, während das Mädchen, das man sitzend sieht, sich nicht bewegt hat. Es müsste sich also bei dem Mädchen auf dem Fernsehbild und bei dem Mädchen auf dem Stuhl um zwei verschiedene Personen handeln. Um das abzukürzen: Es handelt sich um von Natur aus in höchstem Maße ununterscheidbare Mädchen, nämlich eineiige Zwillinge. Jeder weiß, welchen Wert Zwillinge darauf legen, voneinander unterschieden zu werden; denn nur als voneinander Unterschiedene haben sie als Einzelwesen eine Bedeutung.
Mit dem Problem des Unterscheidens von etwas in hohem Maße Ununterscheidbarem beschäftigt sich auch Jasper Johns in seinem neuen, auf der documenta gezeigten Bild. Was ist das ununterscheidbare daran? Ein Beispiel aus Ihrer Schulzeit; da drückte Ihnen der Lehrer einen Stempel in die Hand und sagte: »Nun stempel mal und mach mit dem Stempel ein Bild.« Sie haben sich sicherlich gefragt, ja, wie soll denn ein Bild entstehen, wenn ich nur immer dasselbe Ununterscheidbare wiederholen? Johns zeigt, wie man das macht. Er verwendet einen Winkel als Grundelement, wie Sie Ihren Stempel, und führt nun eine Methode ein, die Ihn dazu führt, beim Wiederholen des immer Gleichen zu etwas anderem, nämlich Unterscheidbarem zu kommen. Diese Methode ist die Spiegelung. Das ganze Bild baut sich aus Spiegelungen immer derselben Elemente auf. Es gibt eine Hauptspiegelungsachse, und um diese Mitte ist das Ganze dreimal, viermal gespiegelt. Die ganze Bildeinheit ist dann nochmal von der linken auf die Rechte Seite gespiegelt. Das Wiederholen des immer Gleichen unter Verwendung einer bestimmten Methode – hier der Spiegelung – führt zu einem Bild, das in sich sehr wohl unterscheidbar ist.
Soweit Beispiele dafür, wie Künstler unterscheiden als Voraussetzung dafür, das Bedeutungen aufgebaut werden können. Damit ist aber noch nicht gesagt, warum wir überhaupt unterscheiden können.
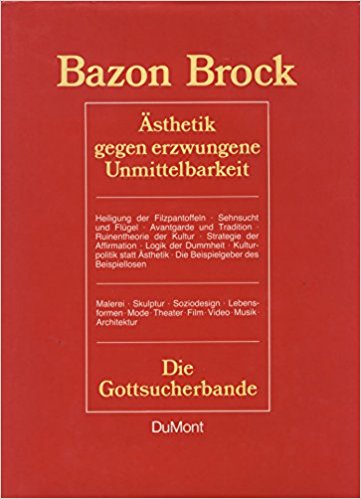 + 1 Bild
+ 1 Bild