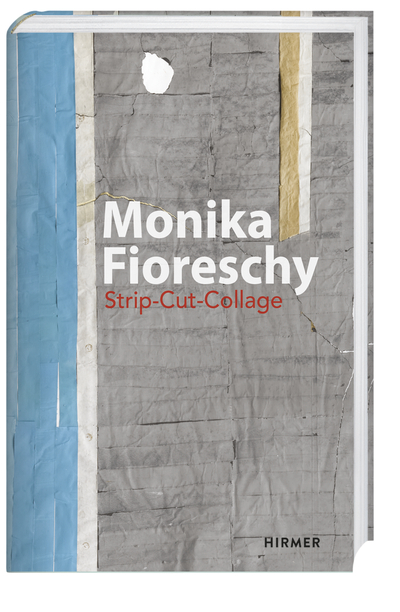Bazon Brock »Stunde der Kunst« St. Bonifaz, München 12.11.1996
Die Werkgruppe von Monika Fioreschy hat in der alten Apsis der Kirche St. Bonifaz einen Ausstellungsort erhalten, der den Arbeiten die Rückendeckung 1400-jähriger benediktinischer Tradition und einer noch älteren Architekturformel gewährt: Ursprünglich diente die gemauerte Rundung einer Basilika, der »Halle des Herrn«, dem Richter oder Konsul als repräsentativer Sitz und hielt ihm den Rücken frei gegenüber andringenden Klienten. Heute soll die apsidiale Hintergrundformation die Werke vor den andringenden Erwartungen des Kunstpublikums schützen.
Schon der Patron St. Bonifaz, in die Geschichtsbücher eingegangen unter dem Namen »Apostel der Deutschen«, hatte einen schweren Stand, als er die Germanen von ihren heidnischen Vorstellungen zu befreien und dem Götzendienst ein Ende zu machen versuchte. Nichts anderes haben wir heute im Sinn, denn jeder Ausstellungsbesucher wird schnell bemerken, dass man von Kunstwerken meist wieder wie von alten Götzen redet und sich ihnen auch genauso unterwirft, wie man sich früher Idolen unterwürfig genähert hat. Heute heißen diese Idole »Kunstwerke«. Damit wird immerhin ein Reizbegriff vorgegeben, auf den man überhaupt noch reagiert, während man genuine Kultbilder kaum mehr beachtet.
Rund 1200 Jahre nach Bonifazius gilt es also wieder, sich vom Götzendienst zu befreien, nun vom Götzendienst an der Kunst. Rund 1500 Jahre nach der Begründung der Klostergemeinschaften durch den hI. Benedikt und seine Schwester Scholastika heißt die Formel immer noch »beten und arbeiten«, eine Einheit, die sich auch heutigen Bethäusern noch ablesen lässt, selbst wenn sie wie Fabrikationswerkstätten oder Kriegsbunker aussehen: Es ist dann eben die Einheit von beten und schießen, beten und produzieren. Etwa 600 Jahre nach Bonifazius begannen die Künstler, eigene Theorien zu entwickeln. Ihr Vokabular, mit dem sie ihre Arbeiten beschrieben, entnahmen sie fast ausnahmslos der Theologie. Daran hat sich bis heute nichts geändert, und so gibt es immer noch keine säkularen Künste, im Gegenteil: Mehr denn je wird der geradezu fundamentalistische Anspruch auf Verehrung der Kunstwerke erhoben. Unüberbietbar bleibt jedoch die Anmaßung eines Mannes wie Albrecht Dürer, der sich um 1500 selbst als Christus porträtiert hat, der für sich als Künstler die Nachfolge Christi reklamierte. Nicht einmal der Gekreuzigte mit Gasmaske, dessen zeichnerische Darstellung George Grosz einen Prozess wegen Gotteslästerung einbrachte, war auch nur annähernd so skandalös wie Dürers Selbstbildnis.
Zu den wichtigsten aus der Theologie übernommenen Formulierungen gehört der Begriff des »Schöpferischen« bzw. des »Kreativen«, der natürlich am christlichen Schöpfergott, dem creator mundi orientiert ist. Zwar bezogen die Künstler ihre Anregungen aus den Kontexten des Alltagslebens, wie es früher auch die stigmatisierten Priester, die Wasser predigten und Wein soffen, getan hatten, jedoch waren die Kulturexperten, Kunstinterpreten und Bildexegeten späterhin hochmütig genug, sich zu wahren Verwaltern der Schöpfungstheologie aufzuschwingen. Kunstkritiker und -historiker wurden nicht einmal schamrot, wenn sie das bisschen Farbe-auf-Leinwand-Bringen als große Kreation, als großen schöpferischen Entwurf in Analogie zur göttlichen Welterschaffung auswiesen.
[Diese Arroganz haben sich nicht einmal Hitler, Mussolini oder Stalin zuschulden kommen lassen, zumindest nicht als Politiker, wohl aber als Künstler, die sie alle sein wollten: Hitler als Maler und Architekt, Stalin als Gedichteschreiber und Grammatiker, Mussolini als Kulturessayist. Sie mussten schon Künstler sein, um diese Anmaßung für sich unbeschadet in Anspruch nehmen zu können.]*
Das Bedeutendste an dieser Geschichte ist, dass die Künstler selbst vermutlich gar nicht gemerkt haben, wie sie zum Gründungsakt ihrer eigenen Art von »beten und arbeiten« beitrugen, indem sie die Nachfolge des Schöpfergottes antraten und wie dieser völlig voraussetzungslos, nur aus dem eigenen Mutwillen heraus, ihre Werke schufen. Dieser Umstand ist so einmalig in der Geistesgeschichte der letzten 2000 Jahre – die Bilderkriege des 8. oder der Universalienstreit des 12. und 13. Jahrhunderts sind nichts dagegen –, weil auch das Publikum tatsächlich glaubte, sich von den Götzen in aufgeklärter Weise gerade abzuwenden. Tatsächlich aber ist nur das Lokal der Anbetung ein anderes geworden: Früher war es die Kirche, heute ist es das Museum. Was man als alten Spuk von zurückgebliebenen »Geiseln der Pfaffen« ablehnte, wird in den weltlichen Ausstellungsräumen vollzogen.
Die Präsentation von Kunstwerken in einer Kirche stellt genau die Verbindung zu einem Ort her, an dem die ursprüngliche Begründungstheologie für künstlerisches Arbeiten entwickelt worden ist. Die Einsicht in diese Zusammenhänge kann aber nur darauf hinauslaufen, dass wir alle, die wahnsinnigen Glaubensgeschüttelten, Erlösungssüchtigen, heilserwartenden Paulusse der Kunst endlich wieder zu Saulussen werden. Denn die für unsere Zeit bedeutendsten Gläubigen sind gerade die vom Paulus zum Saulus gewandelten, weil sie ihre Erfahrungen hinter sich haben, weil sie wissen, was auf dem Spiel stand und steht.
Dies gilt nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Ereignisgeschichte: 1989 brach das System des Sozialismus zusammen. Viele, die noch als Führer missionierender Heerscharen oder Politpropagatoren durch die Gegend galoppierten, merkten durchaus, wie sie ihre Funktionärsmacht verloren, wie in wenigen Wochen alles vorbei sein würde. Sich in einer solchen Situation noch rasch vom Saulus zum Paulus zu bekehren, ist kein Kunststück. Aber den umgekehrten Weg zu gehen – zumal wenn man als Künstler begnadet ist, wenn das schöpferische Tun direkt aus der Natur auf das Papier fließt, weil man mit den Händen denken und mit den Fingern sehen kann – das ist wirklich eine Leistung.
Monika Fioreschy hat diese Leistung vollbracht und sich selbst auf den Status eines Saulus zurückbefördert. Sie befreite sich aus der erpresserischen Vorgabe, man habe es bei ihrer Arbeit mit Kunst zu tun, vor der man betend niederknien müsse. Sie hat sich bewusst aus dem Budenzauber und Blendwerk der ständigen Selbstreferenz der Werke auf- und untereinander verabschiedet. Fioreschy tut nichts anderes, als ein Stück hundsnormaler Arbeit vorzuführen. Jeder arbeitet, und hier gibt es nun die Möglichkeit, ein bestimmtes Arbeiten im Hinblick auf die Vorgaben zu qualifizieren, die sich aus dem kulturgeschichtlichen Kontext des Christentums bzw. speziell der Benediktiner herausbilden. Die Benediktiner waren seit jeher der bedeutendste Orden für die Entwicklung von Künsten und Wissenschaften in Bezug auf die Institutionsgeschichte der Kirche, wie sie sich in den hier wahrnehmbaren Architekturformen materialisiert.
Aus dem römischen Profanbau hervorgegangen, war die Apsis zum Bestandteil sakraler Architektursprache geworden und wandelt sich nun wieder zurück, so wie sich auch die Kirche selbst in eine profane Einrichtung, in eine Institution des profanen Lebens gewandelt hat – ohne dadurch unbedeutender geworden zu sein! Kirche wird gerade darin bedeutend, dass sie es auf sich nimmt, das Normale, das Evidente, das Selbstverständliche zum Problem zu machen, anstatt zu behaupten, sie hätte höherenorts irgendwelche Missionen persönlich in die Tasche geschrieben bekommen und uns dies mit magischer Attitüde vorzuführen. Das macht die Kirchen zu bedeutenden Einrichtungen: die Kraft und der Mut, sich auf die alltäglichen Zumutungen einzulassen, um dem zu dienen, der nicht einfach wegfliegen oder sich in ideologischen Hokuspokus und irgendwelche Erzählungen flüchten kann. Die Kirchen säkularisieren sich, wie sich auch die Künstler säkularisieren, indem sie sich wieder auf das Maß des normalen Tuns eines Arbeiters zurückbringen und dadurch ihre Bedeutung erhalten.
Das offensichtliche Hauptmotiv der Arbeiten von Fioreschy stellt sich auch in einer anderen Hinsicht vor dem kulturgeschichtlichen Hintergrund von Kirche und Theologie dar: Es geht um Blut. Die Künstlerin hat nicht zuletzt durch biografische Zufälligkeiten Einblick in eine Disziplin gewonnen, die neben der Kunst zu einer weiteren »After-Kirche« der Moderne avanciert war, nämlich in die Medizin (ihr Mann ist Herzchirurg). Hier wurde klar, auf welche Weise der Heilsgeschichte auf die Sprünge geholfen wird, Heilung wurde durch Kurieren verheißen. Gerade Herzchirurgen betreiben da einen ungeheuren Aufwand!
Vergleichbar mit der Architektur einer Kirche, die den sichtbaren Rahmen schafft, um zu taufen, zu trauen oder sonntäglichen Gottesdienst zu feiern, werden im säkularen Raum des irdischen Heilungsgeschehens sichtbare Blutsubstanzen verwendet: Patienten werden mit diversen Kanülen an Maschinen angeschlossen, während der Heilungsvorgänge fließt Blut durch Transfusionsschläuche, um das Einblasen neuen Odems, das lebensschaffende Wirken des Chirurgen zu vergegenständlichen. Wie das künstlerische Selbstverständnis der Imitatio Christi erhält auch die Heilkunde ihre Dimensionen der Legitimation aus der kirchlichen Theologie. Beim Abendmahl etwa nehmen wir zur Kenntnis: »Dies ist mein Blut«. Für viele Menschen ist das heute immer noch nicht – oder nicht mehr – versteh- und nachvollziehbar. In einem Operationssaal wird aber klargemacht, was das eigentlich heißt: Wer als Patient einen hohen Blutverlust erlitten hat, bekommt Blut gespendet von denjenigen, die sich in Rot-Kreuz-Stationen hinlegen und sagen: »Hier, nimm mein Blut.« Dies ist eine Art von Konkretisierung, Säkularisierung, Veralltäglichung der großen Worte Christi. Daran hat sicher niemand gedacht, bevor es Bluttransfusionen gab. Das Bedeutende an solchen Worten besteht aber gerade darin, dass sie – uneingeschränkt durch das jeweils konkret Gegebene – Gültigkeit in den verschiedensten Anwendungsbereichen des physischen oder psychischen Lebens von Menschen haben können. Es stellt demnach auch keine Entwürdigung dar, wenn man heute in der Herzchirurgie den Sinn von »dies ist mein Blut« vermittelt bekommt.
Fioreschy hat nun eine große Anzahl von Schläuchen aus den heilgeschichtlichen Kontexten der Kliniken gesammelt und miteinander verwebt, eine Technik, die sie zuvor als Künstlerin im textilen Bereich erprobt hatte. Durch die Fixierung nebeneinandergeordneter blutgefüllter Schläuche entstehen gewebeartige Strukturen, neue Flächen, darunter Alloverstrukturen, also Formvorgaben, die das gesamte Wahrnehmungsfeld gleichmäßig ausfüllen, in denen man aber wiederum einzelne Details, Differenzierungen und Abschattungen sehen kann. Die Zustände der Rottönung oder Verblassung sind eine Konsequenz der Alterung des Blutes in den Schläuchen, je älter das Material ist, desto heller wird es. Derartige Unterscheidungen überhaupt treffen zu können, ist hilfreich, um sich im Gewebe der Welt orientieren zu können.
Die theologische Dimension in den Arbeiten von Fioreschy besteht darin, dass es ihr gelingt, eine Verbindung zwischen theologischer Argumentation im Hinblick auf »dies ist mein Blut« und unserer heutigen Alltagspraxis herzustellen, ohne die theologische Dimension zu mildern oder das künstlerische Tun als Dienst an der Kirche abzuwerten. Genau diese Übertragungsleistung ist es, was wir von Künstlern erwarten können, wenn wir sie nicht als Heilsbringer aus anderen Welten betrachten, sondern sie darüber befragen, was sich uns hier auf Erden in alltäglichen Problematiken erschließen lässt.
Wer sich von diesen Werken wieder abwendet und verstanden hat, dass hier jemand nicht als Künstler im Sinne theologischen Budenzaubers, nicht als schöpfergottanaloger creator ex nihilo, nicht als autonomes individuelles Subjekt auftritt, sondern als ein Mensch wie jeder andere, mit gewissen Schwierigkeiten, die herausfordernden historischen oder theologischen Positionen zu verknüpfen. Wer das verstanden hat, leistet genau das, was auch nur vom Künstler erwartet werden kann: die Erschließung eines klaren, deutlich definierten Problems mithilfe bestimmter Methoden.
So klar wie im Operationssaal, wo die übertragende Erhellung möglich wird, enthüllt sich hier die Schlussfolgerung aus der längst verschütteten, nur noch für spiritistische Minoritäten bedeutsamen Formulierung »dies ist mein Blut«. Es wird auf nichts verwiesen, was jenseits dieser konkreten Problematik erörterbar ist, es werden keine Ideologismen, künstlertheoretische Positionen oder ästhetische Fragestellungen vorgeblendet. Die Arbeiten stellen den simplen Versuch dar, ein Problem vorzuführen, eine Möglichkeit, etwas zu erschließen, was allen anderen schon höchst zwiespältig zu sein scheint oder bereits abhanden gekommen ist. Plötzlich wird das Bildersehen zu etwas völlig Selbstverständlichem wie Zeitungslesen, zu etwas völlig Normalem und Alltäglichem. Die Bilder haben die Kraft in dieser Banalität, jedem, der sie einmal gesehen hat, sofort einen gesamten theologischen Kontext auf einer heutigen säkularen Ebene zu eröffnen.
[Das Gegenbeispiel dazu liefert das Werk von Hermann Nitsch. Auch er hat zunächst versucht, durch eine Säkularisierung dieses theologischen Kontextes wirksam zu werden, indem er seine Aktionen »Theater« nannte, sie als Orgien-Mysterien erfasste und so sein eigenes künstlerisches Tun in den Rang bedeutsamen Rituals erhöhte. Er verschaffte sich eine Legitimation auf einem reflexiven Niveau, das er selbst nicht erreichen konnte. Mit seinem Mysterien-Orgien-Theater versicherte er sich der Herkunft sowohl aus der Tradition griechisch-eleusinischer als auch christlicher Mysterien. Über sein Herumschmeißen von Innereien lacht aber jeder Schlachtermeister. Das hemdsärmelige Wühlen im Blutschleim wurde als großartige Kunstleistung ausgegeben, entstanden aus geheimnisvoller Inspiriertheit, umweht vom Schauder des Erhabenen und der Faszination des Schreckens. Wenn man es als Künstler so macht, macht man es falsch, wenn nichts weiter gefragt wird, als dieses bisschen Gewerkel, landet man auf der Ebene einer Einladung zu Nachbar Müllers Orgien-Mysterien-Theater bei Apfelwein und Bratwürstchen.
Künstler wie Nitsch verführen das Publikum mit dieser Art von Nachfolgerschaft des Erlösers oder des Schöpfergottes, mit diesem Künstler-Hokuspokus, diesem Geniewahnsinn, diesen Omnipotenzfantasien von Kleinstkindern, die noch nicht erwachsen geworden sind. Oder diese Künstler sind umgekehrt Agenten einer Gesellschaft und von dieser gezwungen, die Rolle der begnadeten »Inspirenten« zu spielen, damit die Gesellschaft wieder vor Bildern auf die Knie gehen kann und endlich wieder etwas zum Anbeten hat.
Allerdings können auch Arbeiten wie die von Nitsch uns von den großen Kunstformen befreien, indem sie uns veranlassen zu sagen: »Jetzt reicht es aber, jetzt werde ich wieder zum Saulus, jetzt bewahre ich mir meinen Skeptizismus und versuche, zu analysieren, wie das Werk gemacht ist, anstatt es bloß gläubig anzunehmen.« In dieser Hinsicht hat Nitsch mit seinem Werk für uns alle eine große Bedeutung.]*
Die Arbeiten von Fioreschy sind ein Wahrnehmungsanlass, völlig ruhig, gelassen, unprätentiös, ohne Pathos – man steht davor und vermag eine unglaubliche Weite eines in diesem Falle theologisch-kulturhistorischen Horizonts in der heutigen Alltags- und Erlebniswelt zu thematisieren, und zwar auf genau dem Anspruchsniveau, das den Alltagserwartungen entspricht.
Das sollte ein Grundgedanke sein: das eigene Arbeiten, hier die Thematisierung von Heilsgeschehen in den beiden Dimensionen Kirche und Klinik, auf eine bestimmte Aufgabe auszurichten. In dieser Beschränkung liegt die Möglichkeit, die vielen Kunstpaulusse zu enttäuschen und durch die Enttäuschung aufzuklären. Das war seit jeher der Sinn von Täuschungen in der Kunst: durch Ent-Täuschung die Täuschung vorzuführen und für jedermann rational und emotional nachprüfbar zu machen [(siehe den wohlverstandenen Nitsch)]*.
Jeder kann sich in die Situation versetzen, in einer Kunst- und Wunderkammer der Klinik zu liegen, die Problematisierung wird dabei so normal wie überhaupt möglich, so umfassend wie überhaupt denkbar. Es ergeben sich dann auch keine Fragen mehr wie »Ist das Kunst oder ist es keine? Wenn es Kunst ist, warum ist es welche?«
Man sieht einfach hin und kann selbst in der Anerkennung der Problemstellung die Verbindung zwischen theologischen Zusammenhängen herstellen oder es bleiben lassen. Das ist schon alles. Genau das sollte im heutigen Training des Säkularisierens erreicht werden. Natürlich sind alle wahnsinnig darauf erpicht, die Überbleibsel der Kulturgeschichte, die sich nicht funktionalisieren lassen, zu säkularisieren, diejenigen, die am meisten darauf erpicht sind, nämlich die Politfunktionäre, Wissenschaftler und die sogenannten Experten denken aber gar nicht daran, sich selbst zu säkularisieren. Sie sprechen zwar davon, wie man Priester in den Staub treten oder die Kirche auf den Müllhaufen befördern müsste, aber nur um sich selbst als umso bedeutsamer zu inthronisieren.
Eine sinnvolle und vollständige Säkularisierung bedeutet jedoch, sich von den unangemessenen Erwartungen und rigiden Forderungen an die Künstler und ihr bisschen Werkeln auf dem Papier zu befreien, nur dann kann man auch endlich aufhören, das zu bejammern, was nicht gelingt. Es ist doch sonst zu peinlich, wenn selbst das vermeintlich Größte, zum Beispiel Herr Marx in Gestalt seiner Büsten oder Bilder von Georg Baselitz, zu bloßem Dekordesign verkommt. Diese Fallhöhen entstehen erst gar nicht, wenn man an die Künstler und ihre Tafelwerke keine Heilserwartungen großer Zauberkraft mehr stellt. Dazu muss man sich aus der Attitüde verabschieden, den Künstlern Impulse zu geben, noch wahnsinniger, noch selbstvergessener, noch omnipotenzfantastischer ihr Pinseln auszuweisen und zu etwas Magischem, Großartigem, Niedagewesenem zu überhöhen, das nur von winzig kleinen genialen Gruppen überhaupt realisiert werden kann. Die Frage »Und das soll Kunst sein?« kann gar nicht radikal genug gestellt werden angesichts der Säkularisierungsvorgänge, die darauf hinauslaufen, die Kunstwertkurse an der Börse höher zu notieren oder den Künstlern einen lexilkalischen Eintrag zu verschaffen.
Man muss sich noch viel saulushafter fragen, was die künstlerische Arbeit im Vergleich mit dem bedeutet, was alle anderen täglich tun. Aus den bekennerhaften Paulussen des großen einmaligen Gelingens müssen saulushafte Bekenner des Scheiterns werden, denn bekanntlich lernen Menschen sowieso nur aus dem Scheitern, das Gelingen spielt keine Rolle. Die Erfahrungen des Scheiterns, der Ohnmacht, des Versagens, der Nichterfüllbarkeit von Erwartungen macht nämlich jeder.
Das Scheitern ist auch für Künstler die einzige Form des Gelingens, und die ganze Kunstgeschichte der Moderne ist, wenn man sie richtig betrachtet, nichts anderes als eine Demonstration dieses Sachverhalts. Damit sind wir dann auch wieder bei der Theologie, denn diese Formulierung könnte in leichter Veränderung in jeder Sonntagspredigt verwendet werden, im Sinne einer für jeden verständlichen Rede innerhalb einer bestimmten gemeinsamen Erfahrung als Christen.
Dies war auch der Grundgedanke der Reihe »Stunde der Kunst« 1996 in der St.-Bonifaz-Gemeinde. Mit Monika Fioreschys Kunstwerken als Basis wurden verschiedene aktuelle Positionen von Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zentrale Begrifflichkeiten aus der Künstlertheorie gegenübergestellt und dabei bedeutende Gedankenformen der Theologie wiederentdeckt.
Die Verbindung zwischen diesen Standpunkten kann so hergestellt werden, wie man mit dem Transfusionsschlauch die Verbindung zwischen Organismus und Hilfsquelle herstellt. Nun sagen ja viele Menschen, dass ihnen vor großen Kunstwerken das »Herz stehen bleibe«: Gerade dann bedürfen sie solcher Schläuche, solcher Bypässe. Mit der Veranstaltungsreihe legen wir also für Menschen, die unter Kunsthochdruck leiden, ein paar entlastende Bypässe, damit sie unbeschadet auf das Niveau eines vernünftigen, skeptischen Saulus zurückkommen können, damit sie die Künstler gerade daraufhin befragen können, wie das nicht gelingt, was wir ihnen zumuten, wie es nicht gelingt, ein Offenbarungsgenie zu sein oder sich in der Imitatio Christi zu fühlen, wie es nicht gelingt, eine große Geste der Weltschöpfung in einmaliger Könnerschaft aufs Tapet zu legen. Wenn die Künstler zeigen, wie dies nicht gelingt, sind sie lehrreich, und sie können es auch sein, weil auf ihrer Ebene zu scheitern keine irreversiblen Folgen hat. Wenn aber der Herzchirurg scheitert, hat es irreversible Folgen, der Patient stirbt. Deswegen können wir seine Profession oder die des Politikers oder des Therapeuten oder des Ingenieurs nicht in gleicher Weise für die Beispielhaftigkeit vom Scheitern als Form des Gelingens verwenden. Die Ausübenden dieser Professionen müssen vielmehr ständig auf Gelingen und Erreichen von Vollendung ausgerichtet sein. Dabei sind sie meist selbst die distanziertesten Skeptiker und die größten Zyniker, und sie müssen es wohl auch sein, weil sie sonst dem Druck der ständigen Forderung nach Perfektion, nach der Imitatio Christi, nach dem gottgleichen Schöpfen nicht standhalten würden, denn sie können auch nur leisten, was menschenmöglich ist.
Kunst ist eben deswegen so leistungsfähig, weil die Demonstration vom Scheitern als Form des Gelingens ohne Schädigung für Dritte, ohne tödlichen Ausgang für die Klienten möglich ist.
Zuerst veröffentlicht in: Monika Fioreschy, Stunde der Kunst, München 1997