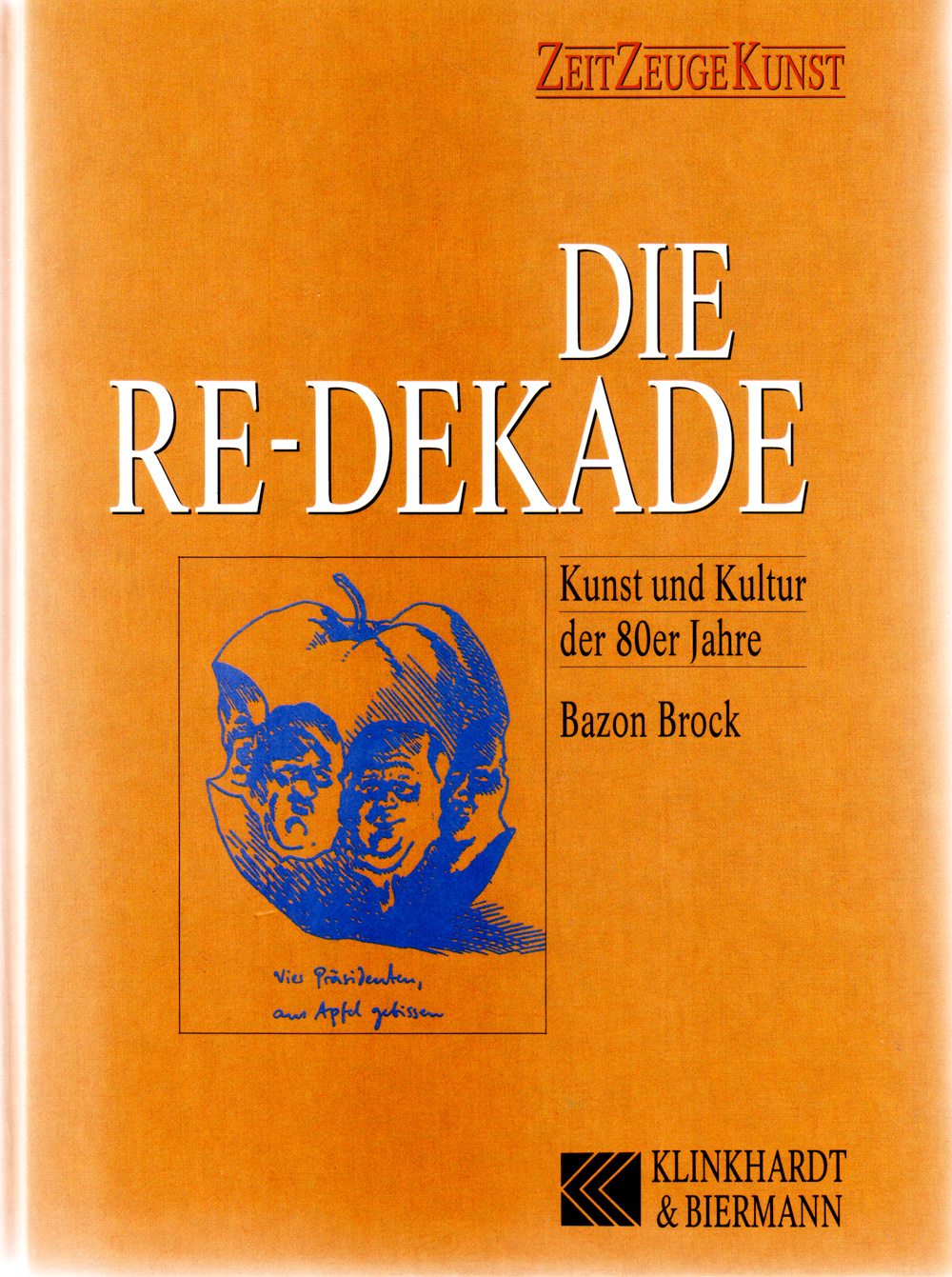Bei jedem Ereignis in der Stadt bewältigt der Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung seine Lachsportaufgabe: Er zählt in Galerien und Museen, Theatern und Aktionszentren die Studenten und Professoren der Universität, die sich bereit gefunden haben, an einem Ereignis teilzunehmen, das sie in ihren Lehrveranstaltungen als Ausdruck des gesellschaftlichen, speziell kulturellen, Lebens einer Gemeinschaft so nachdrücklich zu analysieren und zu werten verstehen. Ahnt man's, weiß man's? Selbst aus der Arbeiterschaft des lokalen Automobilwerks erschienen dieses Mal wie jedes Mal mehr Interessierte als aus allen Fachbereichen der Universität zusammengenommen. Selbst Hauptfachstudenten der Kunstgeschichte verirren sich nur zufällig in Kunstausstellungen, von denen die Presse und die eigene Anschauung berichten, daß die Räume dem Andrang nicht gewachsen sind und man vor lauter Besuchern die ausgehängten Werke nicht mehr zu sehen vermag.
Heißt das, diese Studenten und Professoren seien als Kulturprofis derart überfüttert, daß sie Termine außerhalb ihrer eigenen Veranstaltungen nicht mehr wahrnehmen können? Schön wär's, aber dem ist nicht so; denn die Kulturveranstaltungen innerhalb der Universität werden ebenso wenig von den Studenten und Professoren besucht wie die Veranstaltungen außerhalb der Universität. Von eigener Initiative kann schon gar keine Rede sein; denn die Vorlesungen, Seminare und Übungen selbst als kulturelle Ereignisse auffassen zu wollen, ist beim besten Willen nicht möglich.
Warum wurde die Universität als Hüterin der Kultur zu dem sozialen Ort, der am wenigsten von kulturellen Formen des Lebens geprägt ist? Warum zerfiel gerade in der Universität das Repertoire kultureller Haltungen und Einstellungen und sinnvoller Rituale soweit, daß selbst durchschnittliche Firmen dagegen als vergleichsweise lebendige Lebens- und Arbeitsgemeinschaften erscheinen? Die Universität verlor auch noch den mattesten Abglanz einer kulturellen Aura, weil das Leben und Arbeiten ihrer Mitglieder in Räume und soziale Verkehrsformen gepreßt wurde, die an architektonischer Sprachlosigkeit, dumpfer Unmittelbarkeit und Gleichgültigkeit der Gestaltung und Einrichtung kaum zu unterbieten sind. Selbst Fachbereiche, die dem Studium des Zusammenhangs zwischen materialer Gestaltung und Lebensumgebung und entsprechendem sozialen Verhalten ihre Arbeit widmen, Fachbereiche der Architektur, des Design, der Musik und der Künste, hausen in Behältnissen, die als geist- und seelentötend bewertet werden müßten, wenn Studenten und Professoren sie in gleicher Weise zum Gegenstand ihres Interesses machen würden wie die Massenpferche des Bauherrenfunktionalismus.
Zu den Bausünden in den inhumanen Neubaustadtteilen wissen sie Bewegendes zu sagen; sie dienen sich an, kreativ und innovativ zu allen Gestaltungsaufgaben aller Objektbereiche des außeruniversitären Lebens Entscheidendes beitragen zu können, ohne zu merken, daß keine Aufgabe für sie so dringend wäre wie die kreative und innovative gestalterische Intervention in der Universität selbst.
Daran hinderten hochgezüchtete Verwaltungsvorschriften? Der Geist der Bürokratie? Wenn das auch ein Grund wäre; alle anderen außeruniversitären Institutionen und Firmen müssen mit diesen Hindernissen ebenfalls fertig werden und werden mit ihnen auch weit besser fertig als die Universitäten.
Der Kosmetikkonzern L’ORÉAL prägt die Mondrian-Linie nicht nur seinem Styling von Creme-Tuben auf. Arbeitsstätten und Lebensformen der Firmenmitarbeiter werden von solchem Anspruch ebenso geprägt wie deren Verhaltens- und Erscheinungsformen. Keiner der brauchbaren Vorschläge zur Besserung und Humanisierung unserer Lebenswelt, sollten sie von Mitarbeitern der Universität entwickelt worden sein, hat sich je auf die Universität als Lebenswelt ausgewirkt. Daraus erklärt sich zu einem guten Teil die unleugbare Kulturferne und Kulturvergessenheit der Universität. (35)
Was kann schon aus Studenten werden, die im Studium tagtäglich erfahren, wie wenig offensichtlich all das bedeutet, was in Vorlesungen und Seminaren hochmögend entwickelt und entworfen wird? Die seelisch Widerstandsfähigen werden alles daran setzen, die Universität als Ort der ausgemachten Barbarei so schnell wie möglich zu verlassen, um in den Genuß firmeneigener Ausbildung zu gelangen. Aber die Zahl kraftvoller Selbstbehaupter ist unter den Studenten sehr gering. Sie deckt sich mit der Zahl der Hochbegabten, für die es ohnehin gleichgültig ist, wie und wo sie arbeiten, ob sie initiative und Position beziehende Professoren haben oder von leeren Langweilern beziehungsweise von schauspielernden Karriereakrobaten bedient werden.
Kein Ende, keine Veränderung, keine Aussicht? Jeder Manager weiß, daß seine Firma nur in dem Maße produktiv zu werden vermag, in dem deren Mitarbeiter sich als Repräsentanten gemeinsam vertretener überindividueller Ziele ins Spiel zu bringen wissen. Die Universität ist die älteste soziale Institution, die auf solcher Gemeinschaft (der Societas eruditorum) gründete. Die Gelehrtenrepublik ist deshalb ein Beispiel für alle Gemeinschaftsbildungen. Ihre Verpflichtung auf Wahrheit besagte nichts anderes, als daß jede Gemeinschaft auf einer verpflichtenden Ethik beruht und die lautete: Akzeptiere keine Aussagen, von welchem Status auch immer, unter die der Aussagende nicht selber sich zu subsumieren bereit ist. Diese fundamentale Ethik haben die Angehörigen der Universität vornehmlich unter dem Eindruck des großen „Erfolgs“ technischer Anwendung von Forschung verloren beziehungsweise aufgeben müssen. Wie sonst hätte man sich bereit finden können, für andere den Tod im Giftgas oder durch atomare Strahlung erfinden zu können? Diese Entwicklungen haben sich ja auf allen Gebieten nicht einfach als Konsequenz absichtsloser Grundlagenforschung ergeben, sondern sind gewollt worden, und wer dergleichen, sei es auch bloß als Planung von Wohnsilos, will, gehört nicht mehr zur Republik der Gelehrten.
Wenn dergleichen Gelehrte aber aus der Universitätengemeinschaft nicht unmißverständlich entlassen werden, korrumpieren sie, wie historisch so folgenreich geschehen, die universitäre Gemeinschaft. In diesem Falle ist der Verfall der Institution Universität auf die Korruption ihrer Mitglieder zurückzuführen.
Wenn man heute dieser Institution ihre weitgehende Monopolstellung für die Verleihung akademischer und berufsqualifizierender Zertifikate nehmen würde, ohne sonst irgendetwas zu ändern, bräche das scheinbar so unverzichtbare Gebilde sang- und klanglos in sich zusammen. Non scuola sed vitae, ja eben. Gerade, wenn wir nicht für das Examen und die damit verbundenen Lebenschancen, sondern für die Bewältigung der Lebensaufgaben studieren, dann müßte das heißen, an den Universitäten das Leben in Gemeinschaften einzuüben, die gemeinsamen Aufgaben und Verpflichtungen beispielhaft zu bewältigen. Die Universitäten hätten sich solchen Gemeinschaften zu verpflichten mit einem Wissensbekenntnis, das im Unterschied zu den Glaubensbekenntnissen, erst recht zu den fundamentalistischen Glaubensbekenntnissen, die Vorläufigkeit, ja die Haltlosigkeit aller Aussagenansprüche zum Fundament der Weisheit macht. Im Brustton geoffenbarter Endgültigkeit zu leben, ist kein Kunststück. Um ein Kunststück aber zu vollbringen, ist die universitäre Gemeinschaft entstanden: wie können wir miteinander leben, wenn das einzig Verläßliche der unnachgiebige Zweifel ist, wenn der einzige Beweis der Zurechnungsfähigkeit in der Kraft zur Kritik besteht und wenn die einzig brauchbare Expertenfähigkeit darauf hinausläuft, überall dort Probleme zu sehen, wo sich andere auf Glauben und Hoffnung verlassen wollen.
Die Wahrheit ist, daß es in unserer Gesellschaft kein Bedürfnis nach einer solchen Institution gibt, aber nach der Universität, wie sie jetzt besteht, erst recht nicht; denn deren Aufgaben würde längst eine IBM-, eine Mercedes-, eine Henkel-Universität weit besser erfüllen und auch noch unter humaneren und geist- und seelenstimulierenderen Bedingungen. Wir müssen die Möglichkeit kritisch in Betracht ziehen, daß sich die Universität, ähnlich wie die mönchische Klostergemeinschaft, als nicht mehr zeitgemäße soziale Institution erweist, daß die Universitäten zu öffentlich finanzierten Außenstellen der Konzerne werden, daß die Professoren die Ateliers, Labors und Seminare als bloße Erweiterungen ihrer Privatwohnungen betrachten. Wer diese Gegebenheiten nicht zu akzeptieren bereit ist, weil er ahnt, daß den außeruniversitären Gemeinschaften schlußendlich die gleichen Problemkonstellationen wieder erwachsen werden, muß bis auf weiteres das Stigma ertragen, eine atavistische Kuriosität, ein Störenfried, ein Besserwisser, ein Unnahbarer zu sein. Aber niemand ist für Gemeinschaftsbildungen derart geeignet wie kuriose Abweichungspersönlichkeiten, herausragende Positionsbekenner und kreative Sonderlinge; denn solche Persönlichkeiten fürchten sich nicht vor ihresgleichen, anerkennen überlegen „Witz“. Den, genau den, brauchen wir, um als Mitglieder einer kraftvollen universitären Gemeinschaft zu überleben und ein Beispiel zu geben, das für andere erst die Zukunft ausmacht.
Wie könnte diese Gemeinschaft ihre Kraft und ihre Glaubwürdigkeit wiedergewinnen? Vor allem dadurch, daß sie die Verantwortung für ihr Tun übernimmt. Die Wissenschaft muß „frei“ sein – daß sie damit aber auch frei von aller Verantwortung ist, sagt weder Artikel 5 des Grundgesetzes noch irgendeine andere Festschreibung dieser historischen Errungenschaft. Wo selbst Privateigentum, insbesondere als „freie“ Verfügung über Kapital, sozialpflichtig zu sein hat, sollte das für die freien Wissenschaften genauso gelten. Werden die Grenzen dieser Freiheit erst von der Anwendung der Resultate freier Forschung gezogen? Bisher waren Grundlagenforscher nur selten auch Anwender ihrer Ergebnisse; deswegen fühlten sie sich für die technische Umsetzung ihrer Ergebnisse nicht verantwortlich. Dennoch verstanden sie technische Anwendung als eine abgeleitete Funktion, die fast ausschließlich von Fragen der Praktikabilität bestimmt war. Alle Beteiligten haben sich die Rechtfertigung ihres Verständnisses der Beziehung von freier Forschung einerseits sowie deren Anwendung andererseits herzlich einfach gemacht; sie meinten, der freie Forscher- und Schöpfergeist wehe nun einmal, wohin er wolle, mochten andere sehen, was sie damit anfangen konnten; und sie konnten. Mit dieser Art Anwendung von Wissenschaft scheint es aber nun langsam zu Ende zu gehen. Dafür haben selbst die nicht fachspezifisch interessierten Bürger ein Gespür. Sie fragen sich aus gegebenem Anlaß, ob zum Beispiel Atomkraftwerke als Resultat der angewandten Atomphysik deshalb weiter zu rechtfertigen seien, weil der Bau solcher Anlagen wissenschaftlich kein Problem darstelle. Ist aber tatsächlich die Übertragung von wissenschaftlich noch so gut abgesicherten Konstruktionen vom Papier in Stahl und Beton kein wissenschaftliches Problem? Ist angewandte Wissenschaft keine Wissenschaft, dann wäre praktizierte Liebe keine Liebe. Schwerlich wird jemand über die Liebe frei wissenschaftlich spekulieren, ohne sie je als Qualität der Beziehung zwischen Menschen erfahren zu haben. Die Kennzeichnung derartiger Spekulationen als Wissenschaft ändert an ihrem Wesen gar nichts, nur die Durchsetzung ihres Geltungsanspruches ist eine andere als im praktischen Leben. Das jedenfalls behaupten die Wissenschaftler, obwohl in ihre Auseinandersetzungen ganz wissenschaftsferne Vorurteile und Haltungen eingehen. Wissenschaft als reine Gedankenarbeit von aller Verantwortung für die Konsequenzen dieses Denkens abzukoppeln, hieße, das Betreiben von Wissenschaft für bedingungslos zu halten. Gerade die Naturwissenschaften klagen aber ständig bei der Gesellschaft Bedingungen für ihr Arbeiten ein (zumeist als Forschungsetats), ohne die sie Wissenschaft überhaupt nicht betreiben könnten.
Seit die freie Wissenschaft, um überhaupt arbeiten zu können, von der Gewährung entsprechender finanzieller und institutioneller Rahmenbedingungen abhängig ist, hat sich das Beharren auf einem derart hypostasierten Begriff der Freiheit von Wissenschaft und Forschung in ein ideologisches Versatzstück verwandelt. Die Wissenschaftler und Künstler riskieren ihre Glaubwürdigkeit, wo sie es sich erlauben, über die tatsächlichen Bedingungen ihres Arbeitens so großzügig hinwegzusehen. Niemand wird den freien Wissenschaftlern vorwerfen, die nun einmal unabdingbaren Voraussetzungen ihres Arbeitens einzufordern; kritische Einwände sind aber begründet, wenn die Beteiligten diese Bedingungen ideologisch verbrämen. Das gilt auch für die Geldgeber, die Stiftungen, die Wirtschaft und die staatlichen Verwaltungen der Forschungsetats. Auch ihnen ist nicht vorzuwerfen, daß sie ihre Mittel an die Wissenschaft mit wie auch immer gearteten Erwartungen vergeben. Kritische Einwände sind aber auch gegen sie zu erheben, wenn sie davor zurückscheuen, ihre Erwartungen klipp und klar als solche zu formulieren, anstatt zu behaupten, die Gewährung der Mittel diene ausschließlich der Erhaltung der Freiheit der Wissenschaften und Künste.
Es ist auffällig, daß in den seit etwa 25 Jahren entwickelten Wissenschaftstheorien zwar der Logik der Forschung mit beachtlichem Erfolg nachgespürt wurde, eine entsprechende Logik der Anwendung aber kaum ins Blickfeld geriet. Nicht einmal die Politik-, die Wirtschafts- und die Sozialwissenschaften haben, obwohl sie in die politische Tagesarbeit wie auch in die Gesetzgebung hochgradig integriert sind, eine Logik ihrer eigenen Anwendung auf das Leben von Menschen konzipiert. Es ist als historisches Faktum bemerkenswert, daß vornehmlich im Bereich der Künste und in der Pädagogik seit etwa 100 Jahren (besonders aber in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts) grundsätzlich und auch umfassend Fragen der Anwendung von Künsten erörtert worden sind (Stichworte zur historischen Debatte: Lebensreformbewegung, Siedlungsbau, Schönheit der Arbeit, Kunst als Therapie, soziales Engagement, Kultur durch alle, Rezeptionsästhetik, Ästhetik in der Alltagswelt). Selbst die scheinbar von der Anwendungsproblematik nicht betroffenen Entwicklungen der abstrakten Kunst, vor allem der absoluten Malerei, entstanden, wie jüngste Forschungen zeigen, in beachtlichem Umfang aus der Konfrontation mit der Anwendungsproblematik. Aus der Debatte innerhalb der Künste lassen sich für eine allgemeine Logik der Anwendung vier Kriterien hervorheben, denen die Anwendung von freien Wissenschaften und Künsten zu genügen hat:
1.
Das RATIONALITÄTSGEBOT, demzufolge alle einzelnen Produktentwicklungen in übergeordneten Gesichtspunkten zu rechtfertigen sind. Seit man weiß, daß Probleme nur durch Schaffung neuer Probleme „gelöst“ werden können, hat man sich zu fragen, ob die durch eine Problemlösung geschaffenen neuen Probleme kleiner oder größer sind als das Ausgangsproblem. Man entspricht dem Rationalitätsgebot nicht, wenn man zum Beispiel mit der Entwicklung leistungsfähiger Waschmittel den Schmutz nur aus dem Haushalt in die Gewässer verlagert, wo die Rückstände der Waschmittel zu neutralisieren ein größeres Problem aufwirft, als es die Verwandlung von bloß sauberer in „reine“ Wäsche mit umweltverträglichen Mitteln darstellt.
Als übergeordnete Gesichtspunkte im Rahmen des Rationalitätsgebots werden heute überall anerkannt: die Sicherung der ökologischen Basis, die Vermeidung von Kontraproduktivität, die Vermeidung des Ernstfalls in Machtfragen und in den Fragen der Bewältigung der Lebensanstrengung von Mitgliedern eines Sozialverbandes.
2.
Das FUNKTIONALlTÄTSGEBOT, demzufolge Produkte aller Art tatsächlich zu halten haben, was sie versprechen. In erstaunlichem Umfang ist das gerade bei Produkten der gehobenen Preisklassen gegenwärtig nicht der Fall, weshalb man sich nicht zu wundern hat, daß die allgemein anerkannte Haftungsverpflichtung der Hersteller in beängstigendem Umfang vor Gerichten eingeklagt wird.
3.
Das QUALlTÄTSGEBOT, demzufolge alle zivilisationstechnisch entwickelten Bestandteile menschlicher Lebensumgebungen Auswirkungen auf die psychische und physische Befindlichkeit der Menschen haben. Das Qualitätsgebot fordert gewisse Minima an Gestaltqualitäten unserer Umwelt ein, wenn die Nebenwirkungen der zivilisationstechnischen Gestaltung der Umwelt sich nicht zerstörerisch, zum Beispiel krankmachend, auf Menschen auswirken sollen. Die Gestaltqualität bezieht sich auf die unleugbaren Wirkungen von zivilisationstechnisch erzeugten Gegebenheiten in der Welt. Insoweit Menschen ihre Beziehung zueinander gerade auch durch den Gebrauch solcher Produkte vermitteln, gehen von diesen Produkten auch einschneidende Folgen für das Sozialgefüge aus.
4.
Das MORALGEBOT, demzufolge Behaupter von Aussagenansprüchen sich nicht selber von der Geltung ihrer Behauptung ausnehmen dürfen. Architekten, die in Bürgervillen der Gründerzeit Silos für den sozialen Wohnungsbau entwerfen, genügen dem Moralgebot nicht. Es bleibt aber zu betonen, daß die Erfüllung des Moralgebots ohne die Erfüllung des Rationalitäts-, Funktionalitäts- und Qualitätsgebots nicht für eine Selbstrechtfertigung hinreicht. Der Direktor eines chemischen Großbetriebs kann sich nicht gegen entsprechende Kritik von Seiten der Ökologen damit selbst entlasten, daß er wahrheitsgemäß darauf hinweist, er selber wie seine Familie konsumierten das gleiche Trinkwasser aus Uferfiltrat des Rheins wie alle diejenigen, die die Qualität dieses durch Industrien verschmutzten Wassers beanstanden.
Aus der Logik der Anwendung ergibt sich, daß die einzelnen zivilisationstechnischen Produkte mit ihren Folgen für die Nutzer mindestens diesen vier eben skizzierten Kriterien zugleich genügen müssen.
• (35) Karla Fohrbeck: Universität als Heimat, Bd. 1 u. 2, Schriftenreihe des BBW, Bonn 1986.