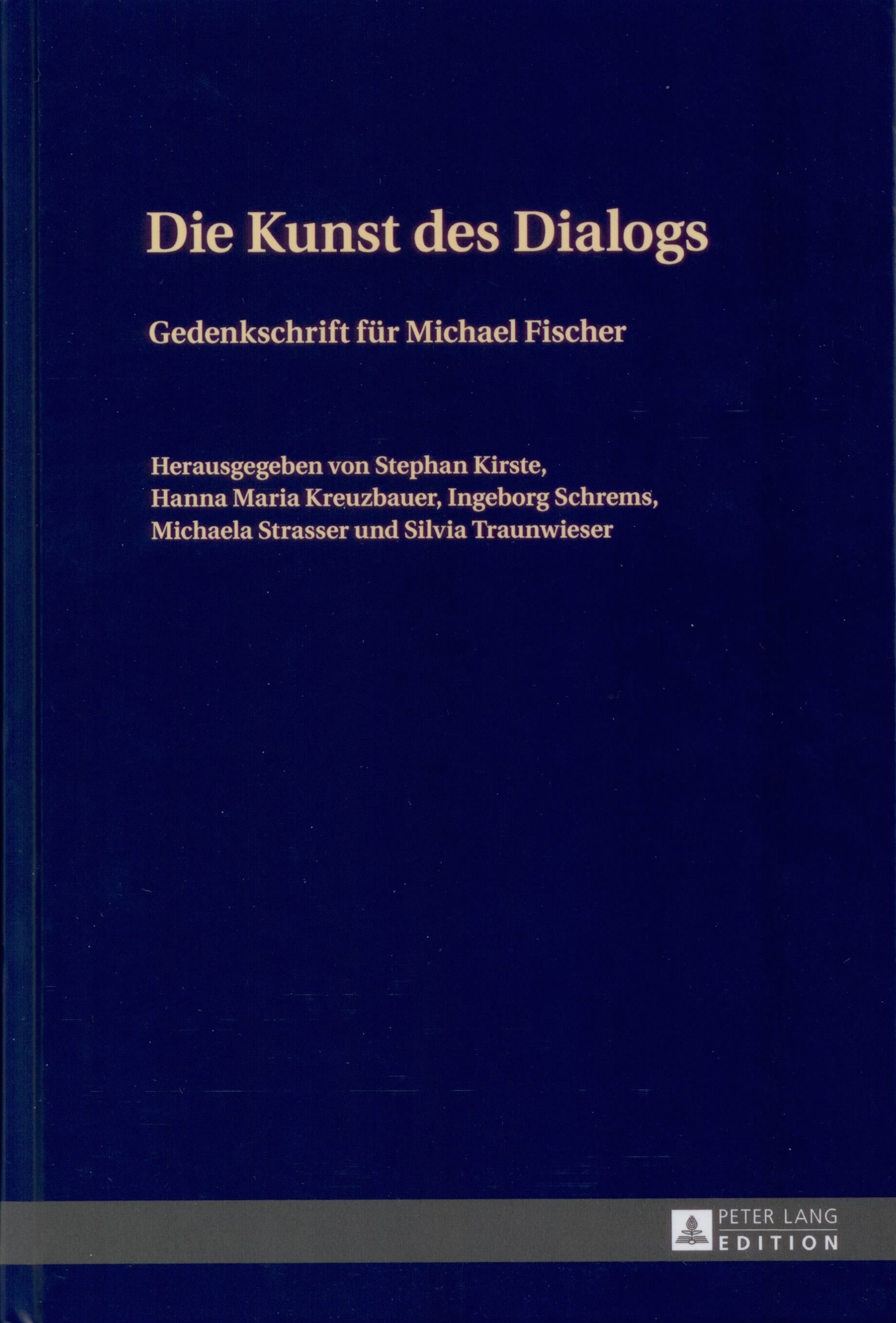Einheit durch Verschiedenheit. Gegen Einheit durch Verschiedenheit (1)
Einleitend möchte ich zur Darstellung der konstitutiven Selbstverpflichtung von Michael Fischer einen weiteren Aspekt beitragen. Es ist die selbstverständliche Annahme, dass wir in gleicher Weise mit den Toten reden wie mit den Lebenden. Das geht allein aus der Bearbeitung von Literatur hervor, denn die meisten Autoren, auf die wir uns beziehen, repräsentieren längst das Reich der Toten. Ich habe das mit Fischer sehr eingehend erörtert.
Die Frage ist ja, auf welche Weise wir die Realpräsenz der Toten in unseren Dialogen unter Lebenden erfahren. Der Dialog ist in Wahrheit ein Trialog, also ausgerichtet auf einen Adressaten. Erst diese Adressaten, das Publikum, die Öffentlichkeit, vermitteln den Dialog, indem sie ihm Intention geben. Die Relation zwischen Zweien kann nur in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit geführt werden. Beide Dialogpartner verpflichten sich auf die Ernsthaftigkeit ihrer Haltungen, indem sie diese Haltungen der Öffentlichkeit gegenüber demonstrieren. Der wunderbare Gadamer hat uns immer wieder in Erinnerung gerufen, dass die Griechen etwa unter dem Begriff des Schönen das fassten, womit man sich in der Öffentlichkeit sehen lassen kann. Hässlich ist das, was im Verborgenen bleibt, also das Licht der Öffentlichkeit scheut.
Europa hat diese Form der Vermittlung im Wesentlichen schon sehr früh im Theater zu lernen begonnen. Auf der Scena, auf der Bühne sprechen ja Akteure zueinander im Bewusstsein, dass sie jetzt vor der Öffentlichkeit sprechen. Und das Publikum als Repräsentant der Öffentlichkeit erhält seit Euripides die Funktion eines Jurors über das Gelingen der theatralischen Präsentation, nämlich Mythen, Historien, gewesene Könige, Philosophen etc. in der Gegenwart des Publikums, der Gemeinschaft der Lebenden sprechen zu lassen. Also: Die Anwesenheit der Öffentlichkeit als Publikum bezeugt, dass auf der Bühne die Realpräsenz der Toten gelungen ist. Auferstehung von den Toten meint, in der Öffentlichkeit die Kommunikation der Lebenden mit der entscheidenden Dimension zu versehen, dass sie erst dann bemerkenswert, lehrhaft und allgemein förderlich wird, wenn man sie im Bewusstsein führt, schon in der Vergangenheit von morgen zu sprechen.
Ob das nun zum ersten Mal im fünften vorchristlichen Jahrhundert durchexerziert worden ist, sagen wir von Euripides, vielleicht von Sophokles, oder erst im Konzept von Shakespeare entscheidend wurde, sei dahingestellt. Für Shakespeare war es ausdrücklich eine große Herausforderung, tote Könige als lebende, auf der Bühne, in der allumsichtigen Scena des Globe Theatre sprechen zu lassen. Er gibt dafür eine anspruchsvolle Begründung: Es ist nicht selbstverständlich, einen Schauspieler einfach in der Rolle eines Richard II. über die Bühne laufen zu lassen und ihm zu sagen: „Auf Dich kommt es jetzt an, den Toten als Lebenden zu präsentieren.“ Nicht nur die christliche Theologie widerstand der Anmaßung des Theaters, die Auferstehung von den Toten als allabendliches Realereignis zu bieten; auch die jeweilige politische Machtkonstellation im Kampf zwischen Elisabeth I. und den Parteigängern der Stuarts verlangte genauestes Kalkül der politischen Vernunft. Shakespeare wie seine Kollegen Dramatiker riskierten, der Subversion bezichtigt zu werden, wenn sie etwa solche Toten verlebendigten, deren historische Aktivitäten in den Konflikten der Gegenwart Gewicht gewännen, und damit Partei zu ergreifen.
Der Dialog mit den Toten übertrifft eigentlich in unserer Kulturgeschichte bei weitem den Dialog mit den Lebenden. Und Dialog meint tatsächlich die Technik, in der das Vergangene zur Realpräsenz wird, weil in der Vergegenwärtigung auf der Bühne gezeigt wird, dass das Vergangene das ist, was nicht vergeht. Das ist nicht naiv, wie etwa noch bei Augustinus, dessen Zeitverständnis einen kontinuierlichen Fluss der Zeit aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft ausmacht oder, im Wohlverständnis des lebenden Augustinus-Lesers, den kontinuierlichen Zeitfluss aus der Zukunft über die Gegenwart in die Vergangenheit fortstreben sieht. Die Zeit kommt demnach aus der Zukunft auf uns zu, wie ein Sturm auf dem Meer gegen ein Schifflein von Lebenden trifft. Die dem Zeitensturm Ausgesetzten können kraft ihrer Kooperation den Widerstand gegen die Naturmächte der Zeit bemeistern, indem sie lernen, gegen den Sturm zu kreuzen und so den Weg zum gesteckten Ziel zu erreichen. Aufs Allgemeine übertragen heißt das, Menschen vermögen gegen die Zeit als „Furie des Verschwindens“ Bleibendes zu behaupten, ja triumphal das Postulat der Ewigkeit zu setzen. Ich verstehe alle unsere Überlegungen (wie bei diesem Anlass des Gedenkens an Fischer) als eine Anleitung, gegen den Sturm aus der Zukunft zu kreuzen, gegen die zerstörerische Kraft des Vergessens oder des Machtopportunismus Bleibendes zu behaupten in Museen, in Bibliotheken, in Archiven, die vom Academos als Wächter im Tempel der zeitlosen Dauer gehütet werden.
Für unsere Gespräche war die Tatsache grundlegend, dass ab Mai 1987 mehr Menschen leben, als je zuvor gelebt haben. Dadurch verschieben sich alle Fragestellungen unserer Kulturgeschichte. Man versteht eigentlich gar nicht mehr, was historisches Denken und Operieren ist, weil der Triumph der gegenwärtig Lebenden das für unerheblich erklärt. Der jeweils aktuelle Überlebenskampf behauptet, Not kenne kein Gebot, also auch keine Verpflichtung auf das Leben der Gelebthabenden, die Leistungen früherer Kulturen und das Welt- und Gottesverständnis, die ganz offensichtlich die Geschichte bis zum gegenwärtigen Augenblick vorangebracht haben.
Die Niedertracht oder der Nihilismus, der die Allmacht der Lebenden gegenüber den Toten für selbstverständlich hält, kommt ja in der höhnischen oder zynischen Erklärung zur Geltung, man arbeite ganz im Sinne der humanistischen Totenverehrung, indem man das Reich der Toten mit möglichst vielen neuen Exemplaren bestücke. Allein im 20. Jahrhundert wurden 70 Millionen Menschen gewaltsam ins Reich der Toten überführt – mit humanistischer Lizenz und nicht als Verpflichtung auf die Toten. Alles Gerede über die Märtyrer, denen die Mordenden angeblich Ehre und Kränze winden, zerstäubt in der nächsten Attacke auf die Ruinen, die die vorangegangene erzeugte.
In diesem Sinne unübertroffen ist nicht nur der heutige Islamische Staat (IS), sondern bereits der große Europäer Napoleon, der lächelnd erklärte, die Hunderttausende, die er in einer Schlacht opfere, würden ihm in ein paar Pariser Nächten von willigen Paaren ersetzt. Napoleons europäischer Fundamentalismus rechtfertigte sich mit dem Argument, dass er die Unwilligen, Widerständigen eben ins Reich der Toten befördern müsse, um den Überleben- den den Code Civil schmackhaft zu machen. Schon Friedrich Schlegel meinte, dass der Code Civil neben Goethes „Wilhelm Meister“ und Fichtes „Wissenschaftslehre“ die größte Manifestation des europäischen Zeitalters sei. Leider vergaß er zu berücksichtigen, dass zum Code Civil eben die napoleonischen Mördereien gehören, zu Fichte der blutige Nationalismus, den er bestenfalls unfreiwillig gefordert hat, und zu Goethe die Verachtung des jeweils gegenwärtigen Überlebenskampfes, Goethe war ja ein „Genie der Zeitablehnung“ (so Gottfried von Berlin).
Dichter wie Conrad Ferdinand Meyer konnten noch pathetisch verkünden:
Chor der Toten
Wir Toten, wir Toten sind grössere Heere
Als ihr auf der Erde, als ihr auf dem Meere!
Wir pflügten das Feld mit geduldigen Taten,
Ihr schwinget die Sicheln und schneidet die Saaten,
Und was wir vollendet und was wir begonnen,
Das füllt noch dort oben die rauschenden Bronnen,
Und all unser Lieben und Hassen und Hadern,
Das klopft noch dort oben in sterblichen Adern,
Und was wir an gültigen Sätzen gefunden,
Dran bleibt aller irdische Wandel gebunden,
Und unsere Töne, Gebilde, Gedichte
Erkämpfen den Lorbeer im strahlenden Lichte,
Wir suchen noch immer die menschlichen Ziele –
Drum ehret und opfert! Denn unser sind viele! (2)
Wie gesagt, das Ehren und Opfern wird inzwischen kulturideologieübergreifend weltweit als wohlgefällige Vergrößerung der Nation der Toten angesehen. Aber das Ethos des massenhaften Tötens hat nicht hingereicht, um die Zahl der Toten über die der Lebenden hinauszutreiben. Der Mai 1987, da hat Fischer lebhaft zugestimmt, sollte zum höchsten Feiertag aller auf Geschichtlichkeit ausgerichteten Disziplinen werden. Denn seit die UNESCO damals verkündete, dass die Toten von nun an eine Minderheit in der Menschheitsgeschichte darstellen, müssen alle Kulturwissenschaftler, Historiker, Archäologen, Kunstwissenschaftler zu Lobbyisten der Toten werden, die in den Parlamenten versuchen, den Gesetzgeber auf den Respekt vor den Toten zu verpflichten, indem man Museen, Archive, Bibliotheken und vor allem die mit ihnen arbeitenden universitär Lehrenden zu fördern habe. Bisher gab es nur eine Antwort auf dieses Ansinnen: Die jetzt lebenden acht Milliarden würden ja spätestens in 70 Jahren das Reich der Toten bevölkern, um das Gleichgewicht zwischen Lebenden und Toten wiederherzustellen.
Das hat dramatische Folgen, weil die Missachtung des Vergangenen, also dessen, was nicht vergeht – anders kann man Vergangenheit ja gar nicht würdigen – ökonomisch gefordert ist, denn der noch so soziale Kapitalismus lebt (mit Schumpeters Worten) nur durch Zerstörung als Voraussetzung dafür, etwas Neues zu schaffen. Schumpeter veröffentlichte das 1942. (3) Zur selben Zeit verfolgten in der Logik dieses Arguments die deutschen Stadtplaner um den Generalbaumeister Albert Speer das Konzept, die Zerstörung der altdeutschen Stadtlandschaften durch alliierte Bomber vornehmen zu lassen, womit Freiraum für ihre Zukunftsentwürfe entstünde.
Diese Haltung wurde schon im bürgerlichen Zeitalter als Logik des kapitalistischen Totalitarismus eingeübt. Bekanntlich werden Machtkonzepte am besten volkstümlich ausgedrückt, meinte Hermann Göring, weil der Sprachwitz, die Karikatur eine Art Anerkennung des Bespotteten darstelle. Die schöpferische Zerstörung wird im Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts in folgender Anekdote als längst anerkannt deutlich: Ein bildungswilliger venedigreisender Bauunternehmer beurteilt die Bedeutung der Paläste am Canale Grande danach, wieviel Mann seiner Firma in welcher Zeit benötigt würden, um den ganzen historischen Plunder abzureißen.
Solche Kalküle erschließen wahrhaft alle Bemühungen besagten Bürgertums, geläufig auf Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Deutsch den großen Leistungen des europäischen Kulturheroismus gerecht zu werden und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Sie führten jedoch nur zu Allmachtsanmaßung, Gedankenarmut, Phantasielosigkeit und Egoismus, mit denen die Herrschaften spätestens ab 1914 der totalen Zerstörung der angeblich heiligen Traditionen als Verpflichtung auf Modernität freudig zustimmten.
Wem sagen wir das? Wer kommt noch als Adressat für uns in Frage? Gott jedenfalls nicht, denn der hat zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Menschheit seine Schöpfung mutwillig ruiniert. Die zukünftigen Generationen auch nicht, denn deren Zukunft haben wir längst in ungeheuerlichen Anhäufungen von Schulden verfrühstückt. Wir leben ausdrücklich auf Kosten der Kommenden, indem wir die Menschen nach uns der Gestaltungsmacht bereits jetzt weitgehend beraubt haben.
Unter diesem Gesichtspunkt enfaltet sich Fischers Frage nach einem zukünftigen Europa mit noch größerer Dringlichkeit. Es gibt keine Zukunft, weil wir sie bereits in der Gegenwart vorweggenommen haben. Ein wahrhafter Sieg der Gegenwart über alle andere Zeit (Alexander Kluge). (4) Trauten wir uns ruchlosen Optimismus (Schopenhauer und Nietzsche) zu, dann könnten wir ewige Gegenwart behaupten mit dem Argument, dass jede Zukunftsannahme immer nur die von Lebenden sein kann, also von Gegenwärtigen; desgleichen, dass alle Vergangenheit ja nur für diejenigen reale Größe wird, die sich auf sie agierend beziehen. Das aber heißt, dass Gegenwart nichts anderes ist als die Vereinigung von Vergangenheit und Zukunft in der faktischen Arbeit an der Welt durch die jeweils Lebenden.
Was hieße unter diesen Vorgaben Michael Fischers Programm „Europa NEU denken“? (5) Welchen Beitrag liefern Archäologie, Ästhetik, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Philosophie, Rechtswissenschaft für genau diese Aufforderung? „NEU denken“ ist nachgeordnet. Was also meint die behauptete Einheit „Europa“, als Einheit der vielen in Europa vorkommenden, bis auf den heutigen Tag sich als Nationalstaaten verstehenden politischen sozialen Entitäten?
Die Salzburgerin Nadia Koch (6) hat mir in ihren Schriften einen wunderbaren Beleg für meine Antworten gegeben. Sie verweist auf die Zweitausgabe von Johann Joachim Winckelmanns grundlegenden Schriften von 1762. Dort antwortet er nämlich auf die Frage, wie wir als Archäologen eigentlich zu einer Vorstellung von Einheit kommen, wenn wir es doch ständig mit einzelnen, völlig heterogenen Artefakten zu tun haben, die wir der Zeit bewahrenden Erde entnehmen? Er beschreibt das Verfahren der Archäologen als ein Versammeln der Vielzahl der Artefakte „in einem Raum“, was bedeutet, in einem Wahrnehmungshorizont. Heute heißt das, die Welt als räumliche Einheit, also als globale zu sehen.
Was aber geht über die räumliche Einheit hinaus als allen gemeinsame Auffassungen, Vorgehensweisen, Urteilsformen und Verfassungen des Selbstverständnisses, die wir zu Recht der globalen Einheit als Universalismus entgegensetzen? Die Antwort ist verblüffend einfach. Der Archäologe wie jeder auf Distinktion angewiesene Wissenschaftler oder allgemein Urteilende schafft die Einheit durch die Erkenntnis, dass die Sicherung der Eigentümlichkeit jedes einzelnen Artefakts ja nur dadurch möglich wird, dass man es in Beziehung zu den anderen Artefakten setzt. Diese Beziehungen mögen zeitlich oder sachlich oder sozial den verschiedensten Kulturen zuzuordnen sein – verschiedenen Epochen, in denen je unterschiedliche Entfaltungen kultureller Dynamiken beschreibbar sind –, immer bleibt unabdingbar, dass die je Einmaligkeit der behaupteten kulturellen Leistungen, repräsentiert durch die im Museum versammelten Artefakte, nur durch den Bezug der Artefakte aufeinander erfasst werden kann. Archäologen wie generell distinktionswissenschaftlich Arbeitende bestimmen die Einheit der Artefakte aus deren Verschiedenheit, denn die Verschiedenheit kann ja nur durch den Vergleich festgestellt werden. Der Vergleich erzwingt aber das Konzept der Einheit des Vergleichbaren.
Wir nennen dieses Verfahren „Musealisierung als Zivilisationsstrategie“. Zivilisierung deshalb, weil jenseits aller ethnischen, sprachlichen, religiösen und sonstigen Unterschiede der Kulturen für ihre Betrachtung mit Blick auf ihre Verschiedenheit eine transkulturelle oder Kulturen überspannende Sicht entwickelt werden muss. Und die nennen wir seit augusteischen Zeiten Zivilisation. Musealisierung ist also eine Strategie zur Entfaltung einer einheitlichen Sicht auf die verschiedenen Kulturen der verschiedenen Zeiten – repräsentiert durch die im Museum versammelten Artefakte!
Und das Entscheidende ist, dass diese transkulturelle Zivilisation der Einheit nur durch Würdigung der Verschiedenheit der Kulturen zustande kommt. Dieses Vorgehen der Musealisierung als Strategie zur Ausbildung einer Einheit des Verschiedenen widerspricht den gängigen Auffassungen von Einheit. Im amerikanischen Melting pot-Konzept zum Beispiel werden die verschiedenen Kulturen der Einwanderer programmatisch eingeschmolzen, um die Verschiedenheiten zu einer Einheit zusammenzuführen. Dieses Konzept ist gescheitert; allenthalben bildeten sich gerade in Amerika die zitadellenartig organisierten Parallelgesellschaften. Sie mit den Begriffen Germantown, Chinatown oder ähnlichem zu belegen, mag als touristische Erschließung ganz hübsch sein. Dem Alltag der Lebensanstrengung im Melting pot USA ist man als Einwanderer nur gewachsen, wenn man sich der Neuen Welt mit der Bildung einer Kolonie eine eigene Auswandererkultur schafft. Melting pot wurde zur bloßen Ideologie, das heißt, zur Vorspiegelung einer Verpflichtung auf die gleichen kulturellen Werte. Die morgendliche Einschwörung auf diese Werte mit der Hand auf dem Herzen mag soziale Realität im Militär werden, in der Organisation von Fabriken und Konsumtempeln. Für das Alltagsleben der meisten Einwanderer stellt sich so etwas wie ein Ankommen in Amerika als Aufnahme in dort bereits bestehende Kolonien der eigenen Kultur dar: Um diese „Heimat“ zu verteidigen, riskiert man sogar die Identifizierung mit kulturell-religiös verbrämten Banden, die auf extreme Exklusivität angewiesen sind wie Einheit der sprachlichen Prägung bis hin zum Dialekt, geteilte Herkunftsgesellschaften und -kulturen. Kurz und knapp: Das Konzept des Melting pot, „e pluribus unum“, aus der Vielheit eine Einheit zu schaffen, hat sich als unbrauchbar erwiesen.
Die Europäer hätten jetzt eine Chance, nach dem Vorbild der Distinktionswissenschaften ein neues Konzept der Einheit zu erproben, nämlich die Einheit durch Verschiedenheit. Wie man jedes Artefakt braucht, um dessen Verschiedenheit durch den Vergleich mit anderen zu bestimmen – also die Einheit der Distinktionskriterien herauszubilden, die hinreichen, um Verschiedenheit nicht nur zu beschreiben, sondern als wesentlich zu erkennen –, so muss man, um ein neues Europa zu denken, gerade auf der Verschiedenheit der europäischen Kulturen bestehen. Das allerdings setzt voraus, dass die Europäer ihre behauptete je kulturelle Einmaligkeit tatsächlich aus der kenntnisreichen Unterscheidung zu wenigstens drei benachbarten Kulturen in möglichst vielen Einzelheiten und zu den 30 anderen wenigstens in groben Zügen, und sei es durch die Sammlung folkloristisch-touristischer Merkmale, zu beherrschen. Eine offenbar peinliche Zumutung, weil die Kulturnationalisten und Kultursuprematisten bisher ihre je Einmaligkeit nur behauptet, aber nicht begründet haben. Denn zur Begründung der je Einmaligkeit gehört ja der unterscheidende Vergleich mit anderen Kulturen. In erster Linie müsste für das neu zu denkende Europa die Pflicht ausgerufen werden, beim Bestehen auf kultureller Identität die Behauptung des Unterschieds anderer kultureller Identitäten auszuweisen.
In gewisser Hinsicht kann man die transnationalen Sportveranstaltungen als simple Vorübungen für diese Identitätsbehauptung akzeptieren. Sportler unterscheiden sich in ihren Leistungen als Repräsentanten ihrer Kulturen/ Nationen durch Anerkennung der Geltung von gleichen Regeln für alle.
Das ursprünglich als abwertendes Unterscheidungsmerkmal gemeinte „Made in Germany“ stellte auch für den transnationalen Warenaustausch so etwas wie die technologische Identität der Kulturen dar. Die Eigendefinition, das heißt, das Bekenntnis zur Singularität etwa der deutschen Industriekultur ist eben leider nicht auf die Anerkennung der alle gemeinsam verpflichtenden ökonomischen Vernunft gestützt. Rechtfertigender Grund dafür ist häufig der Verweis darauf, dass im Zeitalter des Globalismus jede international/global agierende Firma keine Herkunftsbestimmung mehr anerkennen dürfe.
Die Realität sieht aber anders aus. Die kulturell-religiöse Identitätsbehauptung der verschiedenen Gesellschaften wird in der Werbung für die Produkte an erster Stelle zur Geltung gebracht. Immer noch soll der „Mercedes“ pars pro toto ein deutsches Produkt sein, obwohl in ihn sogar komplette Motoren aus fremder Produktion eingebaut werden. Die inzwischen gescheiterte himmlische Hochzeit der Giganten Daimler und General Motors glaubte den nationalen Suprematismus durch einen genau so dummen Internationalismus der Multinationalität zu übertrumpfen. Dumm? Man muss sich nur die Reden der Herren Schrempp, Esser, Sommer, Middelhoff, Breuer, Ackermann, Jain und tutti quanti anhören, um die Differenz zwischen dem idelogischen Geplapper der Großmanager und ihrem faktischen Leitungsversagen als Energie des Asozialen zu erkennen. Dabei nicht erwischt zu werden, erfordert schon mehr Intelligenz, als die masters of the universe bewiesen haben. Um erfolgreicher Mafiaboss zu werden, ist auf jeden Fall mehr soziale und kognitive Intelligenz gefragt als für die Karriere eines Managers in behauptet multinationalen Firmen. Das verlockendste Ziel bleibt natürlich, derartige Firmen wie Mafiagesellschaften zu führen.
Wie äußert sich eine solche Intelligenz? Als Befähigung von jedermann! Auch dafür können wir wieder auf das Theater als europäische Zivilisationsagentur zurückgreifen. Die Griechen nannten die auf den Rängen um die Scena sitzenden Zuschauer „Theoretiker“. Das Zuschauen ist ja in seiner intensiven Form des Erfassens der Bühnenvorgänge ein „sinnendes Betrachten“. Das aber führt zur Entwicklung eines sinnvollen Zusammenhangs der auf der Bühne in vielen kleinen Einzelepisoden von Auf- und Abtritten demonstrierten Vorgänge. Der Theoretiker, der Zuschauer sichert also den für ihn bedeutsamen Sinn des theatralischen Geschehens. Nicht das Bühnengeschehen selber bildet aus sich heraus ein Evidenzerleben, einen überzeugenden Sinnzusammenhang. Der Zuschauer muss selber in der sinnenden Betrachtung erfassen, warum er aus freien Stücken überhaupt ins Theater gegangen ist. Anwort: Man geht ins Theater, um als Repräsentant der Öffentlichkeit, als Zuschauer das Theoretisieren zu lernen. Wer zwei Stunden, vier Stunden und mehr in Häppchen eine lange, große Erzählung vorgesetzt bekommt, muss nicht nur über ein hinreichendes Gedächtnis verfügen, sondern die erinnerten Einzelheiten stundenlangen Bühnengeschehens zur Einheit der Erzählung zusammenfügen.
Genau diese Fähigkeit zum Theoretisieren ist die Voraussetzung für den Ausweis von kulturellen Identitäten, nicht nur der eigenen, die ja, wie gesagt, den vergleichenden Bezug auf andere voraussetzt. Insofern ist „Europa NEU zu denken“ ein Postulat, die Kraft des Theoretisierens und damit auch die Fähigkeit zur Bewsstseinsbildung durch Antizipation, durch Rechnen mit den Konsequenzen von Handlungen, die noch gar nicht eingetreten sind, aber eintreten könnten, zu stärken. Insofern sind wir herausgefordert, Europa als einen Möglichkeitsraum wie eine Bühne oder einen Hörsaal oder ein Labor zu verstehen, in dem die Wirklichkeit vollständig haltloser Identitätsbehauptungen mit den Möglichkeiten ihrer tatsächlichen Begründung abgeglichen werden kann.
Der Charakter der dafür notwendigen Regeln und Verfahren ist allen Europäern längst geläufig: Soweit sie Verkehrsteilnehmer sein wollen, müssen sie sich alle zivilisieren, indem sie die gleichen Verkehrsregeln anerkennen. Dadurch erst können sie antizipierend ihre sehr unterschiedlichen Ziele erreichen und die höchst differenten Motivationen zur Geltung bringen.
Die Prinzipien des Rechtsstaats sind solche Regeln für den interkulturellen Verkehr, für die Austauschprozesse der ganz unterschiedlichen religiös-kulturellen Weltsichten und Lebensformen. Erst durch die Anerkennung solcher universaler Werte wie Regeln und Verfahren, die für alle gelten, lässt sich gerade die erwünschte je Einmaligkeit ausbilden und mit Gründen durch die Anerkennung der notwendigerweise differenten Auffasungen der Nachbarkulturen behaupten.
Im Privaten hat jeder schon erlebt, wie überzeugend ein zurückgekehrter Reisender von fremden Ländern erzählt, weil er die Fremdheit in Relation zum Eigenen zu setzen versteht. Man respektiert solche Erzähler im Maße ihrer Begeisterung für das Fremde, weil sie dabei jederzeit die eigene Identität im Unterschied zum Erzählten zur Geltung bringen. Die Fähigkeit eines Niederländers, sich als solcher zu präsentieren, wenn er von Europa spricht, hängt davon ab, wie weit er belgische Flamen oder Franzosen oder Deutsche oder Briten in ihrem kulturellen Selbstverständnis zu würdigen versteht. Dem Erzähler wird in dem Maße eigene Würde der kulturellen Identität zugestanden, wie er die differenten Identitätsbehauptungen anderer Europäer zu würdigen versteht. Denn Würde hat nur, wer andere würdigen kann. Das sagt uns ein alltagsbrauchbares Verständnis des entsprechenden Grundsatzes unserer Verfassung.
Und Michael Fischer war in der Lage, mit Nachdruck und Begeisterung die vielen kulturellen Identitäten zu würdigen, die etwa durch die Salzburger Festspiele ins Spiel gebracht wurden. Er war wirklich in dem Maße ein großer Europäer, in dem er ein selbstbewusster Österreicher sein konnte. Was unter anderem auch heißt, auf die regionalen Differenzen aus behaupteter Eigentümlichkeit eingehen zu können. Sein Arbeitsfeld, die die Salzburger Festspiele begleitenden kulturgeschichtlichen Reflexionen, sollte unbedingt erhalten bleiben, um in seinem Sinne Europa neu zu denken.
(1) Vortrag bei: Die Kunst des Dialogs. Gedenktagung für Michael Fischer, 2. Juli 2015 in Salzburg. Panel 1: Kultur: Video abrufbar, retrieved 27.1.2016, from http://unitv.org/beitrag.asp?ID=596&Kat=1.
(2) Zeller, Hans / Zäch, Alfred (Hrsg.): Conrad Ferdinand Meyer. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, Bd. 1. Benteli-Verlag: Zürich 1963, S. 355 [Gedichte von 1892 / VIII. Genie].
(3) Cf. Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Einführung v. Eberhard K. Seifert. (UTB Uni-Taschenbücher Bd.172). 8., unveränd. Aufl. UTB: Stuttgart: 2005, 7. Kapitel „Der Prozeß der schöpferischen Zerstörung“, S. 134–142.
(4) Cf. Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, retrieved 4.2.2016, from http:// www.deutsches-filmhaus.de/filme_einzeln/k_kl_einzeln/kluge_alexander/angriff_ der_gegenwart.htm.
(5) Cf. Europa NEU denken, retrieved 4.2.2016, from http://www.europa-neu-denken.com.
(6) Koch, Nadia J.: Paradeigma. Die antike Kunstschriftstellerei als Grundlage der frühneuzeitlichen Kunsttheorie. (GRATIA – Tübinger Schriften zur Renaissanceforschung, Bd. 050). Harrassowitz: Wiesbaden 2013.
Quellenverzeichnis
Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, retrieved 4.2.2016, from http://www.deutsches-filmhaus.de/filme_einzeln/k_kl_einzeln/kluge_alexander/angriff_der_gegenwart.htm.
Die Kunst des Dialogs. Gedenktagung für Michael Fischer, 2. Juli 2015 in Salzburg. Panel 1: Kultur: Video abrufbar, retrieved 27.1.2016, from http://unitv.org/beitrag.asp?ID=596&Kat=1.
Europa NEU denken, retrieved 4.2.2016, from http://www.europa-neu-denken.com.
Koch, Nadia J.: Paradeigma. Die antike Kunstschriftstellerei als Grundlage der frühneuzeitlichen Kunsttheorie. (GRATIA – Tübinger Schriften zur Renaissanceforschung, Bd. 050). Harrassowitz: Wiesbaden 2013.
Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Einführung v. Eberhard K. Seifert. (UTB Uni-Taschenbücher Bd.172). 8., unveränd. Aufl. UTB: Stuttgart 2005, 7. Kapitel „Der Prozeß der schöpferischen Zerstörung“, S. 134–142.
Zeller, Hans / Zäch, Alfred (Hrsg.): Conrad Ferdinand Meyer. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, Bd. 1. Benteli-Verlag: Zürich 1963 [Gedichte von 1892 / VIII. Genie].