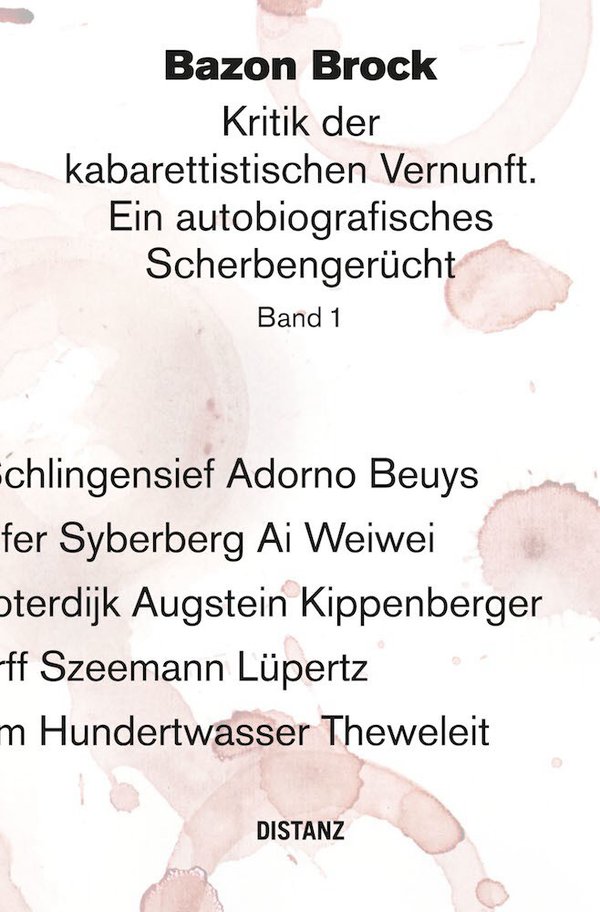BÖHMEN LIEGT AM MEER
Die letzte Phase der Kooperation Joseph Beuys und Bazon Brock beginnt mit meiner Berufung nach Wien im Sommer 1977. Die Stationen markiere ich mit den Stichworten: „Avantgarde und Tradition“, Ausstellung im Kunstmuseum Basel, Januar 1978; „Versuch der Etablierung von Beuys als Professor an der Hochschule für angewandte Kunst Wien sowie Aufbau einer akademischen Lehrsammlung Beuys nach dem Muster der Gipsantiken des 19. Jhd.“, ab 1978; Peggy und die anderen oder: Wer trägt die Avantgarde?, ein Film von Werner Nekes, 1980; „similia similibus. Festschrift zum 60. Geburtstag von Joseph Beuys“, 1981; „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, Ausstellung von Harald Szeemann im Kunsthaus Zürich, 1983.
BASEL
Im Sommer 1977 verabredeten Lucius und Annemarie Burckhardt ein Treffen zwischen Franz Meyer, dem damaligen Direktor des Kunstmuseums Basel, und mir. Ich bat um die Erlaubnis, in einer Ad hoc-Ausstellung in der großen Vorhalle im 1. Stock des Museums mein Konzept „Avantgarde ist nur das, was uns zwingt, die vermeintlich bekannten Traditionen mit völlig neuen Augen zu sehen“ vorzuführen. Dazu war es nötig, jeweils Werke der Avantgarde mit denen der angeblich bis zur Gleichgültigkeit, das heißt bis zur Redundanz abgewirtschafteten Werken der Tradition zu konfrontieren. Es sollten also unmittelbar nebeneinander Grünewalds früheste „Kreuzigung“ von 1505 mit Beuys‘ „Schneefall“ von 1970 gezeigt werden; oder etwa Bruce Naumans Skulptur „Aufbewahrungsgefäß für das rechte hintere Viertel meines Körpers“ von 1966 neben der Konstanzer „Verkündigung“ von 1490; oder Daniel Spoerris „Hodenschneider“ von 1972 neben Caravaggios „Johannes der Täufer“ von 1592; oder Baldessaris Schriftbild „Semi-Close-Up“ von 1967 neben Ruisdaels „Landschaft mit alter Kirche“ von 1650; oder Richard Tuttles Gemälde „Bow Shaped Light Blue“ von 1968 neben Heinrich Füsslis Gemälde „Nacktes Mädchen, einer Klavierspielerin zuhörend“ von 1775.
Meyer stimmte begeistert zu, nachdem ich ihm die Logik solcher Paarungen nähergebracht hatte, vor allem durch den Hinweis auf bedeutende Kunsthistoriker vor der Jahrhundertwende. Er stellte alle konservatorischen Bedenken hintan und bat seine Mitarbeiter um die technische Realisierung des Projekts. Erst im Januar 1978 war es dann so weit. Die Präsentationen erregten die kunstsinnigen Basler Gemüter, bis alle verstanden hatten, dass ich schlüssig zu zeigen vermochte, inwiefern die Avantgarden der jüngeren Moderne gerade keine prätentiösen Absetzbewegungen von jeweiligen Traditionen darstellten; vielmehr liegt die Bedeutung der Maxime „Man muss absolut und immer auf die Neuigkeit ausgerichtet sein“ generell darin, die jeweiligen Gegenwarten zu einem erneuernden Blick auf das Alte zu zwingen. (1)
Die zentrale Einheit der Basler Beweisführung – nämlich Grünewalds „Kreuzigung“ und Beuys’ „Schneefall“ – übernahm ich auch in den Film Peggy und die anderen oder: Wer trägt die Avantgarde?, wie ich weiter unten ausführen werde.
EXIL IN WIEN
Zu Beginn des Jahres 1976 war unabweislich gewiss geworden, dass Herbert von Buttlar von seiner Krebserkrankung nicht wieder genesen würde. Buttlar hatte von 1964 an 12 Jahre lang die Hochschule für Bildende Künste am Lerchenfeld in Hamburg geleitet – also während der Zeit ihrer größten Reputation. (2) Ich besuchte von Buttlar in Dornach, er hatte sich den Anthroposophen in der Hoffnung auf angemessene Begleitung auf dem Weg ins Jenseits anvertraut. Bei meiner zweiten Reise nach Dornach Ende Juli 1976 konnte ich nur noch an der Einäscherung des Verehrten teilnehmen.
In der Hochschule hatten sich schon über Monate drei Interessengruppierungen um die Wahl eines Nachfolgers in Position gebracht. Eine davon vertrat die Auffassung, dass ich mich ins Zeug legen sollte, um im Sinne des von mir erarbeiteten Konzepts für die documenta 5 eine Hochschule für Medien und Künste zu planen. Es galt, die verschiedensten medialen Praktiken in die Hochschule zu integrieren, sodass von den Neuen Medien her die Leistungen der etablierten Künste wie Malerei, Fotografie und Film in völlig neuer Weise gewürdigt werden konnten. Das entsprach der von mir entwickelten „Theorie der Avantgarde“. Aus der Umsetzung des Konzepts wurde nichts, wenn man davon absieht, dass Heinrich Klotz, dem ich seit Anfang der 70er Jahre (wie Martin Warnke) freundschaftlich nahestand, schließlich als der weitaus befähigtere Staatengründer mit dem Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, meine kühnsten Träume übertraf. In der Wahl zur Nachfolge von Buttlars unterlag ich dem SPD-treuen Volksschullehrer Vogel mit einer Stimme – selbstredend der der verstocktesten linken Dogmatiker. Vogel hatte sich den zukünftigen Künstlersstars mit Hinweis auf seine Fähigkeit empfohlen, Künstlern Jahresgaben für Kunstvereine abzukaufen. Diesem großartigen Versprechen auf Karriereförderung hatte ich nur meine Forderung nach erheblicher Steigerung des Arbeitseinsatzes von Professoren und Studenten entgegenzusetzen.
Die Stigmatisierung von Begründungspflicht für Aussagenansprüche von Künstlern, also die Stigmatisierung von Intellektualität im Bereich der Kunst, nahm mit Vogels Triumph der kumpelhaften Kunstsinnigkeit erheblich zu. Deshalb entschloss ich mich, trotz emphatischer Gegenrede des HfbK-Professors Franz Erhard Walther, umgehend die Hamburger Hochschule zu verlassen. Aber es schmerzt mich bis heute, dass ich nicht dazu beitragen konnte, den parteigestützten kulturadministrativen Niedergang der Hochschule abzuwehren, der bis 2002 andauerte. Für eine tragische Episode in der Geschichte dieses Niedergangs sorgte die Vogel-Nachfolgerin Adrienne Goehler. Sie war Abgeordnete der Grünen im Hamburger Stadtparlament. Wie in der Politik üblich, galt Ahnungslosigkeit als besondere Qualifizierung. Frau Goehler hatte nie irgendetwas mit den Angelegenheiten der Künstler, der Kunsthochschule, der Vermittleragenturen oder ähnlichem zu tun und wurde aufgrund dieser Unvoreingenommenheit prompt zur Präsidentin der Hochschule gemacht. Ihre Präsidentschaft erwies sich für mich als Debakel. Sie ließ es zu, dass die Seuchenpolizei die auf dem Dachboden der Hochschule gelagerten Kisten und Kästen, alte Arbeitsgeräte und Objektsammlungen in toto entsorgen durfte. Die größte der Kisten war versiegelt und mit von Buttlars Testaten dazu bestimmt, späteren Generationen frühestens zum 200. Todesjahr Hölderlins das Glück von philologisch-kulturgeschichtlichen Schatzsuchern zu bescheren. In die Kiste hatten wir alle wichtigen Korrespondenzen mit Künstlern von Gustav Seitz über Joseph Beuys bis Sigmar Polke gelegt, samt Arbeitsproben aller Genres. Durch Goehler und die Seuchenpolizei wurde also nichts aus der Absicht, kommenden Generationen Euphorien zu bereiten, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg noch Lehrergenerationen – unter ihnen der Hölderlin-Herausgeber Friedrich Beißner – auf Böden schwäbischer Häuslebesitzer erfahren konnten.
Die nächstbeste Gelegenheit zum Weggang von Hamburg bot die Wiener Hochschule für angewandte Kunst. In der Berufungskommission stellten vor allem Herbert Tasquil, Hans Hollein und Oswald Oberhuber ganz dezidierte Ansprüche an meinen zukünftigen Einsatz als Professor für Theorie der Gestaltung und Leiter einer kunstpädagogischen Klasse. Man erhoffte sich eine stärkere Orientierung auf das Kunstgeschehen in Deutschland – möglicherweise als Kompensation für eine sehr kritische Haltung gegenüber der Aktionistenszene in Wien. Immerhin hatte ich für die documenta 4, 5 und 6 als Konzeptionist und Vermittler, damals noch ein Modewort, einige Reputation erworben. Im Besonderen aber glaubte man, dass eine Reihe anderer Deutscher wie ich nach Wien übersiedeln würde, denen die Nebenwirkungen der RAF-Abwehr – wie zum Beispiel die Debatte um das Berufsverbot – zur großen Belastung geworden waren. Im Vergleich zum „Berufsverbotsdeutschland“ schien Österreich unter Bundeskanzler Bruno Kreisky geradezu einen Hort des liberalen Humanismus darzustellen.
Joseph Beuys war im Oktober 1972 aus der Düsseldorfer Kunstakademie entlassen worden und galt als skandalöses Opfer unnachsichtiger Herrschaft von Parteien über Staat und Gesellschaft. Sogar die angeblich alternativen Grünen verwehrten Beuys bereits während ihrer Etablierung jede Einflussnahme. Es lag durchaus nahe anzunehmen, dass Beuys ebenfalls ins Wiener Exil gehen könnte. Zu dem zentralen Motiv für die Emigration schrieb ich damals in einer Rechtfertigung:
„Ich glaubte, mit einem österreichischen Paß besser für Fluchten aller Art gerüstet zu sein (…); Versprechen, die durch Persönlichkeit und Amtsauffassung des Kanzlers Kreisky glaubwürdig gemacht wurden.“ (3)
Kreisky stand als Großeuropäer mit geistesgeschichtlicher Spannweite für das Shakespear‘sche Konzept aus seinem Wintermärchen, dessen zentraler poetischer Topos „Böhmen liegt am Meer“ bis auf den heutigen Tag alle Phantasien über Fluchtatolle bestimmt. Ende Januar 1983, während der von der Presse so genannten „Wiener Beuys-Tage“, führte der „heilige Joseph“ auch ein persönliches Gespräch mit Kreisky in dessen Amtszimmer. Zuvor hatte Beuys die Kommune seines alten Freundes Otto Muehl in Friedrichshof, Niederösterreich, besucht; am Abend eine der legendären Club 2 TV-Sendungen bestritten; und am nächsten Tag an einer Großdiskussion in der Hochschule für Angwandten Kunst teilgenommen. Dann absolvierte er nacheinander ein Kaffeehausgespräch sowie ein Interview mit Günther Nenning. In allen angeführten Aktivitäten war Beuys ganz und gar bei der Sache, ja enthusiastisch: Eine positivere Haltung gegenüber dem Fluchtatoll Österreich unter Kreisky ist kaum vorstellbar.
Darin, dass Beuys nach Wien kommen würde, bestärkte uns auch eine Erzählung, die sich wie ein Gerücht verbreitete: Beuys habe in Österreich seine Kriegsverletzungen ausheilen können und sei auf diese Weise dem Kulturraum verbunden.
In kürzester Zeit gelang es mit Hilfe der Ministerin für Kultur Firnberger, einer engen Kreisky-Vertrauten, und des sehr aktiven jungen Kulturpolitiker Erhard Busek Beuys 1979 eine Professur an der Angewandten anzubieten. Es blieb Beuys sogar überlassen, die Widmung der Professur und die Modalitäten seiner Lehrtätigkeit selbst zu bestimmen. Beuys zögerte, sich festzulegen, weil er gegen den Rausschmiss durch Johannes Rau Klage eingereicht hatte. Erst Ende 1980 war die Auseinandersetzung beendet: Beuys behielt das Recht, als Professor sein Atelier an der Düsseldorfer Akademie weiter zu betreiben, allerdings ohne offizielle Integration in den Lehrplan. Wäre der Einspruch von Beuys gegen seine Entlassung abgewiesen worden, hätte er sicherlich, so meinten wir alle, den Ruf nach Wien angenommen.
Bei seinen Aufenthalten in Wien hielt Beuys offizielle Vorlesungen, die auf größtmögliches Interesse stießen. Wir schlugen ihm vor, bis zu seiner endgültigen Entscheidung alles daran zu setzen, sich bei den Studenten in Wien präsent und wirksam zu halten. In meinen Augen wäre der Aufbau einer „Lehrsammlung Beuys“ dafür am Besten geeignet gewesen. Bei einem Mittagessen im „Prückl“ erörterten Beuys und Oberhuber den Vorschlag, eine „Ideensammlung Beuys“ aufzubauen, mit der dann auch Vorlesungen zu Beuys‘ Werk in seiner Abwesenheit hätten abgehalten werden können. Ich verwies die beiden Herren auf die im 19. Jahrhundert geläufigen Lehrsammlungen, die mehr als bloße Ideen, nämlich Objektrepräsentanz boten.
Die Organisation der Lehrsammlung sollte Oswald Oberhuber überlassen werden, der bereits als Nachfolger des Rektors Johannes Spalt angetreten und als „Motor“ der Beuys-Berufung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt war. Beuys hatte Oberhuber bei allen seinen Auftritten – auch denen außerhalb der Hochschule, also etwa in der Galerie Nächst St. Stephan oder in der Sezession – durch besonderes Entgegenkommen ausgezeichnet. Ich empfand das fast symbiotische Verhältnis zwischen Beuys und Oberhuber als beinahe gespenstisch und beobachtete es ein wenig eifersüchtig. Mir wurde aber bald klar, dass sich Oberhuber auf der rein künstlerischen Ebene fast wortlos mit Beuys verstand, während ich doch meinen Zugang zu den Artefakten und vor allem zu ihrem Ausdruckspotenzial über Begriffe vermittelte. Allerdings fiel gerade Beuys durch den jederzeitigen demonstrativen Gebrauch von Begriffen im Kunstdiskurs auf; aber das wurde häufig nur als kommunikative Geste verstanden – was zählte, blieb sein Gestaltungsvermögen.
Ein einschneidendes Erlebnis war die Erfahrung mit der Entstehung des Environments „Basisraum Nasse Wäsche“ 1979. Beuys gab Oberhuber verbal und mithilfe einer Zeichnung Anleitung, wie er das Ensemble bis zu seiner Rückkehr in der Galerie Nächst St. Stephan auszuführen habe. Beuys hatte sich zur Teilnahme an einer Gemeinschaftsausstellung mit Rainer und Roth in der Sezession verpflichtet und brauchte unbedingt ein großräumiges Werk. Zwar wusste ich angelesenerweise, dass eine ganze Reihe von Künstlern die Ausführung ihrer Werke anderen überlassen hatte – die Beispiele reichen von der Bodegapraxis der Florentiner Renaissancemeister über die Rubensmanufaktur bis zu Duchamp, der seine Werkaufträge telefonisch übermittelte, weil er sich auf standardisierte Kataloge der Farbenindustrie bezog. In Wien erlebte ich Derartiges zum ersten Mal in eigener Anschauung. Der große Beuys war höchst erfreut über das Arbeitsresultat von Oberhuber und machte nur noch einige Erweiterungsvorschläge z.B. zur Platzierung von Tisch und Stuhl. Er akzeptierte sogar, dass beim Aufbau des Ensembles in der Sezession eine Variante mit zwei Tischen und verschobenen räumlichen Zuordnungen durchgespielt wurde. Diese Erfahrung erhöhte meinen Respekt vor Oberhubers Fertigkeit, Beuyssche Anweisungen umzusetzen, erheblich. Sie schien mir die Garantie dafür zu sein, dass mein Vorschlag zur Etablierung einer „Lehrsammlung Beuys“ verwirklicht werden könnte.
Ich führte Beuys, als er uns in der Kulturscheune Godesberg besuchte, auch mit dem Professor für Archäologie, Alfons Silbermann, in der von ihm betreuten akademischen Lehrsammlung der Universität Bonn zusammen. Im 19. Jahrhundert bildeten derartige Lehrsammlungen, wie bereits erwähnt, geradezu das Rückgrat der kunstgeschichtlichen und archäologischen Ausbildung. Wir waren von der Bonner Sammlung so begeistert, dass wir beschlossen, in Bonn ein Action teaching, eine Lehrperformance, zu veranstalten und als Film den Studierenden in Wien zur Verfügung zu stellen. Ich entwarf die Performance, konnte aber Beuys nicht zu einem mehrtägigen Termin für die Produktion des Lehrfilms gewinnen. Er hatte schlicht keine Zeit. Ich führte das Stück schließlich in diversen Theatern und Museen u.a. in Bern, Berlin, Hamburg, Köln, Freiburg auf. Der WDR realisierte das Stück unter dem Titel „Selbsterregung – eine rhetorische Oper zur Erzwingung der Gefühle“ 1990 in besagter akademischer Lehrsammlung in Bonn.
DER GOLFSTROM
2011/2012 machte ich mich auf die Suche nach den Spuren meiner Wirkung in Wien 1977-1981 bzw. 1983 und 1987. Den Antrieb für die Recherche erhielt ich durch die von Peter Weibel initiierte Ausstellung „Beuys-Brock-Vostell“ im ZKM. Unter den vielen hier im Einzelnen nicht einschlägigen Memorabilia meines Lebens in Wien sind in diesem Zusammenhang jene von Interesse, die meine Parallelaktionen, Kooperationen und Konfrontationen mit Beuys betreffen. Zuerst sprach ich mit Oswald Oberhuber und seiner Frau, hatte aber das Gefühl, dass sie nach 25 Jahren räumlicher Distanz zwischen uns nicht geneigt waren, mich auf der Suche nach der verlorenen Zeit zu unterstützen bzw. mir Zugang zu ihren eigenen Dokumenten, die noch nicht in Katalogen veröffentlicht sind, zu gewähren. Ich wurde von ihnen in einem berühmten Lokal auf dem Lande köstlich bewirtet, aber darüberhinaus blieben sie stumm und ich unbelehrt. Das erschien mir einigermaßen erstaunlich, als ich doch mehrmals schriftliche Beiträge zu Veröffentlichungen über Oberhuber beigesteuert hatte und deshalb glaubte, dass sie meinem Ansinnen entsprechen würden. Auf Nachfrage bei Wiener Bekanntschaften hörte ich dann von gerichtlichen Auseinandersetzungen über die Rolle Oberhubers in der Wiener Beuys-Zeit. Da fiel der Name Julius Hummel, den ich nur einmal zuvor als Gast eines Kunstdisputes zu Beuys in Krems wahrgenommen hatte.
Ich wandte mich also an die Galerie Hummel in der Bäckerstraße und bat, mir bei meinen Nachforschungen zum eigenen Leben behilflich zu sein. Naturgemäß schilderte ich zunächst, wie ich auf ihn als graue Eminenz des Oberhuber-Rektorats gestoßen sei: Kurz nach der Übernahme des Rektorats begann Oberhuber, zu aller Erstaunen, eine Sammlung qualitativ bedeutsamer Werke ehemaliger Lehrer des Stubenring-Instituts anzulegen. Unter den Sammlungsstücken befanden sich sogar Inkunabeln des Wiener Jugendstils. Jeder fragte sich und ich fragte Oberhuber, wie er denn derartige Anschaffungen aus dem Etat der Hochschule oder einem relativ durchschnittlichen Gehalt finanzieren könne. Seine Erklärung, er verkaufe seine Beuys-Sammlung an den mir bis dato völlig unbekannten Julius Hummel, ließ mich vermuten, dass es sich bei dem Herrn um einen Großindustriellen vom Schlage Peter Ludwig handele. Mir waren aus der Beuys-Sammlung von Oberhuber vornehmlich drei Werkeinheiten erinnerbar, weil ich deren Zustandekommen unmittelbar hatte mitverfolgen können. Das war zum einen die oben schon erwähnte Arbeit „Basisraum Nasse Wäsche“ für die Sezession und zum anderen ein Ensemble, Tisch, Stuhl, Tafel, mit dem Beuys als Hieronymus im Gehäuse in der Galerie Nächst St. Stephan aktiv gewesen war. Zu dem Ensemble gehörte außerdem eine nackte Glühbirne in Messingfassung, die wie ein Himmelskörper die Szene beleuchtete. Die dritte Einheit bildete eine legendäre Konstellation aus fünf Objekten vom Dachboden der Hochschule mit dem Namen „Wärme / Fähre / Mensch“.
Hummel reagierte lebhaft auf meine Eröffnung. Er sagte mir, dass „Basisraum Nasse Wäsche“ ins Museum Ludwig in Wien übergegangen sei. Das Ensemble „Jungfrau, Tafel, Tisch, Stuhl“ habe Rosemarie Schwarzwälder, Direktorin der Galerie Nächst St. Stephan, an ihn verkauft und er habe das Ensemble einem amerikanischen Museum überlassen. Auf meine Frage, warum das Ensemble jetzt „Jungfrau“ und nicht mehr „Hieronymus im Gehäuse“ heiße, antwortete Hummel leicht amüsiert, der Grund dafür sei offenbar ein Doppelpack Seife auf der Tischfläche, wo ich früher Kreide gesehen zu haben glaubte. Dann überraschte mich Hummel mit der Aussage, das Ensemble „Wärme / Fähre / Mensch“ sei noch in seinem Besitz und zwar gleich hier nebenan in der märchenhaften, endlos verwinkelten Wiener Altstadtetage. Ich erhielt zunächst zur Stärkung vor der erwartbaren Überwältigung durch das Werk irgendetwas Alkoholisches, das ich aber kaum wahrnahm, dann durfte ich das Ensemble tatsächlich nach 33 Jahren wieder im Original betrachten.
Das Beuys-Werk, dem ich jetzt gegenüberstand, überbot meine Erinnerung bei Weitem; das Ganze war im Detail viel überzeugender und wirkmächtiger als es 1979 gewesen zu sein schien. Doch nach und nach konnte ich mir die Situation der Entstehung des Werkes mit hinreichender Klarheit vergegenwärtigen:
Während eines besonders aktiven Wienaufenhalts von Beuys im Jahr 1979 führte Oberhuber uns auf den Dachboden der Hochschule. Beuys inspizierte über einen Zeitraum von 100 Jahren abgelegte Gerätschaften – allesamt wohl aus dem Bestand der alten Textilklassen. Er bedeutete dem Hausmeister, der mitgegangen war, die von ihm ausgewählten Objekte hinunter in den Rektoratsraum zu bringen. Dort wollten wir am Nachmittag das weitere Vorgehen in der Frage der „Lehrsammlung Beuys“ an der Hochschule für angewandte Kunst (während seiner erwartbaren Abwesenheiten) genauer besprechen oder beuysianisch belachen. Oberhuber hatte das Rektoratszimmer ausgeräumt und neu bestückt. Es gab kaum genügend Raum, um vor dem Ensemble der Wiener Werkstätten-Sitzmöbel auf dem Fußboden mit den Objekten zu agieren. Beuys hantierte mit einem recht großen stabilen Brett, das an einer Seite in einen eisernen Winkel gefasst war; ferner mit einem massiven Holzkästchen mit einer durch Absplitterung rohen Oberfläche, dessen Mitte eine markante Vertiefung aufwies; daneben stand ein plumpes Wägelchen aus massivem Holz, zu groß, um als Kinderspielzeug angesprochen zu werden und zu klein, um es als Arbeitsgerät zu identifizieren. Aus der Mitte des Wägelchens ragte ein Vierkantholz auf. Alle Hölzer waren auf rätselhafte Weise gedunkelt. Das vierte Stück des Ensembles war eine dunkelbraun gestrichene Vierkantholzstele. Den Kopf der Stele bildet eine halbkreisförmige Aura, deren Vorderseite mit 24 eisernen Dreiviertelhaken bestückt war, die auf der Rückseite mit bemerkenswert großen Muttern gesichert wurden. Das fünfte Objekt war ebenfalls eine massive Holzplatte. Separat hatte der Hausmeister einen Haufen baumwollener Putztücher hereingetragen, deren Größe allerdings die gewöhnliche Dimension solcher vermeintlichen Reinigungshilfen überstieg.
Beuys schien der beengte Raum bei der Arbeit mit den Stücken zu stören. Er bat Oberhuber unumwunden, die Trouvaillen vom Dachboden möglichst gleich in dessen Wohnung am gegenüberliegenden Ufer des Donaukanals bringen zu lassen, wo er sich weiter mit ihnen beschäftigen wollte.
Als ich am nächsten Tag oder etwas später, das weiß ich nicht mehr, die Wohnung von Oberhuber besuchte, hatte Beuys mit seinem wirklich unglaublichen Instinkt für das Wirkungsgefüge von Objekten das Ensemble installiert: Der Wagen war mit einem Rad in dem Loch des Kästchens arretiert und an der Rückseite mit der Inschrift „Fähre“ versehen worden.
Das Winkeleisen-bewehrte Holz trug – meiner Ansicht nach mit Fettkreide aufgetragen – viele Elemente einer üblichen Beuys‘schen Partitur, u.a. die zweifach betonte Inschrift „Wärme“. Nach der oben links auf der Tafel angegebenen Titelliste wird unter der Kontur des „Filzwinkels 1“ die „Wärme“ subsumiert; der zweite Titel mit arabischer Zahl „2“ markiert den Begriff „form“. Die weiteren Titel sind dann mit dem Logo eines Herzens für „fett“ (3) und dem Logo einer Glühbirne mit einem Kabel der „Säure“ (4) zugeordnet. Diagonal über den „Filzwinkel 1“ läuft ein Klammereisen, eine Ableitung aus dem Repertoire der „Eurasienstäbe“. Das Klammereisen berührt zwei nierenförmige Ellipsen.
Die aufrechte, übermannshohe Stele mit Aura war rückseitig mit dem Wort „Mensch“ beschriftet und über die Haken der Vorderseite waren in dichter Folge besagte überdimensionale Putzlappen aufgezogen – in Wien „Fetzen“ genannt.
Das fünfte Stück des Ensembles war in die Raumecke gelehnt und trug auf Auswischungen vorheriger Schriftfixierungen deutlich erkennbar in abfallender Zeilenfolge die Formel OH2 / SÄURE / filz Seife / fett. Vom „e“ in „Seife“ führt durch das „e“ der „Säure“ ein geschwungener Pfeil auf das Zeilenniveau von „OH2“.
Beuys liebte eine sehr eigenständige gestalterische Übersetzung von Lehrbuchweisheiten. Dass er OH2 schrieb statt H2O, zeigt nur, dass die Anschaulichkeit seines Denkens die Formel sachgerechter darstellen will. Tatsächlich bindet ein Sauerstoffatom zwei Wasserstoffatome. Also erhellt seine Schreibweise die chemische Tatsache besser als die gängige Formel H2O. Im Übrigen hatte ich über dieses OH2 einen Pennälerwitz erzählt. Oberstudienrat Witt, Sport- und Physiklehrer, begleitete einen Kollegen zu dessen Frau ins Krankenhaus, die dort gerade Zwillinge zur Welt gebracht hatte. Herr Witt erlaubte sich angesichts der beiden den Ausruf „Oha, zwei!“ Beuys reagierte darauf mit dem von uns so geliebten zähnebleckenden Wiehern.
Das konstellative Gefüge der Objekte und Begriffe „Wärme / Fähre / Mensch“ erschien mir als ein mustergültiges Beispiel für den Aufbau der „Lehrsammlung Beuys“. Denn es hatte um unsere Konzeption der Schausammlung / Ideensammlung / Lehrsammlung Beuys 1979 in Wien eine besondere Diskussion gegeben: Wir fragten, ob es wirksamer sei, den Studenten die spezifischen Auffassungen von Beuys aus der Genealogie seines Werkes nahezubringen oder umgekehrt, den Studenten zu zeigen, wie sich von den aktuellen Problemstellungen her das Werk von Beuys in allen seinen Ausprägungen nutzbringend erschließen ließe. Zum Beispiel war die Frage, ob man die Beuysschen Zentralmotive werkimmanent vorführen sollte, als da sind: die Wagen/ Fähren/ Schlitten; Wärme als Transformator des Rohen ins Gekochte; Katalysatoren chemischer Prozesse; die vielen Analogien zwischen dem Goethe‘schen Wahlverwandtschaftsprinzip – ein Begriff, den Goethe der Chemie entnahm – und der Beuys‘schen Relationenbildung in seiner ganz einmaligen Fähigkeit, Dinge so miteinander räumlich in Beziehung zu setzen, dass jedem Betrachter die Konstellation sinnprägend erschien. Oder sollte man jeweils aktuelle Probleme, wie zum Beispiel, dass die Meeresströme durch den Klimawandel ihre Richtung ändern könnten, mit Beuysschen Anschauungsbegriffen sinnfälliger darstellen können als mit den Datenarchitekturen des Club of Rome?
Mir leuchtete es sofort ein, was auch später Harry Szeemann bestätigt hat, dass die „Wärmefähre“ (siehe das arretierte Rad des Wägelchens) festsitzt wie in den damals jeden beschäftigenden Visionen, der Golfstrom könne abbrechen oder seine Richtung ändern. Der Golfstrom ist die „Wärmefähre“ für das nacheiszeitliche Klimawunder in Europa. Ihm verdankt Europa seine gesamte Entwicklung als Lebensraum. Sollte, so gingen damals die Panikvisionen, der Golfstrom versiegen, wären wir von der Basis unserer Energieversorgung abgeschnitten. Das Ende der Zivilisation in einer neuen Erkältung Europas wäre die Folge.
Per Gestaltanalogie erhielt die große Stele mit halbrunder Aura durch die an den Haken dicht befestigten Tücher die Anmutung eines stehenden Menschen (siehe rückseitige Inschrift „Mensch“) bzw. einer Trauerschleier tragenden Frau. Vermittelt über die Programmatik von Beuys‘ „Iphigenie auf Tauris“, seinem Experimenta 3-Beitrag von 1969, drängte sich mir sofort die faltenreich gewandete Iphigenie auf, wie Feuerbach sie gemalt hatte. Abgetrennt vom Strom ihres bisherigen Lebens, verbannt ans tote Ufer der Barbarei, muss Iphigenie ihre Weltsicht grundsätzlich verändern. Sie lernt, dass der Anführer Barbaren, Thoas, all jene Fähigkeiten und Eigenschaften entwickelt, die sie durch ihre Verbannung ein für alle Mal verloren zu haben glaubte.
Damals, aber stärker noch im Wiedersehen in der Hummelschen Wohnung evozierte das Beuys‘sche Ensemble die Iphigenie-Erzählung wie auch alle weiteren großen Uferereignisse (wie sie Boney M. 1978 mit ihrem Welthit „By the Rivers of Babylon“ besangen). Feuerbach impliziert den Betrachter auf der Seite der Todeszone / der Verbannungszone. Mit Iphigenie blickt er zurück. Da aber keine Fähre den Strom je wieder passierbar machen wird, liegt die Zukunft im Rücken jedes Zurückschauenden.
Beim Umschreiten der Beuys-Figuration ist der Wechsel zwischen Frontalansicht und Rückenansicht so theatralisch und überraschend, als würde man Iphigenie sich erheben und aus dem Bilde gehen sehen. Sie lässt sich nicht länger vom Abbruch ihres Erinnerungsstroms, dem Wärmestrom ihrer seelisch-geistigen Kraft, lähmen, sondern kann diesseits der Jenseitssehnsucht neue Lebensenergie entfalten. Diese Entfaltungsprozesse werden auf den beiden Holztafeln des Beuys-Ensembles sowie auf den vier gerahmten Zeichnungen angesprochen, die bei der ursprünglichen Aufstellung in der Wohnung von Oberhuber stapelweise auf dem Boden lagen und jetzt bei Hummel gut lesbar seitlich des Ensembles an der Wand hängen. Die Zeichnungen können als Repräsentanten der gedanklichen Arbeit von Beuys gewertet werden, wobei das Spezifikum dieser Arbeit im Wechselspiel von Darstellung und Benennung zu sehen ist. Auf den Blättern werden gleichermaßen Zeichnungen wie Begriffe wiedergegeben. Die Zeichnungen illustrieren jedoch nicht die Begriffe und die Begriffe sind nicht einfach Namen für das Zeichnungsgefüge. Das entspricht der klassischen Redeweise vom „Denken in der Anschauung“ oder der Beziehung von Zeigen und Bedeuten.
Dadurch, dass etwas gezeigt wird, ist seine Bedeutung noch nicht gegeben und die Bedeutung ist nicht schon deswegen definiert, weil das Gezeichnete sich prinzipiell vom Chaos der Gleichverteilung unterscheidet.
Ich erinnere mich deutlich an eine persönliche Irritation, als Beuys die Dachbodenstücke auswählte. Mich befremdete die merkwürdige Disproportion der Objekte. Beim Wiedersehen war dieser Eindruck verschwunden, weil ich bei mehrfachen Besuchen in Moyland im Frühwerk von Beuys genau jene Sperrigkeit der Objekte kennengelernt hatte, die mir 1979 in Wien „unbeuysisch“ vorgekommen war.
Hinsichtlich des Aufbaus einer „Lehrsammlung Beuys“ war es auch um die Frage gegangen, wie man denn frühere Arbeiten repräsentieren könne. Gerade mit „Wärme / Fähre / Mensch“ zeigte Beuys in einer aktuellen Arbeit, wie er frühere Werkpositionen zu vergegenwärtigen vermochte. Das Vierkantholz auf dem Wägelchen ist mit Blick auf die Moyland-Sammlung schon wieder als Bestandteil des Frühwerks zu identifizieren. Eine spannende Frage für jedermann ist, wie weit er etwa als fortgeschrittener Erwachsener noch seine früheren Lebensstufen zu entfalten vermag. Die Wiederbegegnung mit „Wärme / Fähre / Mensch“ nach 33 Jahren hat mich erneut für das Beuys‘sche konstellative Gestalten begeistert. Die thematische Ausrichtung auf das Motiv Iphigenie mag aus konkreter lebensgeschichtlicher Situation so überwältigend ausgefallen sein, wie ich es zuvor nur an den für die 1960er Jahre aufgeführten Beispielen erfahren habe.
PEGGY
Ich hatte Beuys zu einer Probe dieses Verfahrens überredet, als ich ihn einlud, in dem von Kaspar König für die Ausstellung „Westkunst“ in Auftrag gegebenen Film Peggy und die anderen oder: Wer trägt die Avantgarde? als Beuys aufzutreten. Die Rollen von Peggy Guggenheim, Jean Dubuffet und Pierre Restany spielte ich selber, trat aber in dem situativen Muster Kippenbergers, „Martin in die Ecke, schäm‘ dich“, auch als Beuys auf. Die Pointe sollte darin bestehen, dass die Zuschauer sich fragen mussten, welches der echte und welches der falsche Beuys sei bzw. ob es überhaupt zwei Beuysse gebe oder ob sich nur Filmoptiken änderten. Für meine Demonstration im Studio von Werner Nekes hätten wir eigentlich das in der Basler Ausstellung „Avantgarde und Tradition“ gezeigte Werk „Schneefall“ von Beuys benötigt, dessen Ausleihe, wenn sie überhaupt möglich gewesen wäre, für einen Low-Budget-Film viel zu hohe Kosten verursacht hätte.
Wir mussten also für die Dreharbeiten eine Kopie des Werkes herstellen. Wir fragten Beuys nach der Erlaubnis dazu. Er beschloss, die Kopie selber in Auftrag zu geben. Dieter Koepplin ist mit dem Auftrag und seiner Ausführung vertraut, wie er mir brieflich mitteilte. Wenige Tage später lag der neue „Schneefall“ in Nekes‘ Filmatelier. Wir waren nach den Erfahrungen mit Beuys in Wien nicht wirklich überrascht, dass die Kopie keine Kopie war, sondern eine Erweiterung des Konzepts: Der Schnee lag nunmehr höher, weil es mehr Filzlagen gab als im Basler Original. Beuys sah sich das bisher gedrehte Material an und beschloss, meine Einladung anzunehmen und sich selbst zu spielen.
In dem bis dato gedrehten Material ging es um die jeweiligen Analogien der Wahrnehmung von Avantgarde und Tradition. Bei der Grünewald-Beuys-Konfrontation gefiel Beuys die Parallelsetzung eines dornengespickten Arms des Grünewaldschen Christus mit den splitterstacheligen Fichtenstämmchen unterm „Schneefall“. Für seinen Auftritt in der Ecke des Ateliers machte ich Beuys die Figur eines Autisten vor bzw. die Bewegung eines angeketteten großen Säugers im Zoo. In der tatsächlich realisierten Szene mit Beuys vor der nackten weißen Wand ist noch der hospitalistische Kaspar-Hauser-Effekt deutlich zu erkennen.
SIMILIA SIMILIBUS
Im Sommer 1980 organisierte Johannes Stüttgen eine Gemeinschaft derer, die Beuys zu seinem 60. Geburtstag in besonderer Weise ehren wollten. Es war bald klar, dass das auf eine Publikation hinauslaufen würde und nicht auf eine große theatralische Demonstration der Künstlerkollegen. Similia similibus bezeichnet in alternativ-medizinischen Begriffen, was für uns in den 1960er Jahren zur Affirmationsstrategie geworden war und geschichtlich weit hinter die Begründung der Homöopathie auf Bacon zurückgeht. Die Maxime hieß, die Natur macht man sich nur nützlich, indem man ihren Gesetzen gehorcht – wobei man krankmachende Ursachen durch wohldosierte Verabreichungen der gefährdenden Substanzen bekämpft. So hatten wir in den 1960er Jahren zum Beispiel die Streikfolgen durch Gesetzesbruch bei beamteten Fluglotsen eben dadurch zu heilen versucht, dass wir den Fluglotsen empfahlen, strikt Dienst nach Vorschrift zu machen, denn Dienst nach Vorschrift hat viel ernstere Konsequenzen als ein illegaler Streik.
Ich reichte für den Geburtstagsband einen speziell auf Beuys ausgerichteten Artikel zur Produktivität des Neuen ein. Ich ging von Beuys‘ Werk „Feuerstätte“ von 1974 aus, das ich per Analogie in thematischer und konzeptueller Hinsicht auf „Die Feuerprobe“ von Dirk Bouts aus dem Jahre 1498 bezog. Bestätigt wurde meine Annahme durch eine später aufgetauchte Fotografie, die Beuys mit Eva und den Kindern Jessica und Wenzel im Königlichen Museum der schönen Künste in Brüssel zeigt. Die Parallelsetzung von Beuys‘ „Feuerstätte“ und Bouts‘ „Feuerprobe“ erschließt einerseits den großartigen formalen Aufbau und das konstellative Gefüge der Bedeutungsträger bei Bouts; andererseits erhält der Beuyssche Reduktionismus durch Bouts Erfahrungsbezüge jenseits der beliebten Mystifikationen. Noch heute bin ich ganz und gar überzeugt von der argumentativen Klarheit und Geschlossenheit meines Beitrags zur Festschrift – aber das blieb wohl mein alleiniges Urteil. Ich hatte zwar Dieter Koepplins sogenannte „werkimmanente Darstellung“ der Beuysschen „Feuerstätte“ sachlich korrekt wiedergegeben, er war aber der Meinung, dass mein Hinweis auf Dirk Bouts seine Werkdarstellung „eher behindere als befördere“. Er schloss also Evidenzbeweise – für Kunsthistoriker grundlegend – schlechterdings aus, obwohl ihm wie allen anderen zweifellos der Evidenzbeweis für die Parallelsetzung von „Feuerprobe“ und „Feuerstätte“ nicht entgehen konnte. Zum ersten Mal wurde mir klar, dass auch an Beuys interessierte Herrschaften auf Biegen und Brechen Deutungshoheiten beanspruchten, um als Autoritäten für die Zuordnungsfrage „echter Beuys“, „großer Beuys“, „kleiner Beuys“, „falscher Beuys“ zu gelten. Die um Beuys angeblich so Bemühten reproduzierten sehr häufig ein Sozialverhalten, gegen das Beuys durch sein eigenes Beispiel höchst kritisch angegangen war. Da half auch keine Ironie, mit der man für die neu etablierten Beuys-Stammtische dieser sich bloß anhängenden Anhängerschaft immerhin noch ins Feld führen konnte, sie realisierten die „soziale Plastik“ im Mief ihrer radikalen Gemütlichkeit. Das hieß, Behagen in der eigenen Kultur; unbehaglich wurde das nur uns, die wir diese Inbesitznahme der Beuysschen Arbeiten und Gedanken als Verharmlosung empfinden mussten.
Wenn ich mich recht erinnere, blieb die Wirkung der Festschrift in diesem Sinne harmlos; so gab Erich Kuby – damals berühmter Stern-Autor, lebenslang aber ein herausragender Kritiker der deutschen Ideologie – folgende Stellungnahme ab: Beuys sei als Zeichner ein Genie, aber als Verbreiter pädagogischer Empfehlungen oder gar als Denker der sozialen Evolution nicht ernstzunehmen. Kuby gegenüber äußerte Nannen, der Stern-Herausgeber, dass Beuys als Zeichner unbedeutend sei, aber als Reformpädagoge größte Aufmerksamkeit verdiene. Beide Äußerungen ergeben zusammen eine zutreffende Summa der damaligen Reaktionen der Öffentlichkeit auf Beuys.
DER HANG ZUM GESAMTKUNSTWERK
Nach Szeemanns Erfahrungen seiner Zusammenarbeit mit mir für die Programme der Ausstellung „When attitudes become form“ (Bern 1968), für die documenta 5 (Kassel 1972) und die Ausstellung „Die Junggesellenmaschine“ (Düsseldorf 1975) lud er mich auch ein, für sein Konzept des Gesamtkunstwerks eine problematische Schlussfolgerung abzuwehren, die sich aus der Wirkungsgeschichte von Gesamtkunstwerkpostulaten ergeben hatte: Seit 1791 Robespierre und Saint-Just die Durchsetzung der Ideale der Französischen Revolution zum Tugendterror geführt hatten, galt es bei allen Versuchen, Gesamtkunstwerke/Utopien gesellschaftlich zu realisieren, die Gefahr des totalitären Tugenddiktats zu bannen. Ich schlug Szeemann vor, etwa Hitler als Vollstrecker der Wagner‘schen Vorstellungen, Speer mit dem Projekt „Germania“, Hanselmann mit dem Projekt „Stalinallee“ oder die westlichen Nachkriegsgroßprojekte wie Chorweiler oder Gropiusstadt nicht als Repräsentanten irgendwelcher Gesamtkunstwerkskonzepte in die Ausstellung aufzunehmen. Stattdessen würde ich einen Beitrag über die Anwendung und Umsetzung solcher utopischen Entwürfe für den Katalog liefern, in dem nicht das Gesamtkunstwerk, sondern seine Verwirklichung als totalitäre Praxis gekennzeichnet würde.
Szeemann rief Joseph Beuys, den Berliner Verleger Wolf Jobst Siedler, den Architekten Frei Otto und Bazon Brock zur Klärung allfälliger Fragen im Kunsthaus Zürich zusammen. Die Gesprächsaufzeichnung sollte in einen längeren Bericht des WDR integriert werden. Bezeichnenderweise leitete der WDR-Redakteur Hamerski die Sendung – er war nicht etwa Feuilletonist oder Kunstkritiker, sondern hatte im WDR religiöse Belange zu vermitteln. Das Gespräch beziehungsweise das verweigerte Gespräch mit besagten Zeitgrößen wurde für mich zum einschneidenden Erlebnis. Ich hatte zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht einmal mehr mit engen Bezugspersonen eine Kontroverse sinnvoll ausgetragen werden konnte. Die Teilnehmer weigerten sich allesamt, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass die historischen Versuche, Utopien – und unter ihnen die des Gesamtkunstwerks – soziale Wirklichkeit werden zu lassen, in blutigem Gemetzel geendet hatten. Meiner Meinung nach galt es, künstlerische, literarische, philosophische oder politpsychologische Entwürfe von Weltverbesserungsstrategien strikt von Handlungsanleitungen konkreter Maßnahmen zu unterscheiden. Utopien sind, wie schon Marx feststellte, keine ausgemalten Bildchen irgendeiner Zukunft, sondern Potentiale der Kritik an jeglichem Wahrheitsanspruch gegenwärtiger Herrschaftsverhältnisse.
In meiner Radikalisierung hieß das: Utopien entwickeln das Potential der Kritik der Wahrheit; mit bloßen Irrtümern können sich die Lehrer und die Richter beschäftigen.
Nicht eine Minute lang gelang während des Gesprächs eine Verständigung über den Begriff des Gesamtkunstwerks. Beuys setzte ihn gleich mit Freiheit, Religion, Schöpfung, Kreativität eines jeden einzelnen Menschen, die alle zusammen einer inneren Entwicklungslogik der sozialen Evolution folgten. So wurde das Gesamtkunstwerk plötzlich als Beschreibung eines Prozesses und Ziels der Evolution ausgegeben.
Es ist müßig, über Begriffe zu streiten, die beliebig mit allem synonym gesetzt werden, was gerade im geläufigen Gebrauch ist. Zwar gab es von den Teilnehmern auch Hinweise auf individualkünstlerische Urheberschaft von sozialen Utopien; es blieb aber unklar, warum ein zu erreichender, wünschenswerter gesellschaftlicher Zustand in Freiheit und Kreativität jedes Einzelnen als Gesamtkunstwerk aufzufassen sei. Vorgetragen wurde auch, dass Architekten immer schon wüssten, dass nur das Zusammenwirken zahlreicher Werkmeister das Aufziehen großer Gebäudekomplexe ermöglicht. Aber die Frage, warum dann einzelne Architekten – und die Gesamtheit der Mitarbeiter – mit Namen und Honoraren als Schöpfer genannt werden, blieb peinlich unbeantwortet. Wo aber wunderbarerweise die Brecht‘sche Frage „Wer baute die Pyramiden?“ mit Nennung aller Namen erfüllt wird, nämlich im Abspann eines Kinofilms, bleibt der Gebildete zwar noch ein Weilchen sitzen, aber merken kann er sich die vielen Namen nicht. Im Gegenteil, die Mehrzahl der Zuschauer empfindet diese Art von formalrechtlich erzwungener Litanei der Gerechtigkeit fast wie eine Verhöhnung angesichts der realen Machtverhältnisse.
In der Öffentlichkeit hat man sich offensichtlich damit zufrieden gegeben, nach Szeemanns Ausstellung und ihren fatalen Folgen, wie ich sie eben kurz skizzierte, zu behaupten, es gäbe keine Utopien mehr, also auch keine Avantgarde, keine sozialpsychologischen Intentionen von Künstlern. Wohin der Verzicht auf die Kritik an den harten Wahrheiten der Märkte führt, teilt sich auch dem unbedarftetsten Bürger seit den sogenannten „Banken- und Staatschuldenkrisen“ mit. Die Bereitschaft der Bürger, sich dem Diktat der Wahrheit der Märkte zu unterwerfen, scheint seit 2007 geringer geworden zu sein; nichtsdestoweniger operieren alle Politiker und Banker ausschließlich mit dem Verweis auf die Logik der Märkte, wenn sie ihr eigenes Versagen rechtfertigen wollen. Zu welchen Grotesken diese Art von Schlaumeierei führt, erwies in treuherziger Demonstration eigener Vorurteilslosigkeit FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher. Einerseits behauptet er, erkannt zu haben, dass wir inzwischen vom Selbstlauf der Algorithmen im Millisekundentakt des Börsenhandels beherrscht werden, andererseits gibt er die Empfehlung, einfach nicht mitzumachen, um sich aus dieser angeblichen Herrschaft des objektiven Geistes zu befreien. Das ist ungefähr so, als würde man den unglücklich Verliebten oder den Verlierern der Globalisierung empfehlen, sie sollten einfach nicht mehr mitspielen. Es gibt jedoch weder so etwas wie die Gesetze des Marktes, noch die Gesetze spieltheoretisch organisierter Glücksmaschinen.
Aufklärung besteht nicht darin, erst einen allgewaltigen Popanz mit aller argumentativen Kraft aufzurichten, um dann die Bedeutung dieser argumentativen Kraft daran zu beweisen, wie man der Allgewalt Paroli bieten könnte.
Es blieb wenig Zeit, Beuys nach der Zürcher Diskussion an sich selbst zu erinnern – denn wir müssen, wie Thomas Mann sagt, von Zeit zu Zeit mit unseren eigenen Ansprüchen konfrontiert werden. Uns steht die Willkür nicht an, beliebig in der eigenen Biografie herumzuwerken, vielmehr haben wir zu zeigen, wie wir selbst die ungeheuerlichen Zumutungen des Lebens zwischen falschen Freunden und echten Gegnern, zwischen Triumph und Niederlage, zwischen Wunsch und Wunscherfüllung bemeistern oder eben nicht. Beuys jedenfalls hat sie bemeistert. Bei mir ist die Frage noch offen.
(1) Zu diesem Projekt siehe Kapitel „Avantgarde und Tradition“ in: Bazon Brock: Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit. Die Gottsucherbande. Köln: DuMont, 1986. S. 102 ff.
(2) Eine Gesamtdarstellung der Hochschulentwicklung während des Direktorats von Herbert von Buttlar ist noch nicht geschrieben worden; in Einzeldarstellungen wie im Band „Nordlicht 222 Jahre. Die Hamburger Hochschule für bildende Künste am Lerchenfeld und ihre Vorgeschichte“ (Hamburg 1989) wird die Bedeutung der HFBK hinreichend herausgestellt. Siehe darin auch meinen Beitrag: „Auf der Rutschbahn bergauf! Ästhetiker etablieren sich.“ (S. 349-368).
(3) Bazon Brock: Heim ins innere Reich der Harmlosen (1985). In: Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit. Die Gottsucherbande – Schriften 1978-1986. Köln: DuMont, 1986.