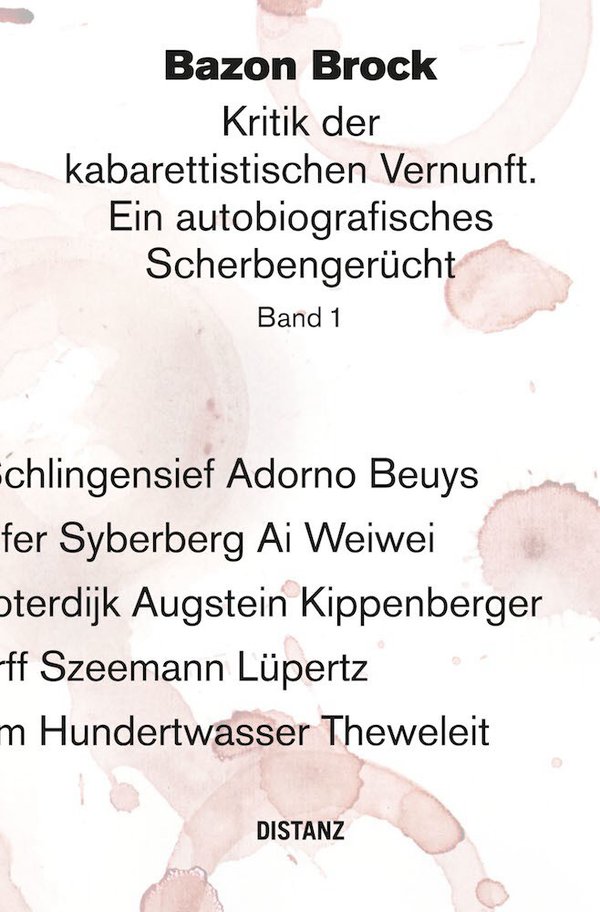Ästhetiker etablieren sich. Max Bill, Max Bense, Bazon Brock [1989]
Jubiläumsrückblicke sind besonders gefährlich; sie verführen den sich Erinnernden dazu, das Gewesene zu verklären. Sei's drum; denn diese Verklärung ist zugleich eine Falle. Wer das früher Getane als Leistung zu hoch bewertet, gerät in den Verdacht, gegenwärtig nicht mehr so Bedeutendes mit entsprechender Wirkung zustande zu bringen.
Da niemand sich gern diesem Verdacht aussetzt, wird sich die Verklärung in Grenzen halten. Im Oktober 1965 übernahm ich auf Einladung Herbert von Buttlars, des damaligen Direktors der Hochschule für bildende Künste, Hamburg, einen Lehrauftrag für nichtnormative Ästhetik. Von Buttlar war auf mich durch Hinweise des Heidegger-Verlegers Günter Neske aus Pfullingen gestoßen. Neske war der Meinung, daß ich mit meinen Arbeiten auf eine wohl »seltsam« zu nennende Weise zeitgemäße Anverwandlungen von Problemstellungen betriebe, die Heidegger in den 20er Jahren entwickelt hatte.
Gerade weil Neske sehr gut wußte, welche Entwicklung das Heideggersche Denken genommen hatte, hielt er es für wichtig, die ursprünglich in der Phänomenologie aus der alltäglichen Lebenspraxis aufgegriffenen Fragestellungen wieder zu bearbeiten. Methodisch bedeutete das, normative ästhetische Theorien aufzugeben zugunsten von beobachtender und beschreibender Entfaltung der Phänomene. Es galt, eine Form der nichtnormativen Untersuchung zu entwickeln, deren Vorgehensweisen genau denen entsprechen, aus denen die zu vermittelnden Phänomene hervorgegangen waren.
Ein derart arbeitender Theoretiker wandte also künstlerische Praktiken selber an, ohne dadurch seinerseits etwa Kunstwerke hervorbringen zu wollen. Soweit er materiale Objekte schuf, wurden sie als hypothetische oder theoretische verstanden, also als unumgängliche, aber nicht zum Selbstzweck erhobene Vergegenständlichungen gedanklicher/seelischer Prozesse. Soweit der Ästhetiker Aktionsformen der Künste anwendete, waren sie nicht als theatralische Ereignisse zwischen Staatstheater und Happening gemeint, sondern als Lehrvermittlungsformen: Action teaching, teilnehmende Befragung, Aneignung der vorgegebenen Probleme als eigene. Nun muß man wissen, daß bis in die 60er Jahre die Ästhetik als »Philosophie der Kunst« fast ausschließlich von akademischen Philosophen bearbeitet wurde. Es gab weder an Universitäten noch an Kunsthochschulen Lehrstühle für Ästhetik, obwohl zumindest zwischen 1750 und 1830 die Ästhetik die vorherrschende philosophische Disziplin gewesen war (der erste kunstgeschichtliche Lehrstuhl wurde 1819 eingerichtet), und obwohl durchs 19. Jahrhundert hindurch (z.B. von Friedrich Theodor Vischer) und zu Beginn unseres Jahrhunderts (z. B. von Georg Simmel) die Eigenständigkeit der Ästhetik gegenüber der Philosophie immer wieder hervorgehoben wurde. Zu Beginn der 1960er Jahre erreichten Arbeiten zur Ästhetik allgemeine Aufmerksamkeit, die von einem Kunsthistoriker (Sedlmayr), einem Philosophen (Max Bense) und einem Soziologen (Adorno) vorgelegt wurden. Kritik an diesen Arbeiten wurde fachspezifisch vorgetragen, wobei man den Autoren vorhielt, außerhalb ihrer eigentlichen Profession zu wildern. Bei den akademischen Philosophen und den sie berufenden Ministerien wurde daraus dennoch nicht der Schluß gezogen, endlich eigenständige Vertreter des Faches Ästhetik einzusetzen. Meines Wissens gelang es von Buttlar als erstem, an seiner Hochschule zwei Lehrbeauftragte (Max Bense und mich) für das Fach Ästhetik zu etablieren. Erst durch die Hochschulreformen, die Ende der 60er Jahre begannen, setzte sich das Fach Ästhetik an einer ganzen Reihe von Hochschulen, sogar als Pflichtfach an vielen Kunsthochschulen, durch.
Natürlich trat ich in Hamburg nicht unvorbereitet an. Ich griff ziemlich unbekümmert auf Adornos langjährige Bemühungen zurück, die Ästhetik den akademischen Philosophen, vor allem den Ontologen unter ihnen, zu entreißen. Warum das vielen durchaus nicht gefallen wollte, ja zu heftigen Anfeindungen auch unter den Hamburger Kollegen führte, wird im folgenden hoffentlich verständlich. Hier zunächst nur so viel:
Die völlig überflüssigen Invektiven des Fachvertreters »Pädagogik« entstanden aus der Befürchtung Carl Vogels, ich würde mich in unstatthafter Weise auf seinem Arbeitsfeld in Szene setzen. Vogel war von Anfang an, noch bevor er irgend etwas vom Lehrangebot des Ästhetikers zur Kenntnis nahm, gegen die Etablierung des Fachs außerhalb der akademischen Philosophie.
MAX BENSE
Da hatte es Max Bense leichter, weil er zum einen an der Technischen Hochschule Stuttgart offiziell als Philosoph (eben nicht als Ästhetiker) inthronisiert war, und weil er sich in seinem informationstheoretischen Ansatz mathematischer Darstellungsformen bediente, die selbst Vorherrschaft reklamierende Pädagogen auf ehrfurchtsvolle Distanz hielten. Bense betrieb zudem im hergebrachten Sinne eine normative Ästhetik, denn seine Arbeiten widmeten sich dem Problem, Bestimmungen des Schönen im Besonderen und des Ästhetischen im Allgemeinen zu objektivieren. Er war zu diesem Vorgehen infolge der Arbeiten von Gründervätern der Informationstheorie wie Wiener, Birkhoff u.a. zu Beginn der 50er Jahre gelangt; wahrscheinlich unter dem Druck, sich als Philosoph und als ernstzunehmender Wissenschaftler unter Naturwissenschaftlern, vornehmlich Technikern, behaupten zu müssen. Im Vergleich zu seinen frühen Arbeiten hatten die streng informationstheoretisch ausgerichteten von heute aus gesehen weniger Wirkung, obwohl man doch annehmen müßte, daß im Zeitalter allgemeiner Computerisierung eine informationstheoretische Ästhetik von allergrößtem Interesse sein sollte.
Die Wiederentdeckung des frühen Bense kann man nur nachdrücklich empfehlen; die Bedeutung der Rolle, die Bense in den 50er und 60er Jahren als Lehrer zukam, ist gar nicht zu überschätzen; denn auch in den Zeiten seiner atemberaubenden Formelhexerei war er kein sich selbst beschränkender Spezialist. Er blieb an der aktuellen Auseinandersetzung in der Kunstpraxis vorbehaltlos beteiligt, wobei ihm seine enorme Vitalität, seine Geistesgegenwärtigkeit und sein unakademischer Künstlerhabitus sehr entgegenkamen. Leider mußte Bense sich aus Arbeitsüberlastung in Hamburg mehr und mehr durch seine Mitarbeiterin Elisabeth Walter vertreten lassen. Sie hat ihn in fachlicher Hinsicht tatsächlich in vollem Umfange vertreten können — aber Benses Wirkung war eben nicht in erster Linie an seine fachlichen Arbeiten gebunden. Sein didaktisches und rhetorisches Vermögen und sein odysseushafter Charakter eines Entdeckers und Erfinders ließen von ihm Übertragungswirkungen auf seine Zuhörer ausgehen, die sich bei ihnen als Motivationsschub und Interessesteigerung besonderer Art auswirkten.
Von meinen heftige Kontroversen auslösenden Arbeiten zu Beginn meiner Tätigkeit in Hamburg möchte ich drei in Erinnerung rufen. Zugleich hoffe ich, an ihnen zentrale Probleme skizzieren zu können, die mir damals innerhalb der Hochschule von allgemeiner Bedeutung zu sein schienen.
AVANTGARDIST UND REAKTIONÄR
Die Antrittsvorlesung vom Oktober 1965, die auch von einigen Rundfunkanstalten (Helmut Heißenbüttel mit seinen legendären Radioessays im Süddeutschen Rundfunk allen voran) gesendet wurde, hielt ich unter dem Titel »Der künstlerische Avantgardist als gesellschaftlicher Reaktionär«. Damals betonten schon viele Avantgardisten ihren Anspruch, sich als Hochschullehrer um die Bedingungen eines sinnvollen Arbeitens an Kulturinstitutionen nicht kümmern zu müssen. Sie reklamierten die Kunstpraxis als eine gesellschafts- und wirtschaftsenthobene Sphäre, in der sie ihre besondere kreative Befähigung im Dienste des Abstraktionsgespenstes »Kunst« auszuleben hätten; als ob nicht inzwischen die Stellenanzeigen in der FAZ eben die bisher nur für Künstler reklamierten Fähigkeiten nun auch als Einstellungsvoraussetzung gehobener Mitarbeiter der Wirtschaft auswiesen. Diese Künstler versuchten »schöpferische Arbeit« zu tabuisieren und damit sich vorzubehalten. Im Kern ging es um die Entgegensetzung künstlerisch anspruchsvoller »Schöpfung« und der Massenproduktion einer voll entfalteten Konsumgesellschaft: »Die Zurücknahme der Kultur in den materiellen Produktionsprozeß ist unausweichlich. Wir müssen auf sie vorbereitet sein, müssen lernen, diese Zurücknahme nicht länger als Sünde wider den Geist zu verstehen. Die Reproduktion des Lebens und die der Kultur sind eins geworden, ausdrückbar in ökonomischen Begriffen ... Hüten wir uns davor, die Künste weiterhin darin gerechtfertigt zu sehen, daß sie lehren, wie man übers Wasser geht. Hüten wir uns aber auch, sie darin zu rechtfertigen, daß wir ihnen die Anwaltschaft der bisher noch Unfreien übertragen. Unsere Forderung könnte auf uns selbst zurückschlagen ... «.
Die Künstler werkelten zwar fröhlich pfeifend weiter, aber die objektiven Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung sind über sie hinweggerollt. Das formulierte ich damals als »Zurückschlagen« unserer Forderungen nach bedingungsloser Autonomie der Künstler. Sie mögen auch heute noch für ihre Werke rein künstlerische Problemstellungen als zentrale Themen reklamieren; niemand, vor allem nicht der Künstler, kann sich aber im Blick auf die Werke von den gesellschaftlichen Vermittlungsformen und der ökonomischen Wertigkeit dieser Werke befreien. Wer da so tut, als sei er allein an der »künstlerischen Entwicklung im Sinn einer immer größer werdenden Reflexion der bildnerischen Mittel« interessiert, wird damit zum gesellschaftlichen Reaktionär, der im Trüben fischt, weil er nicht bereit ist, sich den Bedingungen seiner eigenen Produktion wie deren Vermarktung und Indienstnahme, zu stellen. So etwas wurde nicht gern gehört in Zeiten, in denen man sich verstärkt mit der Frage beschäftigte, welche Verantwortung zum Beispiel den Atomphysikern dafür zu übertragen sei, was aus ihren angeblich reinen und zweckfreien Grundlagenforschungen in der Anwendung durch andere wurde. Diese Leute reklamierten für sich, ausschließlich im Interesse der Erkenntnis der Wahrheit gearbeitet zu haben; und die Künstler taten es ihnen gerne nach, obwohl sie längst wußten, daß derartige Motivationen höchstens unter anderem ihre Arbeit bestimmten.
War die Antrittsvorlesung nicht unmittelbar auf die Institution Kunsthochschule bezogen, so versuchte ich zu Beginn des Wintersemesters 1966/67, unter dem Titel »Selbstbestimmung und Fremdbestimmung«, die Bearbeitung dieser Probleme sich direkt auf den Betrieb in der Hochschule auswirken zu lassen: »Die Autonomie der künstlerischen Hochschule verdankt sich der sogenannten Freiheit der Künste; wobei Freiheit häufiger verwechselt wurde mit Bedingungslosigkeit. Deswegen wurde solche bedingungslose Freiheit auch recht schnell und gern zugestanden. Den Künstlern als Lehrern ging ihre künstlerische Freiheit über alles, also auch über die Frage, was denn Institutionalisierung für ihre Arbeit bedeute ... Es ist nicht angebracht, die Selbstbestimmung künstlerischen Arbeitens lächerlich zu machen, wenn wir von ihrer historischen Durchsetzung ausgehen ... Schiller und Marx meinten, daß die künstlerische Freiheit der Selbstbestimmung für alle Menschen gelten solle, so daß der von Künstlern praktizierten Freiheit eine Art Statthalterschaft bis zu dem Augenblick zukomme, in welchem sie allen Menschen gewährt werden wird.
Der Künstler verhalte sich in der Freiheit seiner Selbstbestimmung schon heute so, wie sich alle Menschen verhalten können sollten.
Das aber ist ein schlimmer Irrtum, der nur daraus zu erklären bleibt, wie wenig Schiller und Marx von der ästhetischen Praxis verstanden. Nach den Äußerungen von Künstlern ihrer Zeit läßt sich künstlerische Praxis als eine einzige Plackerei und eine unglaubliche Anstrengung erkennen und darstellen. Von den hohen Formen der künstlerischen Freiheit zur Selbstbestimmung ist kaum eine wirklich nachzuweisen. Die Lebensschicksale der Beteiligten zeigen das so gut wie das Schicksal ihrer Werke ... Die Werke entfremdeten sich den Künstlern genauso, wie sich das produzierte Werkstück dem Arbeiter entfremdete. Ja, aufgrund der Fiktion, der Künstler leiste bereits nichtentfremdete Arbeit, war die tatsächliche Entfremdung seiner Werke für ihn doppelt grausam. Was er unter unmenschlichen Bedingungen erarbeitete, wurde zur Erbauung derer, die nicht genötigt waren, überhaupt zu arbeiten, oder derer, die von ihr freigesetzt waren, wie etwa die Kunstprofessoren. Wer sagt, daß die Künstler die Freiheit gehabt hätten, sich durch Produktion von Kunstwerken aus der Misere des Lebens zu befreien und durch Selbsterkenntnis den Leidensdruck zu mindern, der gesteht immerhin zu, daß der Anlaß zur künstlerischen Tätigkeit doch das Leid war und nicht freiheitliche Selbstbestimmung künstlerischen Tuns ... « Die Frage, die ich formulierte, lautete etwa: Wie soll ein Künstler an einer Hochschule in diesem ideologischen Verständnis lehren? Denn mit einem Künstler als Schöpfer ex nihilo, begnadet mit natürlicher Begabung, der nur und bestenfalls im Werk seine existentiellen Probleme zu bewältigen versucht, läßt sich ja immer wieder nur das reproduzieren, was als Kunstschaffen ohnehin geschieht. Wozu braucht man da Kunsthochschulen, eine Frage, die immer noch dringlich ist, so weit man es nicht hinnehmen kann, eine staatliche Hochschule nur als Erweiterung der Privatateliers von Künstlern anzusehen. Wenn das Arbeiten von Künstlern an Hochschulen keinerlei Auswirkungen auf ihre Arbeit hat, dann ist es unsinnig, diese Künstler zu Lehrern zu berufen.
Es war schon damals unerträglich, Künstler mit fürstlichem Gehabe und dennoch als reine Privatiers in Kunsthochschulen als Lehrer anzutreffen die selbstbewußt verkündeten, die Autonomie der Kunst rechtfertige ihre Weigerung, ihre Rolle als Lehrer nach vorgegebenen Bedingungen – also in der Fremdbestimmung durch die Institution Hochschule – als verpflichtend anzusehen. Meine damalige Schlußfolgerung: Gerade die Reklamation totaler Freiheit hindere die Hochschulen an einer effektiven Erfüllung ihres Auftrags. Sie litten nicht an zu hoher Intervention der Politik, der Wirtschaft, der Öffentlichkeit, sondern am Gegenteil: an dem Mangel jeglicher Fremdbestimmung als Vorgabe von Arbeitszielen und Arbeitsmitteln. Die für die Hochschulen verantwortlichen Ministerien zögen sich auf das Autonomiepostulat zurück, um den Hochschulen nicht auch solche Arbeitsmittel gewähren zu müssen, wie sie in der Industrie, in der Werbung, im Kommerzfilm, im Verlagswesen allen gewährt werden müssen, von denen man effektive Arbeit erwartet. Das Beharren auf der Autonomie sei kontraproduktiv geworden, lasse die Hochschulen zu bedeutungslosen Selbstverwirklichungsanstalten von Privatiers verkommen. Die Hochschulen dagegen hätten ihren Anspruch geltend zu machen, als zeitgemäße Arbeitsstätte wirksam werden zu können.
Warum derartige Forderungen von so vielen Kollegen mit allen Mitteln zurückgewiesen wurden? Leider deswegen, weil viele unter ihnen das bequeme Leben als Hochschullehrer nicht aufzugeben bereit waren. Sie stilisierten sich zu Figuren, die ausschließlich der Kunst wegen alle existentiellen Höhen und Tiefen menschlichen Lebens exemplarisch auf sich nähmen, um sich andererseits mit dem Status eines Professors und der in Aussicht gestellten lebenslangen Versorgung genau dem zu entziehen, was die Existenz der meisten Menschen ausmacht. Dagegen galt es nicht nur, die Rolle des Professors über private Interessen des Künstlers hinaus als Arbeitsverpflichtung zu akzeptieren, sondern auch als Beamter seine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu nutzen, um couragiert jene Probleme des öffentlichen Interesses zu thematisieren, um die alle anderen in berechtigter Furcht vor wirtschaftlichen Repressalien einen weiten Bogen machen. Von einem derartigen Selbstverständnis beamteter Professoren sind vor allem die Künstler weit entfernt, sehr zur Freude der Ministerialbürokratie, die ihrerseits meint, Beamtenprivilegien gegen wohlwollendes Stillhalten eingetauscht zu haben.
Aber die Freiheit der Beamten von der Angst vor Repressalien kann ebenso wie die Freiheit der Künstler nur sinnvoll so lange behauptet werden, wie man in dieser Freiheit etwas zu tun bereit ist, was weniger Privilegierten kaum zuzumuten ist.
VERTEIDIGUNG DER UNKULTUR
Den dritten Komplex damals grundsätzlicher Erwägungen widmete ich der Zusammenarbeit von Kunstprofessoren und Studenten an der Hochschule. Denn mancher Kollege neigte dazu, die schwachen Studienresultate durch die Festlegung zu erklären, die Studenten seien durch die Massenkultur ihrer Zeit in ihrem Anspruchsniveau derart bescheiden geworden, daß sie eigentlich zum Studium gar nicht mehr geeignet seien. Comics und Fernsehunterhaltung, Illustrierte und Freizeitangebote hielten sie von einem ernsthaften Studium ab. Ich setzte dagegen in der Verteidigung der Unkultur auf folgende kulturgeschichtlichen Relativierungen: »Das junge Mädchen öffnete ihr Gewand über ihrem Oberkörper. Sie streifte es über die Schultern, zog die Arme aus den engen Ärmeln, wobei sie diese Bewegung durch kurzes Schütteln des Oberkörpers verstärkte.
Das grobe Leinenkleid hing jetzt unförmig an ihr herab, gehalten von einem Leibriemen. Das Mädchen stellte sich vor einen an der Wand hängenden versilberten Glasscherben, der ihr als Spiegel diente, und betrachtete ihre Brust. Dann nahm sie ein Brotmesser in die rechte Hand und begann langsam, einen Querstrich in ihre Brusthaut zu ritzen. An den Querstrich fügte sie einen Längsstrich, der am unteren Ende in einen nach links ausschlagenden Schnörkel überging. Sie setzte erneut an, diesmal ein ˃e˂. Weinend und auch schreiend, während ihr Blut ihr über die Hände spritzte, schnitt sie zwei weitere Buchstaben in ihre Brust.« Wir sind daran gewöhnt worden, solche Ungeheuerlichkeiten als die Folgen einer permanenten Konfrontierung mit den Machwerken der Massenkultur, der Unkultur unserer Tage zu erkennen. Was schließlich sollte denn ein Junge, was ein Mädchen in den Jahren ihrer größten entwicklungsbedingten Labilität anderes tun, als mit den ihnen zum Vorbild gebotenen Schundheftchen in der Hand durch die Straße zu toben, um selbst nachzuvollziehen, was ihre Helden ihnen ständig vortun. Da ist es nicht verwunderlich, wenn wir immer wieder davon hören, daß sich ein Junge, den Horrorcomic noch in der Hand, selbst entleibt habe; daß eine Horde von Halbstarken sich vergangen habe an Alten und Schwachen, oder daß ein hübsches Mädchen aus gutem Hause Selbstverstümmelungen vornehme wie in dem oben geschilderten Fall.
Und dieser Fall ist authentisch. Das Mädchen hieß Christine Ebner. Von den Elaboraten der Massenkultur ihrer Zeit getrieben, beging sie die schreckliche Tat an sich selber. Und wurde dafür noch heiliggesprochen im Jahre 1920. Denn sie war Nonne und die Buchstaben auf ihrer Brust bildeten den Namen »Jesu«. Unter dem beständigen Druck, in der ununterbrochenen Konfrontation mit den in Massen vertriebenen Glaubenssätzen ihrer Zeit, verlor sie die Kontrolle. Es zeigte sich in ihrer Tat das Versagen individueller und gesellschaftlicher Schutzvorrichtungen der Hochkultur ihrer Zeit gegenüber der Unkultur. Christine Ebner lebte von 1277 bis 1356 und leider waren die Ausdrucksmittel solcher Unkultur ihrer Tage fromme Traktate, Anleitungen zur unbedingten Seligkeit.
Was Christine und was mit ihr zur damaligen Zeit Tausende taten, scheinen die Opfer unserer vielbeschriebenen Massenkultur genauso heute zu tun — wenn sie auch, statt den Namen Jesu sich in die Haut zu ritzen, den John Lennons auf die Jacke schreiben.« Ich wollte den Kollegen nahelegen, die Lamentos über den Einzug der Subkulturen in die Hochschule aufzugeben. Diese Phänomene konnten ja nicht als historische Neuheit im Zeitalter der Popkultur und der Massenkommunikation gewertet werden, wenn sich zeigen ließ, daß man seit rund 200 Jahren ähnliche Klagen über den Kulturzerfall in schöner Regelmäßigkeit vorgetragen hatte. In den 50er Jahren entwickelte man den Begriff der Subkultur an Untersuchungen jugendlicher Großstadtbanden in den USA. Eine Tradition speziell deutschen Kulturpessimismus' bemächtigte sich dieser Ausgrenzung von Subkulturen und versteifte sich lustvoll auf den grundsätzlichen Widerspruch zwischen elitär-schöpferischer Hochkultur und parasitär-desaströser Massenkultur. Man wetterte gegen die Bildzeitungslesergemüter der anderen und las selber die Bildzeitung in der stillen Kammer. Man bezichtigte andere, Fernsehsklaven zu sein und nannte das eigene Hocken vor der Glotze eine Verpflichtung, sich kritisch-analytisch zu den Phänomenen der Massenkultur auf Distanz bringen zu müssen. Für mich galt, mit den Lehrangeboten dort anzusetzen, wo sich die Studenten als Zeitgenossen lebenstüchtig erwiesen.
Ich glaubte, es sei egal, ob die Studenten sich mit Comics oder Malerei des Manierismus, mit Werbung oder der Hofkunst beschäftigten: kontinuierliches, hochmotiviertes und methodisches Arbeiten ließe sich ihnen an jedem Problem nahebringen; und die Arbeitsresultate könne man unabhängig vom Gegenstand der Arbeit nach allen nur wünschbaren Kriterien beurteilen. Daß die Studenten weder von Hause aus noch durch die Schule ins Selbstverständnis aristokratischer oder bürgerlicher Hochkultur eingeführt würden und daß sie ihrerseits keine Neigung zeigten, sich diesem Selbstverständnis anzubequemen, könne man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach erfüllten sie mit ihren kulturfernen Haltungen die Voraussetzung dafür, die unfruchtbare Konfrontation von Eliten- und Massenkultur aufzugeben. Bildungsinteressen, gar Interesse an historischen Entwicklungen der bürgerlichen Kultur könnten sie erst entwickeln, wenn sie mit ihren eigenen Problemen nicht mehr fertig würden. Den Lehrern obliege es allerdings, unnötige Zuspitzungen dieser Probleme zu verhindern, sonst würden die Studenten gezwungen, in die alten Muster pseudoexistenzieller Radikalität der Künstlerboheme zurückzufallen: »Die Massen- oder Unkultur kennt ganz sicher keine Rechtfertigung irgendwelcher Formen des Leidens der Menschen. Und wenn auch in solchen Leidensformen bisher die Geschichtlichkeit der Menschen beschrieben worden ist und diese Geschichtlichkeit nun in der Massenkultur verloren geht, so können wir wegen eines solchen Verlustes einer kulturellen Hervorbringung nicht weiter auf unserem Leid bestehen, nur um jene Kultur zu retten. Zwangsweise entledigen wir uns ihrer. Dazu trainieren wir die Wegwerfbewegungen. Die penetranten Fixierungen, die teilweise unser Leben noch kennzeichnen, machen dieses Training nötig. Trainieren Sie die Gymnastik gegen das Habenwollen: Fangen Sie mit den Nettigkeiten an Ihren Wänden an, gehen Sie über zum Kleiderschrank; werfen Sie weg, üben Sie sich in den befreienden Formen der Wegwerfbewegungen. Nach wenigen Stunden werden Sie bemerken, daß von Ihnen tatsächlich das abgehandelt wird, was Sie zwar als Ihren Fall ahnen mögen, aber nicht zu erkennen wagen.«