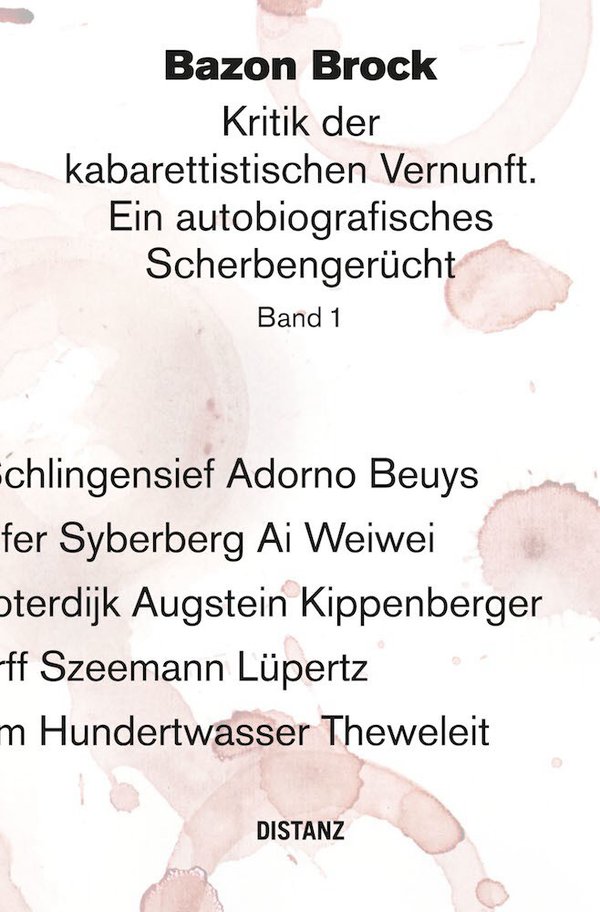Ende der fünfziger Jahre sah ich mich wie viele andere Kulturaktivisten gezwungen, eine Berufsbezeichnung zu etablieren, mit der von vornherein klargestellt würde, daß wir uns deutlich von den angestammten Künstlern als Tiefsinnhubern und Schöpfungsprätendenten durch Anmaßung der Nachfolge Gottes unterschieden.
Bestenfalls konnte man sich als Kleinstterritorialgott, also als »Dämon«, einrichten. Eine Götterbande, ein Familienclan der Dämonen, konnte wenigstens nicht als Weltenschöpfer auftreten. Sich ihnen anzugleichen, hieß, Künstler ohne Werk zu sein.
Als solcher bezeichnete ich mich denn auch in der Publikation »D.A.S.E.R.S.C.H.R.E.C.K.E.N.A.M.E.S.« von 1960. Aber die damit verbundenen Erwartungen des Publikums auf demonstrierte Fähigkeit als Lebenskünstler konnte ich nicht erfüllen.
Für die Eröffnung der DuMont-Galerie in der Breiten Straße zu Köln 1959 wies ich mich dem Publikum gegenüber auf Visitenkarten, damals noch Angehörigen höherer Stände vorbehalten, als »Beweger« (lat. Animator) aus: »always fishing for complications«.
Emmett Williams, seinerzeit Redakteur bei »Stars and Stripes« in Darmstadt, substantivierte den antiaristotelisch[en] bewegten Beweger (Automobilisten) mit der englischen Bezeichnung »Mover«, was im Alltagssprachgebrauch »Umzugsspediteur« bedeutet. Demzufolge bot ich in Frankfurt-Bockenheim einen Kulturservice an, der seiner Klientel den Umzug aus konventionell gewordenen Lebenssituationen verhieß: »Komme nach Absprache in Ihre Häuser und Familien, um Ihnen zu helfen, sich mit allen rechtlichen Konsequenzen aus der Übermacht der Gewohnheiten zu befreien.«
Dabei wurde Umzugshilfe zur Kraft der Entrümpelung mit dem wohlweislich verschwiegenen Hintersinn, in den zu entrümpelnden Dachböden Material für erfolgreiche Kulturarchäologie zu finden (mich hatte während des Studiums der Hölderlin-Herausgeber Beißner mit seiner Schilderung beeindruckt, wie er auf Dachböden einen unbekannten Hölderlin-Text gefunden hatte – ein früher Vorläufer Michael Thompsons und dessen Diktums »Alle Kultur kommt aus dem vermüllten Gerümpel«).
Soweit meine Klienten sich aber ihrer Besitztümer bewußt waren, trainierte ich sie in der damals noch nicht geläufigen Bereitschaft zum »Loslassen«. Ich veranstaltete zum Beispiel auf dem Hinterhofparkplatz des Hotels Kempinski in Berlin »gymnastische Übungen gegen das Habenwollen« in der Ausbildung von Wegwerfbewegungen (in unvergeßlichen Schilderungen der Essayistin Marie Luise Scherer, der Hellmuth Karasek in seinem Chef-d'Oeuvre »Das Magazin« ein Denkmal setzte).
Das zielte bereits auf das kulturkritische Gemaule über den Konsumerismus der Überflußgesellschaft und ihre Probleme der Abfallbeseitigung. Peinlich berührt von frühen Öko-Hygienikern, stellte ich die Deklaration der Wegwerfbewegung ein und propagierte stattdessen die Wertschätzungspflicht der Konsumenten für ihre heroische Anstrengung, die mit Massengütern vollgestellte Welt zu entleeren. Damit initiierte ich eine Rolle als Professionalisierer der Verbraucher und Rezipienten über das hinaus, was der famose USA-Anwalt Nader vorgab: Er vertrat die Interessen der Produktnutzer gegenüber den Produzenten und setzte schließlich die Haftung der Hersteller für ihre Produkte durch.
Ich bestand auf Haftung der Nutzer für ihre Umgangsformen mit den Produkten; dafür mußten die Rezipienten eben hinreichend professionelle Hantierungen lernen. Seit 1968 betrieb ich die Rezipientenprofessionalisierung in den Besucherschulen für die documenta und andere Kulturveranstaltungen. Meine Rolle wies ich als »Beispielgeber! Exemplificateur!« aus, das heißt als jemand, der anderen Kunstrezipienten zeigt, wie er die Zumutungen in der Konfrontation mit Kunstwerken bewältigt. Unter dem Eindruck der antiautoritären Pädagogen, also der Jugendführer unter den Achtundsechzigern, klang aber »Beispielgeben« zu sehr nach »Vorbild« und »Vorbild« wiederum nach »Normativität«.
Seit Oktober 1965 lehrte ich an der Hamburger Kunsthochschule das Fach »Nichtnormative Ästhetik«. Also mußte ich den Ruch angemaßter Vorbildlichkeit loswerden. Andererseits war »Nichtnormative Ästhetik« in der Sache paradoxal, denn es galt in Rechnung zu stellen, daß unsere Wahrnehmungen der Außenwelt immer schon, von Natur und Kultur aus, kategorial geprägt sind. Deswegen kam es darauf an, die Wahrnehmung des Neuen, etwa von den Künstlern Hervorgebrachten, über die Kenntnis unserer Prägung zu vermitteln.
Man sieht nur, was man weiß, und wissen kann man nur, was für alle gilt – also die Abhängigkeit von den vorgegebenen Kategorien der Sinnlichkeit, der Anschauung und der Begriffsbildung.
Das Neue mußte also als etwas kategorial nicht Bestimmtes gefaßt werden, dessen man sich nur in der Vermittlung an das Alte, Vertraute, Konventionelle versichern konnte. Also wurde »Vermittlung« zur generellen Kennzeichnung jenes Beispielgebens: Man exemplifizierte Selbstbezug als Rückgriff auf das, was die Wahrnehmung aller, die sich als »Ich« ansprechen, gleichermaßen bedingt. So wurde aus der Vermittlung die Rollenkennzeichnung »Vermittler« für Kulturaktivisten, für Lehrer, Trainer, Therapeuten – mit mehr oder weniger deutlicher Einbeziehung der alten Mittlerrollen von Priestern, Rechtsanwälten, Ärzten, Heiratsvermittlern, Handelsvertretern, Diplomaten und Ombudsmännern. Zeitgemäß hieß das »Kontakter« oder »Mediator«. Vornehmlich in Skandinavien und Nordamerika etablierte sich die Berufsrolle des Mediators in vorgerichtlichen Auseinandersetzungen als »Schiedsleute« und »Friedensrichter«. Bei uns machten Kulturaktive generell als »Kulturvermittler« in allen Bereichen Karriere, bis hin zu Kultur-Consultern, Lifestyle-Beratern, Trendscouts, Talkmastern und Moderatoren. In fachlicher Hinsicht hatten die Kulturvermittler »Generalisten« zu sein, mit hoher Anforderung an ihr Reflexivitätspotential, das Lernen zu lehren, das Zeigen zu demonstrieren und das Exponieren auszustellen.
Harald Szeemann nannte diese Tätigkeit »geistige Gastarbeit von Freelancern«, nach dem Motto des Schlitzohrs Genschman, der auf die Frage seines Fahrers: »Wohin geht's, Chef?« bekanntlich antwortete: »Egal wohin, ich werde überall gebraucht.«
Also sahen sich Politiker wie Helmut Kohl als Generalisten — gleichermaßen die Anchormen der TV-Nachrichtensendungen und die Designer, die sich jeder Aufgabe gewachsen zeigen mußten: vom Besteckentwurf bis zur Stadtplanung, von der Lifestyle-Ausprägung bis zur Wellness-Verordnung. Ihre höchste Ausprägung erreichten sie als Spezialisten fürs Allgemeine im »großen Kommunikator« vom Typ Ronald Reagan und als Autoren jener Beraterliteratur, deren Verfasser vorgaben, etwa zu wissen, wie man reich wird, um selbst mit dem Absatz ihrer Bücher genau dieses Ziel zu erreichen.
Wie Kohl die Rollenkennzeichnung »Generalist« übernahm, so wies sich Kohls Vorgänger Helmut Schmidt als »Macher« aus — ein Tätigkeitsbegriff als Rollenname, den Dutzende von Lieder-Machern, Filme-Machern und Kunst-Machern, stolz auf ihre Zeitgemäßheit, in den Briefkopf schrieben. »Na, dann macht mal schön!« rief Gustav Heinemann ihnen und anderen Machern zu.
»Machen« heißt auf Englisch »doing«, und damit sah ich auch mich als gemachten Mann, denn auf besagter Visitenkarte von 1959 hieß es bereits: »always doing things for you«. »Doing things« führt dazu, daß etwas geschieht; das Veranlassen des Geschehens von etwas erfüllte sich im »Happening«. Meine Version, ein Happenist zu sein, hieß ebenfalls seit 1959, sich als »Gelegenheitsmacher« zu betätigen. Damit schloß sich das Happening an die alte Gattung des Gelegenheitsgedichts Goethescher Provenienz an.
Die Pop-Art-»Bewegung« (!), ihrerseits ganz dem Selbstlauf der Systeme verpflichtet, zeigte aber, daß man sich um die Gelegenheiten gar nicht zu bemühen hatte: Es passierte von ganz allein fortwährend etwas, jederzeit, an jedem Ort (»Let it be«). Das hieß wahrhaft »to be popular«: sich gemein machen mit dem, was ohnehin in jedem Alltag vor sich geht. Man mußte es nur, vermittelt auf die alten Kunstpraktiken des Theaters, der Oper, der Malerei und Literatur, wahrnehmen, um zu sehen: Wir alle spielen außerhalb des Theaters Theater; wir alle sind, auch ohne Künstler zu sein, kreativ; wir alle haben auch als Durchschnittstypen eine Biographie etc.
Ich machte mich gemein, indem ich das beliebige Passantentreiben auf dem Ku'damm als Theateraufführung betrachten ließ (aus roten Kinosesseln) oder an Häuserwänden Gedenkplaketten anbrachte, auf denen jedermann als Lieschen Müller seine Kulturtaten wie Zähneputzen, Telefonieren oder Kinderanziehen verewigt sah. Umgekehrt hielt ich Anwohner von Straßen, die ihren Namen Ausnahmepersönlichkeiten wie Dichtern, Feldherren, Staatengründern verdankten, dazu an, die Rollen dieser Heroen im Alltag zu übernehmen und andere Rollenauszeichnungen, wie sie die Werbung vorgab, umstandslos für sich einzufordern (»die Schönheit des Häßlichen«).
Ich propagierte also Pop-Art als »Agit-Pop« — und verwies auf Vorgänger des Jahrhunderts, die sich in der Pop-Art der zwanziger Jahre, dem Proletkult als Agit-Prop, als Agiteure der Lebensreformpropaganda bewährt hatten (mit »Agit-Pop« firmierte ich am häufigsten auf den Dokumenten damaliger Veranstaltungen). Die Vorgehensweise im »Agit-Pop« schrieb ich als »Strategie der totalen Affirmation« aus, das heißt »Widerstand durch 150%ige Zustimmung« statt durch Negation (dafür standen historisch Schwejk und Eulenspiegel, Nietzsche und Jarry; wichtiger als meine Initiativen waren selbstverständlich die Resultate der Affirmationsstrategie von »Dienst nach Vorschrift« streikender Fluglotsen oder die vom Stern initiierte Selbstanzeigekampagne »Wir haben abgetrieben«).
Meister der Strategie totaler Affirmation war unbestreitbar Andy Warhol. Wer die Revolution des Ja-Sagens, also negative Affirmation, betrieb, wurde zum »neg-affi«, zum Neck-Affen. Als solcher diente ich mich dem Frankfurter Zoodirektor Grzimek für die Präsentation im Käfig an: Wenn Anthropologie und Verhaltensforschung des Oberganters Lorenz und die Biologen der Erkenntnis ernstgenommen werden sollten, ließ sich das nur durch Einweisung des Menschen in den Zoo populär demonstrieren – am besten mit kleinem rotem Schildchen: »gefährdete Art«.
Schließlich und endlich versuchte ich auch die Rolle des kleinen Steuermanns – der große war mit Maos Verwüstungen in der Kulturrevolution endgültig zu Grabe getragen worden, wie alle seine historischen Kollegen, die Führer, Duces, Kondukatoren, Eisernen Kanzler oder Stählernen Hausherren.
Kleine Steuermänner in der Nachfolge des Vergilschen Palinurus sind rege tätig als Navigatoren im Netzwerk, als Berater von Entscheidern, als Wissensmanager oder Sozialarbeiter. Aber die sechsstündige Selbsterprobung im Theoriegelände des Steuerungswissens, die ich mir im Januar 1997 im Frankfurter »Portikus« abverlangte, ergab nichts Eindeutiges. Um Palinurus zu würdigen, hätte ich über Bord gehen müssen, wenigstens in der zeitgemäßen Form des »Aussteigers«. Dazu sehe ich mich aber nicht bereit, wahrscheinlich geschützt durch frühkindliche Orientierung auf Anerkennung in der republikanischen Verpflichtung aufs Allgemeine, das heißt der Sorge um andere, wie sie für Erstgeborene einer Geschwisterreihe und in der Horde der Dorfkinder naheliegt.
Vergil bietet fünf Motive an, durch die sich das Verschwinden des Palinurus aus dem Gründungsunternehmen des Äneas verstehen läßt:
die Erkenntnis des Selbstlaufs der Systeme, früher Schicksal genannt (»die Welt läuft gut, wie sie läuft«);
die Einsicht in die Beschränktheit des eigenen Steuerungswissens (lokale, individuelle Intelligenz < globale, kollektive Intelligenz);
die Unwilligkeit, einem Unternehmen zu dienen, das nur den brutalen Machtwillen der Herrscher befriedigen soll (Geißler verläßt Kohl);
die Scham über die Bereitschaft der Gefährten, sich in kindlicher Gläubigkeit einem bloßen Versprechen auf Erfüllung der Wünsche zu unterwerfen (wie die heutigen Kunstgläubigen);
die Angst, dem eigenen Anspruch nicht mehr gewachsen zu sein (Burn-out-Syndrom).
Aber, wie gesagt, ich ging nicht und gehe nicht über Bord, steige nicht aus. Rechtzeitig vor der Midlife-crisis, also seit Anfang der achtziger Jahre, vermittelte ich für mich die beiden Pole »schneller Wechsel der Aktivistenrollen« und »Verlockungen des Aussteigens« im Handlungstypus des Unterlassens. Pausenloses Agieren und Nichtstun synthetisierte ich zum »Nichttun«, zu einer »Ästhetik des Unterlassens«. Damit zielte ich auch auf Vermittlung zwischen Normativität von Gebotstafeln und pluralistischer Beliebigkeit im Komparativ »legal – egal – scheißegal«. Dabei fiel mir auf, daß alle tatsächlich akzeptablen Handlungsanleitungen, wie etwa die Zehn Gebote, vorwiegend Aufforderungen zum Unterlassen sind: »Du sollst nicht«.
Wenn jenseits von Dogmatiken nicht zu begründen ist, was das Wahre, Gute und Schöne sei, bleibt nur vertretbar, dem Wissen zu entsprechen, was falsch, schlecht und häßlich ist.
Diesem Anspruch können wir uns gewachsen zeigen: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner); das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man läßt (Wilhelm Busch); nur das als solches erkannte Falsche ist noch tatsächlich wahr (Bazon Brock); was aber die Schönheit sei, das weiß ich nicht (Albrecht Dürer) — ich versuche nur, der Häßlichkeit zu entgehen.
Ich scheue mich nicht, zwei Großversuche, dem Gebot des Unterlassens zu entsprechen, als tragisch zu kennzeichnen. Zum einen die Entwicklung der Partei »Bündnis 90/Die Grünen«, die die selbstgerechte Frage der etablierten Formationen: »Und wo, bitteschön, bleibt in Ihrem Programm das Positive?« lange Zeit intelligent beantwortete: »Wir können nur alles daransetzen zu verhindern, daß sich die absehbaren ökologischen, atomaren, sozialen, ethnischen, kulturellen Probleme zu unabsehbaren ausweiten« (und dann sind sie doch mit NATO-Macht ins Unabsehbare gedriftet).
Zum anderen: Es ist kaum zu überschätzen, was wir den großen Unterhaltungsanimatoren vom Schlage Kulenkampffs, RosenthaIs, Lembkes verdanken: Sie hielten die Deutschen im Sessel vor der Glotze und hinderten sie so daran, Dummdreistigkeiten der Welterlösung zu propagieren und zu realisieren.
Auch die Touristikanimatoren boten mit Sport, Spiel und Hoppsassa genügend Attraktivität, um ihre Klientel daran zu hindern, das Durchleiden von Ereignislosigkeit und Langeweile sowie die Erfahrung eigener Phantasie- und Gedankenarmut durch Aggressivität kompensieren zu müssen. Gerade durch ihren Erfolg werden die Animatoren gezwungen, die Attraktion ihrer Freizeitangebote inzwischen derart zu steigern, daß die Aktionsformen von Urlaubern kaum noch von denen kämpfender Soldaten, Lagerinsassen oder der Bewohner psychiatrischer Anstalten zu unterscheiden sind.
Da empfiehlt es sich, die in den letzten vierzig Jahren durchgeprobten Rollen der Kulturaktivisten doch wieder aufzugeben zugunsten der guten alten Berufsbezeichnung »Künstler« — allerdings ohne Einschränkung auf die Aktionsformen Malen, Musizieren oder Dichten. Künstlersein definiert sich nicht mehr aus der Werkproduktion, sondern aus der Begründung eines Geltungsanspruchs.
Unabhängig davon, ob einer fiedelt, pinselt, kritzelt, rechnet, Substanzen schüttelt oder Weltbilder bastelt, ist Künstler, wer die Aufmerksamkeit erregt, ohne Mißachtung bestrafen oder Hinwendung belohnen zu können; ohne mit der Autorität des Erfolgreichen (Einschaltquoten, Abverkäufe, Wählerstimmen, Besucherzahlen) oder mit zünftiger Anerkennung durch Diplomierung oder Approbation aufzuwarten.
Und ist es nicht staunenswert, daß wir mit großem Interesse einzelnen zuhören, hinter denen nichts steht als die Überzeugungskraft ihres Beispiels?