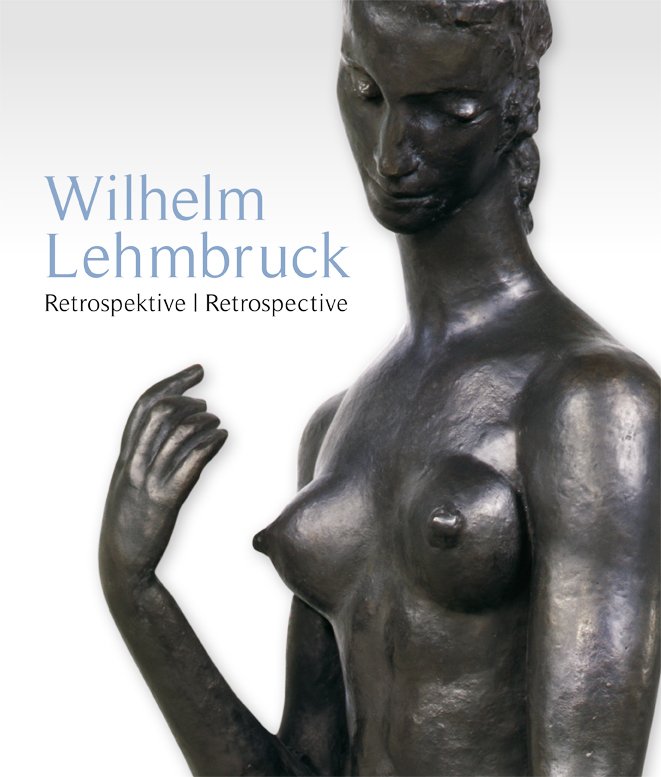In der Saison 1959/60 gastierten Elisabeth Bergner und O. E. Hasse mit dem Leseduell Geliebter Lügner (1959) im Stadttheater Luzern. Als erster, allerdings damals auch einziger Dramaturg des Hauses hatte ich Zugang zu den Künstlerinnen und Künstlern. Derartige Kontakte zu Therese Giehse und Käthe Gold, Hanne Wieder oder auch zu berühmten Autoren wie etwa dem Kafka-Freund Franz Theodor Csokor während ihrer Arbeit in Luzern ermutigten mich, die heikle, weil gern Vergesslichkeit vorspielende Elisabeth Bergner nach ihrer Beziehung zu Wilhelm Lehmbruck im Winter 1918/19 in Zürich zu fragen. Damals waren ihre Unordentlichen Erinnerungen noch nicht erschienen, sodass ich im Trüben der Gerüchte fischen musste, die von Zürich aus die Kunstwelt durchwaberten.
Wilhelm Lehmbruck hatte Elisabeth Bergner in der Zürcher Inszenierung von August Strindbergs Rausch (1899) gesehen. Wie jeder „kleinbürgerliche“ (1) (so Bergner) Zuschauer bezog er das Bühnengeschehen auf sich selbst, zumal er in seiner physischen und psychischen Verfasstheit und dem permanenten Selbstvorwurf, den Verpflichtungen seiner Familie gegenüber nicht nachkommen zu können, in dem Künstlerdrama seine ganz persönliche Situation verhandelt sehen wollte. Bergner belehrte mich im Theaterrestaurant Le Dézaley, dass nicht die üblichen Psychologien gescheiterter Annäherungshoffnung für die Lehmbruck erschütternde Enttäuschung herangezogen werden könnten. Vielmehr sei ihm durch das von seinem Freund Albert Ehrenstein vermittelte Theatererleben klar geworden, dass die Modulation eines plastischen Ausdrucks seelisch-geistiger Kräfte auf der Theaterbühne seinen künstlerischen Vorstellungen angemessener seien als seine bisherige Arbeit des Bilderbauens und Bilderhauens. Die Bilderbauer Hans von Marées und Egon Schiele – mit Letzterem hat ja Lehmbruck 1912 eine Ausstellung an prominenter Stelle im Folkwang-Museum bestritten – irritierten den Bildhauer aufs Äußerste, weil er in der Skulptur oder Plastik höchst selten eine ähnliche Intensität des Hinzufügens und Wegnehmens erreicht hatte wie als Zeichner und Maler. Der Künstler Lehmbruck hatte das Gestalten durch Hinzufügen, also das Plastizieren, nie mit dem Gestalten durch Wegnehmen, also dem Skulpturieren, vermitteln können.
Dass sich ein Plastiker oder Skulpteur überhaupt auf Malerei beziehen will, leuchtet etwa dann ein, wenn er seine Arbeiten als dreidimensionale Umsetzung aus zweidimensionalen Bildzeichen entwickelt. Und das liegt nahe, weil die meisten Bildhauer ihre Skulpturen und Plastiken im Zeichenblock konzipieren. Das Papier, die Leinwand, wie groß sie auch sein mögen, liefern immer schon einen natürlichen, weil materiellen Rahmen als Begrenzung des Zeichengefüges. Dieser natürliche Aktionsrahmen fällt beim dreidimensionalen Gestalten weg. Wie aber definiert sich dann der Erscheinungsraum der dreidimensionalen Objekte, zumal der Standplatz und Standort für die meisten Objekte nicht von vornherein berücksichtigt werden kann? Die griechisch-römischen Meister hatten das Problem kaum, denn sie konnten immer damit rechnen, dass ihre Werke entweder in Tempeln und Palästen, in Villen oder auf Markt- und Gerichtsplätzen, jedenfalls in architektonisch definiertem Umfeld platziert würden. Mit der frühmittelalterlichen Auseinandersetzung um die ersten „freistehenden“ Skulpturen und erst recht mit der Befreiung der Gestaltprogramme aus sozial definierten Zwecken in der Kunst des bürgerlichen Zeitalters entstand für Bildhauer das Problem der Beziehung von Objekten im undefinierten Raum zu dem Raum, der durch die Objektversammlung erst geschaffen wird. Laien können sich nicht einmal andeutungsweise vorstellen, was es für einen Künstler heißt, ein Artefakt in den „freien Raum“ zu stellen. Rahmen und Hängewand tragen im wörtlichen Sinne die Gemälde – Skulpturen und Plastiken haben keinen Rahmen, kein Signalement ihrer Begrenzung. Sie auf Sockel zu stellen, ist nur eine recht kümmerliche Art, das Himmelsgewölbe oder die hohe Saaldecke der Kirchen und Paläste als Definitionshorizont in Dienst zu nehmen.
Man kann die Aufrichtung der freien Skulptur durchaus kunstevolutionär an die Stelle rücken, an der in der Naturevolution der vierbeinige Affe sich auf zwei Beinen aufrichtet. Wilhelm Lehmbrucks geradezu obsessive Beschäftigung mit Hockenden, Kauernden, Liegenden, Gestürzten zeigt die Bedeutung dieser strikt gestaltungsevolutionären Orientierung auf das Ziel, Vertikalität freizusetzen. So kitschnah uns heute Formulierungen wie „Sicherstrecken ins Nichts“ oder „Hineinragen in die Leere“ erscheinen mögen, der damit bezeichnete Sachverhalt bleibt auch heute noch für jede Künstlerin und jeden Künstler Herausforderung, die wir mit einer Benn-Variante als „formfordernde Gewalt“ des leeren Raums bezeichnen wollen. Dem mag Sloterdijks programmatischer Ansatz „Entwicklung der Vertikalspannung“ heute besser entsprechen. Jedenfalls bleibt für alle dreidimensionalen Artefakte, auch die im Ensemble, das Verhältnis von Horizontalität und Vertikalität im undefinierten Raum entscheidend.
Das Verhältnis zu Elisabeth Bergner, der Gestaltgeberin durch Darstellung von Charakteren, überwältigte gerade den Künstler Wilhelm Lehmbruck und nicht den abgewiesenen Liebhaber und erst recht nicht den ohnehin unter strengem Kontaktverbot stehenden syphiliskranken Mann. Vielmehr wurde ihm klar, dass die Schauspieler dem Bildhauer weit überlegen sind, wenn es darum gehen soll, intrapsychisches Geschehen Gestalt annehmen zu lassen. Bergner erzählte von quasi privaten Lehrstunden, in denen sie immer erneut auf Lehmbrucks Zuruf einen körperlichen, also vor allem mimischen und gestischen Ausdruck zeigen sollte. Die Zurufe seien, wie sie später erfahren habe, Titel Lehmbruck’scher Arbeiten gewesen, denen sie aus eigener Kraft entsprechen sollte.
Es sei daran erinnert, dass seit Auguste Rodins Zeiten das bürgerliche Publikum die künstlerischen Resultate der Vermittlung von Begriff und Anschauung übernahm. Es gab keine Feier ohne den Programmpunkt „Lebende Bilder“. Trotz aller kollektiven Gestaltungskraft blieb es aber in diesen bürgerlichen Übungen bei einer mehr oder weniger platten Illustration von Begriffen. Skulpturentitel, die auf den Denker, die Erwartung, die Hoffnung, die Kniende, den Gestürzten, das Mutterleid, die Sehnsucht referieren, (2) schienen durch Schüler-, Studenten- oder Bürgerulk völlig entwertet zu sein. Diese Art der Enteignung der Künstler durch das Publikum wurde noch weit überboten von den professionellen Vertretern der gerade sich ausbildenden „Kritik der kabarettistischen Vernunft“ (Bazon Brock), die die Begriffsarmut und Ausdrucksvagheit der wilhelminischen Künstlerschaft philosophisch und ästhetisch, aber vor allem sozial aufklärerisch aufs Korn nahmen. Mancher Künstler erlitt, wie Lehmbruck, einen Schock, wenn er etwa erleben musste, wie weitgehend das Künstler-/Intellektuellengenie der Kabarettisten oder der Karikaturisten (Simplicissimus, Kladderadatsch, Der wahre Jakob, Eulenspiegel etc.) und vor allem das der Schauspieler die rückständige Kümmerlichkeit des akademischen Künstlergetues erkennbar werden ließ.
Im größten aller Künstlerromane, Doktor Faustus (1947), kennzeichnet Thomas Mann die künstlerisch-philosophische Dignität der kabarettistischen Vernunft, nämlich „[...] sich im Spott die Freiheit zur Anerkennung zu salvieren, – auf das Recht, um nicht zu sagen: das Vorrecht also, einen Abstand zu wahren, der die Möglichkeit wohlwollenden Geltenlassens, bedingter Zustimmung, halber Bewunderung zusammen mit der Moquerie, dem Gelächter in sich schließt. Ganz allgemein ist mir dieser Anspruch auf ironische Distanzierung, auf eine Objektivität, der es sicherlich weniger um die Ehre der Sache als um die der freien Person zu tun ist, immer als ein Zeichen ungemeinen Hochmuts erschienen.“ (3) Das gilt jenseits von Zynismus, jenseits des Pathos des Scheiterns oder des Agnostizismus (also der prinzipiellen Unmöglichkeit, im menschlichen Schaffen von Artefakten bleibende Erkenntnis zu gewinnen).
Spätestens bei seinem Aufenthaltswechsel in die Schweiz im Jahr 1916, der ganz offiziell von seinen Freunden ermöglicht wurde, stellte sich Wilhelm Lehmbruck die Frage, ob er sich, wie viele Kolleginnen und Kollegen, aus den Aporien des Schaffens in die voltairianisch-kabarettistische Ironie flüchten sollte, um weitermachen zu können, obwohl er die Konkurrenz mit Medardo Rosso, Constantin Brancusi oder Aristide Maillol verloren hatte, erst recht die mit den Bühnen- und Stummfilmschauspielerinnen und -schauspielern seiner Zeit. Bergner riet Lehmbruck zu dessen Verblüffung, die Förderung seiner Ausdruckskraft als Plastiker besser an Stummfilmcharakteren zu trainieren als an ihrem Bühnenspiel. Er lehnte treudeutsch ab, das Ethos des künstlerischen Ringens durch Ironie zu mildern, denn dazu sei er nicht hochmütig genug. Ab Februar 1916 demonstrierten die programmatischen Dadaisten in Zürich genau diesen Hochmut, den Hugo Ball in seinem Rechtfertigungsbericht Die Flucht aus der Zeit (1927) (4) analysiert.
Gab es denn, außerhalb der romantisch-ironischen oder modern-karikaturistischen Kritik, die vor allem die ästhetischen Scharfrichter so publikumswirksam demonstrierten, keine Rettung der Metaphysik im künstlerischen Arbeiten? Auf diese Frage wollte Wassily Kandinsky ab 1908/09 von Künstlerinnen und Künstlern, vor allem von sich selbst Antworten erzwingen, die er schließlich 1911 mit der Schrift Über das Geistige in der Kunst veröffentlichte. Die populärste Version einer Antwort hieß, der Blaue Reiter habe zu einem Himmelsreiter zu werden, denn „unsere Zeit sucht wieder ihren Gott“ (5), so Arnold Schönberg. Aber damit war ja bestenfalls die Empfehlung ausgesprochen, die Kunst wieder als Gottesdienst zu führen und im Künstler den Priester zu reaktivieren. Das aber würde das Ende der säkularen Kunst durch Resakralisierung bedeuten. Kunst wäre wieder dem Kult unterworfen und würde allein als Dienerin im Kult Bedeutung haben. Da man diese Einheit von Kult und Kunst als ursprüngliche Begründung der Metaphysik ausgeben konnte und das historisch Frühe als das unverkünstelte Reine und Unmittelbare verstehen zu dürfen glaubte, wurde der Ausdruck des Geistigen in der Kunst zur Rückwendung ins Primitive afrikanischer oder ozeanischer oder asiatischer Kulturen. Künstler begannen, sich an Südseestränden, in Urwäldern und Ashrams zur Kultkraft zu bilden, wie sich heute Karrierebewusste Ausflüge nach Poona und Sektensonntage als Beförderungshilfe verordnen.
Dass diese Wahl einer „intentionalen Rebarbarisierung“ gleichkam, bemerkten die kulttrunkenen Künstlerinnen und Künstler erst 1915, als vor Verdun jede machtgestützte Erzwingung von Metaphysik aussichtslos geworden war. Sie flohen in die Schweiz, wo ihnen im Namen Voltaires die Philosophie der kabarettistischen Vernunft als Pataphysik oder Dadarologie zeitweilig Rettung vor der ganz unmetaphysischen Allgewalt der Waffen versprach. In der Tat hat es nie eine mächtigere Weltverwandlung durch die Kraft des wissenschaftlichen Geistes gegeben als durch Dynamit und Giftgas, weshalb zu Recht bis heute die großen Geister der Wissenschaft mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden. Alfred Nobel hatte erkannt, dass seine Waffe die weltgeschichtlich größte Himmelsreiterei ermöglicht hatte, mächtiger als Worte und Visionen der Religionsstifter und Künstler. Mit Nobels Geistesmacht flogen die Fetzen explodierender Leiber von Millionen sichtbar himmelwärts ins Reich der Erlösung von aller Qual des Lebens. Was hätte ein noch so begabter Künstler oder Denker dagegen ausrichten können?
So drastisch muss man die historische Manifestation des Geistigen im Fortschritt nach damaliger Auffassung schildern, um auch nur annähernd nachempfinden zu können, von welch ungeheuerlicher Ohnmachts- und Versagenserfahrung sich Künstler wie Lehmbruck in den Nuller- und Zehnerjahren des 20. Jahrhunderts bedroht wussten. (Darin ganz ähnlich jenen späteren Herausforderungen, denen sich Alberto Giacometti oder Joseph Beuys, Fritz Wotruba oder Franz West gegenübersahen.) Ihnen halfen weder die feuilletonistischen Andeutungen der neuen Kosmologien der Physiker in Gefolgschaft Max Plancks oder Niels Bohrs noch die der Sprachphilosophen um Fritz Mauthner und Ferdinand de Saussure. Die hätten ihnen tatsächlich aus der Zumutung helfen können, das Metaphysische nicht mehr als Transzendieren ins Göttliche oder Ewige aufzufassen, sondern anzuerkennen, dass sinnvollerweise als Metaphysik diejenigen unserer Weltverhältnisse bezeichnet werden, die nur gedacht werden können, aber nicht empirisch als physische Erscheinung zu identifizieren sind. Die Begriffe Nachhaltigkeit oder Ganzheitlichkeit (heute en vogue) oder Gott, Unsterblichkeit, Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit können wir nur gedanklich fassen, also als geistige Konstrukte wie die der Mathematik. Dass das auch für Begriffe wie „die Kunst“ gilt, bleibt selbst heute noch den meisten Künstlerinnen und Künstlern verschlossen.
Wilhelm Lehmbrucks Werke und Tage lassen ganz präzise erkennen, was es heißt zu gestalten, obwohl in der Gestalt selber nur ein Verweis, nicht aber die Realisierung des abstrakten Begriffs „Kunst“ gelingen kann. Der Gestürzte von 1915, der Sitzende Jüngling von 1916/17 etc. verweisen nicht darauf, dass eine bestimmte Person stürzt oder sinnend hockt; vielmehr zeigt das einzelne Artefakt die gedankliche Orientierung auf das Stürzen und das Sinnen jenseits jeden konkreten Vorfalls. Das Konkrete erzeugt das Allgemeine als sein Komplement – gerade wenn wir nur das konkrete Einzelne sehen. Zum Beispiel sehen wir konkrete Objekte fallen, aber das allgemeine Schwerkraftgesetz lässt sich nur denken: zumeist in mathematisch/philosophisch/theologischen Begriffen formuliert.
Sind denn aber die Formulierungen nicht auch konkrete Gegebenheiten und ist damit die Unterscheidung zwischen Konkret und Abstrakt hinfällig? Nein, wie wir gerade aus Genf hören. Wenn man auch mit ungeheurem Aufwand die mathematisch darstellbaren Higgs-Teilchen als physikalische Gegebenheit in der CERN-Maschinerie bestätigt, so bleibt doch der Sachverhalt ein Gedankenkonstrukt, denn die dort gewonnenen Hinweise auf die Existenz des Higgs-Teilchens sind ja nur rein gedanklich erfassbar. Das gilt für alle gedanklichen Erschließungen der Welt als Realität des Geistigen. Die Erkenntnis, Metaphysik sei das, was in unseren Gedanken Gestalt annimmt und nicht das Erreichen außermenschlicher und außernatürlicher Sphären, hätte Wilhelm Lehmbruck und Tausenden vor der Wahnhaftigkeit der Erzwingung des Absoluten zu Grunde gegangener Künstlerinnen und Künstler die Qualen des „Oh Mensch“-Leidens ersparen können.
Immerhin versuchten ab 1904 etwa Theodor Däubler oder Julius Meier-Graefe, mit Hinweis auf die mittelalterliche Bearbeitung des Problems der Metaphysik im Universalienstreit den Künstlerinnen und Künstlern zu helfen. Sie boten Wilhelm Lehmbruck an, sich als Gotiker zu verstehen. Sein Problem war ja, im Ausdruckspathos der Sehnsucht nach dem Metaphysischen an Gips und Marmor, Bronze, Stein und Erde gebunden zu bleiben, ohne je wirklich erfahren zu können, wann er das Physische ins Geistige, ins Meta-Physische überführt hätte. Vielleicht durch die Auffassung, man könnte zum Jenseits des Physischen vordringen, indem man etwa die kleinsten Bestandteile des Physischen in immer kleinere zerlegte, bis deren Urgrund erreicht sei? In der Tat gingen ja die Atomphysiker so vor, indem sie diesen Urgrund als Energie und Information fassten. (Alberto Giacometti oder Franz West sind schon ganz nahe an das Verschwinden des plastischen Ausdrucks herangekommen.). Was war oder ist daran gotisch? Es ist die Feststellung, dass die mittelalterlichen Bauhüttenwerker die Suche nach dem immer umfassenderen Ganzen des Ganzen himmelwärts ins kosmologische Ganze vorangetrieben hatten, also komplementär zu den Atomisten der Philosophie und Physik. Am Ende sei der Begriff „Reich Gottes/himmlisches Paradies“ als Ultimum aller Steigerungen der Vorstellungskraft erreicht worden.
Beide Vorgehensweisen, die der Atomphysiker wie die der Kosmologen (oder, mit Wassily Kandinsky, der „Kosmiker“), ließen sich auch im künstlerischen Schaffen nachweisen. Die Skulpteure arbeiteten wie die Kleinteilchenphysiker durch immer weitergehendes Wegnehmen, die Plastiker wie die Kosmologen durch immer größere Fassung des Ganzen. Konnte man aber Kosmologe oder gotischer Plastiker sein ohne Gott, ohne den Gedanken an das Zuvor des Urknalls oder die Schöpfung? Konnte man Gotiker ohne Gottesgewissheit sein? Konnte man kosmologisch argumentieren ohne Antwort auf die Frage nach der Beginnlosigkeit, dem Vor-dem-Urknall? Wie wäre ein ewiger Wechsel von Ausdehnung und Zusammenziehung des Kosmos denkbildlich zu fassen? Der Leipziger Bildhauer Max Klinger gab in seinem grandiosen grafischen Zyklus Ein Handschuh von 1893 mit der Handschuhumstülpung einen bis heute beachteten Hinweis.
Wilhelm Lehmbruck jedenfalls konnte das Beispiel der zeitgenössischen Atomphysiker nicht für sich nutzen. Er war im Wesentlichen doch kein Skulpteur, der durch Wegnehmen Form findet: Wo sollte das immer weitergehende Wegnehmen enden? Die Suche nach den letztendlichen Bausteinen der Natur kann ohnehin nicht beim Kleinsten des Kleinsten enden. Vielmehr führte sie aus der Manifestation der physischen Natur in die des Geistes. Dieser Wechsel der theoretischen Grundannahmen hätte Lehmbruck als auf sich gestellten Künstler, der mit manuellen Techniken arbeitet, überfordert. Umso willkommener war ihm die Empfehlung, sich als Gotiker zu verstehen, die ja auch andere gerne annahmen, etwa Walter Gropius, als er im Namen seiner zu gründenden Schule ausdrücklich auf die mittelalterliche Bauhütte als Schöpfungskollektiv verwies. Auf dem Deckblatt des ersten Bauhaus-Manifests realisierte Lyonel Feininger in der Anmutung des altdeutschen Holzdrucks das programmatische Bild einer gotischen Kathedrale. Historisch wie systematisch konsequent, bestand Gropius bei den Lehrern des Bauhauses auf Kollektivarbeit vor allem für die Grundkurse, welche die Gestaltlehren zur dogmatischen Wahrheit anonymisierten. Später überführte Gropius Hütten- wie Haussozietäten in den zeitgemäßeren Begriff „Team“.
Trotz entsprechender Versuche, sich Künstlergruppen anzuschließen (zum Beispiel den Rodin-Bewunderern oder den „Brücke“-Mitgliedern), konnte Lehmbruck für das Verfahren des Gotisierens nicht den Schutz einer Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Wie aber konnte künstlerisch individuelles Gestalten gotisch werden? Ich bin überzeugt, dass man in irgendwelchen historischen oder systematischen Zusammenhängen keine bessere Antwort auf diese Frage geboten bekommt, als sie Thomas Mann in seinem Roman Der Zauberberg (1924) für die Situation der Künstlerintellektuellen in der programmatischen Periode des „Geistigen in der Kunst“ gefunden hat – unüberbietbar in der Einheit von Analyse und Synthese, von Zuspruch und Widerspruch. Ich muss das ausführlich zitieren, wenn auch immer noch nur auszugsweise.
[I]n dem Winkel links von der Sofagruppe war ein Kunstwerk zu sehen, eine große, auf rotverkleidetem Sockel erhöhte bemalte Holzplastik, – etwas innig Schreckhaftes, eine Pietà, einfältig und wirkungsvoll bis zum Grotesken: die Gottesmutter in der Haube, mit zusammengezogenen Brauen und jammernd schief geöffnetem Munde, den Schmerzensmann auf ihrem Schoß, eine im Größenverhältnis primitiv verfehlte Figur mit kraß herausgearbeiteter Anatomie, die jedoch von Unwissenheit zeugte, das hängende Haupt von Dornen starrend, Gesicht und Glieder mit Blut befleckt und berieselt, dicke Trauben geronnenen Blutes an der Seitenwunde und den Nägelmalen der Hände und Füße. […]
„Was haben Sie denn da!“ sagte [Hans Castorp] leise. „Das ist schrecklich gut. Hat man je so ein Leiden gesehen? Etwas Altes, natürlich?“
„Vierzehntes Jahrhundert“, antwortete Naphta. „Wahrscheinlich rheinischer Herkunft. Es macht Ihnen Eindruck?“
„Enormen“, sagte Hans Castorp. „Das kann seinen Eindruck auf den Beschauer denn doch wohl gar nicht verfehlen. Ich hätte nicht gedacht, daß etwas zugleich so häßlich – entschuldigen Sie – und so schön sein könne.“
„Erzeugnisse einer Welt der Seele und des Ausdrucks“, versetzte Naphta, „sind immer häßlich vor Schönheit und schön vor Häßlichkeit, das ist die Regel. Es handelt sich um geistige Schönheit, nicht um die des Fleisches, die absolut dumm ist. Übrigens, auch abstrakt ist sie“, fügte er hinzu. „Die Schönheit des Leibes ist abstrakt. Wirklichkeit ist nur die innere, die des religiösen Ausdrucks.“
„Das haben Sie dankenswert richtig unterschieden und angeordnet“, sagte Hans Castorp. […] „Dreizehnhundertsoundso? Ja, das ist das Mittelalter, wie es im Buche steht […]. Die ökonomische Gesellschaftslehre gab es damals noch nicht, so viel ist klar. Wie heißt der Künstler denn wohl?“
Naphta zuckte die Achseln.
„Was liegt daran?“ sagte er. „Wir sollten danach nicht fragen, da man auch damals, als es entstand, nicht danach fragte. Das hat keinen wunder wie individuellen Monsieur zum Autor, es ist anonym und gemeinsam. Es ist übrigens sehr fortgeschrittenes Mittelalter, Gotik, Signum mortificationis. Sie finden da nichts mehr von der Schonung und Beschönigung, mit der noch die romanische Epoche den Gekreuzigten darstellen zu müssen glaubte, keine Königskrone, keinen majestätischen Triumph über Welt und Martertod. Alles ist radikale Verkündigung des Leidens und der Fleischesschwäche. Erst der gotische Geschmack ist der eigentlich pessimistisch-asketische.“ [...]
„Herr Naphta,“ sagte Hans Castorp nach einem Aufseufzen, „mich interessiert jedes Wort von dem, was Sie da hervorheben. ‚Signum mortificationis‘, sagten Sie? Das werde ich mir merken. Vorher sagten Sie etwas von ‚anonym und gemeinsam‘, was auch der Mühe wert scheint, darüber nachzudenken. […]“ (6)
Das Gespräch fuhr nun fort, sich mit der Pietà zu beschäftigen, da Hans Castorp mit Blick und Wort an dem Gegenstand festhielt, wobei er sich an Herrn Settembrini wandte und diesen gleichsam mit dem Kunstwerk in kritischen Kontakt zu setzen suchte, – während ja der Abscheu des Humanisten gegen diesen Zimmerschmuck deutlich genug in der Miene zu lesen war, mit der er sich danach umwandte: denn er hatte sich mit dem Rücken gegen jenen Winkel gesetzt. Zu höflich, um alles zu sagen, was er dachte, beschränkte er sich darauf, Fehlerhaftigkeiten in den Verhältnissen und den Körperformen der Gruppe zu beanstanden, Verstöße gegen die Naturwahrheit, die weit entfernt seien, rührend auf ihn zu wirken, da sie nicht frühzeitigem Unvermögen, sondern bösem Willen, einem grundfeindlichen Prinzip entsprängen, – worin Naphta ihm boshaft zustimmte. Gewiß, von technischem Ungeschick könne nicht entfernt die Rede sein, es handele sich um bewußte Emanzipation des Geistes vom Natürlichen, dessen Verächtlichkeit durch die Verweigerung jeder Demut davor religiös verkündet werde. Als aber Settembrini die Vernachlässigung der Natur und ihres Studiums für menschlich abwegig erklärte und gegen die absurde Formlosigkeit, der das Mittelalter und die ihm nachfolgenden Epochen gefrönt hätten, das griechisch-römische Erbe, den Klassizismus, Form, Schönheit, Vernunft und naturfromme Heiterkeit, die allein die Sache des Menschen zu fördern berufen seien, in prallen Worten zu erheben begann, mischte Hans Castorp sich ein und fragte, was denn aber bei solcher Bewandtnis mit Plotinus los ist, der sich nachweislich seines Körpers geschämt, und mit Voltaire, der im Namen der Vernunft gegen das skandalöse Erdbeben von Lissabon revoltiert habe? Absurd? Das sei auch absurd gewesen, aber wenn man alles recht überlege, so könne man seiner Ansicht nach das Absurde recht wohl als das geistig Ehrenhafte bezeichnen und die absurde Naturfeindschaft der gotischen Kunst sei am Ende ebenso ehrenhaft gewesen wie das Gebaren der Plotinus und Voltaire, denn es drücke sich dieselbe Emanzipation von Fatum und Faktum darin aus, derselbe unknechtische Stolz, der sich weigere, vor der dummen Macht, nämlich vor der Natur, abzudanken ... […]
Settembrini sagte vornehm: „[…] Sie wissen selbstverständlich, daß nur diejenige Auflehnung des Geistes gegen das Natürliche ehrenhaft zu nennen ist, die die Würde und Schönheit des Menschen im Auge hat, nicht diejenige, welche, wenn sie seine Entwürdigung und Erniedrigung nicht bezweckt, sie doch jedenfalls nach sich zieht. Sie wissen auch, welche entmenschte Greuel, welche mordgierige Unduldsamkeit die Epoche, der das Artefakt da hinter mir sein Dasein verdankt, gezeitigt hat. […] Sie sind weit entfernt, Schwert und Scheiterhaufen als Instrumente der Menschenliebe anzuerkennen ...“
„In deren Dienst dagegen“, äußerte Naphta, „arbeitete die Maschinerie, mit der der Konvent die Welt von schlechten Bürgern reinigte. Alle Kirchenstrafen, auch der Scheiterhaufen, auch die Exkommunikation, wurden verhängt, um die Seele vor ewiger Verdammnis zu retten, was man von der Vertilgungslust der Jakobiner nicht sagen kann. Ich erlaube mir, zu bemerken, daß jede Pein- und Blutjustiz, die nicht dem Glauben an ein Jenseits entspringt, viehischer Unsinn ist. […] Guter Freund, es gibt keine reine Erkenntnis. Die Rechtmäßigkeit der kirchlichen Wissenschaftslehre, die sich in Augustins Satz, ‚Ich glaube, damit ich erkenne‘, zusammenfassen läßt, ist völlig unbestreitbar. Der Glaube ist das Organ der Erkenntnis und der Intellekt sekundär. Ihre voraussetzungslose Wissenschaft ist eine Mythe. […] Die großen Scholastiker des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts waren einig in der Überzeugung, daß in der Philosophie nicht wahr sein kann, was vor der Theologie falsch sei. […] [E]ine Humanität, die nicht anerkennt, daß in der Naturwissenschaft nicht wahr sein kann, was vor der Philosophie falsch ist, ist keine Humanität. Die Argumentation des Heiligen Offiziums gegen Galilei lautete dahin, daß seine Sätze philosophisch absurd seien. Eine schlagendere Argumentation gibt es nicht. […] Wahr ist, was dem Menschen frommt. In ihm ist die Natur zusammengefaßt, in aller Natur ist nur er geschaffen und alle Natur nur für ihn. Er ist das Maß der Dinge und sein Heil das Kriterium der Wahrheit. […] Entweder [ist die Welt] endlich in Zeit und Raum. Dann ist die Gottheit transzendent, der Gegensatz von Gott und Welt bleibt aufrecht, und auch der Mensch ist eine dualistische Existenz: das Problem seiner Seele besteht in dem Widerstreit des Sinnlichen und des Übersinnlichen und alles Gesellschaftliche ist mit Abstand zweiten Ranges. Nur diesen Individualismus kann ich als konsequent anerkennen. Oder aber [...] der Kosmos ist unendlich. Dann gibt es keine übersinnliche Welt, keinen Dualismus; das Jenseits ist ins Diesseits aufgenommen, der Gegensatz von Gott und Natur hinfällig, und da in diesem Fall auch die menschliche Persönlichkeit nicht mehr Kriegsschauplatz zweier feindlicher Prinzipien, sondern harmonisch, sondern einheitlich ist, so beruht der innermenschliche Konflikt lediglich auf dem der Einzel- und der gesamtheitlichen Interessen […].
[W]enn Sie glauben, daß das Ergebnis künftiger Revolutionen – Freiheit sein wird, so sind Sie im Irrtum. Das Prinzip der Freiheit hat sich in fünfhundert Jahren erfüllt und überlebt. […] Nicht Befreiung und Entfaltung des Ich sind das Geheimnis und das Gebot der Zeit. Was sie braucht, wonach sie verlangt, was sie sich schaffen wird, das ist – der Terror. […]“ (7)
Bis auf den heutigen Tag gibt es keine genauere Zusammenfassung der intellektuell-künstlerischen Herausforderungen des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts, dessen Leistungen auf allen Gebieten wir nur angemessen würdigen können, wenn wir bereit sind, die für die damalige Zeit spezifischen Denk- und Arbeitszumutungen zur Kenntnis zu nehmen. Ihren Ansprüchen an Radikalität im Denken und Gestalten können wir mit unseren marktgängigen Feuilletonismen nicht gerecht werden. Was wir als Künstlerin und Künstler bzw. als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler heute zu unserer Rechtfertigung anzuführen pflegen, hatte Julius Meier-Graefe, ein intensiver Kenner und Würdiger Wilhelm Lehmbrucks, schon 1904 in den Bereich der Reklame verwiesen. Er ging sogar so weit, die Avantgarde der publikumswirksamen Philosophien und Künste nur noch den Artefakten der Warenschöpfung zuzuschreiben. Wer heute wissen will, welchen Geltungsanspruch unsere Orientierung auf Glück, Liebe, Freundschaft, Erfolg, Gesundheit, Lebenskraft, Denkvermögen, Zärtlichkeit hat, muss die Werbung für Nahrungsmittel, Medikamente oder technisches Alltagsgerät auf den Verpackungen der Produkte selbst ernst nehmen. Da wird uns tatsächlich zugemutet, die Berührung eines alten kranken Menschen oder eines Säuglings mit der Wischbewegung auf einem Touchscreen gleichzusetzen. Ethosverpflichtungen werden über Tattoos präsentiert, das „Tote Meer“ wird zum „Sea of Life“ umfirmiert, Integrationsgebot als Bereitschaft zur Einpassung in kriminelle Strukturen formuliert und Liebe, Glück, Gesundheit als Resultat hinreichender Beteiligung am Konsumieren versprochen.
Nie zuvor haben die genannten universalen Begriffe philosophisch-theologischer oder allgemein kultureller Provenienz derart Karriere gemacht wie heute als Marker der Produkte. Dafür hat die Künstlerin Stephanie Senge durch eine Untersuchung in einem Supermarkt in Ingolstadt Evidenz geschaffen, indem sie die Verpackungsdesigns in diezumeist gegenstandslosen, abstrakten, nichtfigurativen Malereien der Zauberberg-Periode aus Russland, Italien, Deutschland überführte. Senge betont ausdrücklich, dass ihr eine derartige Gleichsetzung von Werk und Ware etwa durch Umsetzung einer Wilhelm-Lehmbruck-Plastik nicht gelungen ist – das ist doch wohl ein Beweis dafür, dass Lehmbruck sich den kritischen Einwänden von Meier-Graefe zu widersetzen vermochte. Die Emanzipation des Geistigen vom Natürlichen triumphierte in seinem Selbstmord als einer Weigerung, vor der dummen Macht, nämlich der Natur (der Syphilisinfektion), abzudanken. Natürlich war das eine Verweigerung von Demut vor dem Schicksal und den harten Fakten der Biologie – also am Ende doch Hochmut? Seine Plastiken tragen das „Signum mortificationis“, den Verweis auf ihre Bedeutungslosigkeit als je Einmalige, lassen aber umso dringlicher das Verlangen nach Anerkennung der anonymen und gemeinsamen Kraft der Menschheit empfindlich werden. Der Wunsch, gerade als ausgeprägter Individualist seine Teamfähigkeit und Eignung fürs Kollektiv (wie das der Schauspieler) ostentativ anzudienen, mag sich als schlichte Absurdität abtun lassen. Aber das Absurde ist ja gerade das geistig Ehrenhafte. Der dadaeske Widersinn und der pataphysische Unsinn des Kabaretts retten allein die Vernunft, wie der Lügner, indem er sein Lügen bekennt, die Verpflichtung auf den Begriff der Wahrheit rettet.
Wo sind wir, wenn wir außer uns sind?, fragt Sloterdijk. Wohin geraten wir, wenn wir uns ganz nach innen kehren wollen? Die Antwort der Künstlerinnen und Künstler, die auch Lehmbruck nur bestätigen, aber nicht überbieten konnte, heißt: Wir erreichen den Ausdruck des Seelisch-Geistigen nur als Form, als Form der Innerlichkeit wie andererseits als Form der Ekstase in Selbstübergipfelung. Was ist denn dann für Wilhelm Lehmbruck der Erscheinungsraum der Plastik, der durch die Skulptur geschaffene Raum? Wie ist für ihn die Skulptur als Raumverdränger, als Negativraum, bedingt durch den Raum, den das Gefüge, die Relation der Plastiken erst schafft? Ist das der Zwischenraum, wie ihn Joseph Beuys etwa durch Unschlitt-Auffüllungen positiv oder konkret werden ließ? Auch Raum ist nur Form, entstehend aus der Relation von Formen. Das Beziehungsgefüge der im Raum gegebenen Objekte macht ihn wirksam und er existiert nur in den Momenten dieses Wirksamwerdens durch die Kraft der Formierung der Metaform, der Form der Formen – Raum ist eine Überformung der Formen, so wie Landschaft eine Überformung der natürlich gegebenen Berge und Täler, Büsche und Bäume vor einem Wahrnehmungshorizont ist. Landschaften gibt es nicht in der Natur, sondern nur in unserem Denken und Vorstellen. Die Beziehung auf das natürlich Gegebene, zum Beispiel auf den Körper des vorstellenden und denkenden Menschen, ist das Ensemble der Formen, zu denen wir unseren Körper, unsere Haltungen, unsere Handlungen durch Training ertüchtigen, kurz, das wir durch Bildung erreichen, wie der Bildhauer Stein und Erde, Marmor und Bronze zur Form bringt.
In der Form also ist die gespenstische Fernbeziehung von Psyche und Soma, von Geist und Leib, von Metaphysis und Physis erreicht. Und nur in ihr. Deswegen ist Bildung als ein Formen zum zentralen Begriff der menschlichen Selbst- und Weltbeziehung geworden. In ihm stellt sich die Einheit von „Er-Greifen“ des konkreten Weltmaterials durch die Hand und „Be-Greifen“ als gedankliches Erfassen der gesetzmäßigen Einheit des Großen und Kleinen ein. Wie Begriff und Bild der Landschaft als durch Wahrnehmung erreichte Formierung von Natursegmenten je unterschiedliche Anmutungen entstehen lassen, so auch Gestalt und Begriff der Formen. Was wir als typisch für die Gestaltungen Wilhelm Lehmbrucks, Medardo Rossos oder Alberto Giacomettis empfinden und kommunizieren, sind ebensolche Anmutungen, wie sie die Landschaft als Naturwahrnehmung prägen.
Die Geschichte des Skulpturierens und Plastizierens, des künstlerischen Arbeitens generell zeigt, dass das menschliche Repertoire der Formgebung relativ begrenzt ist. Immer wieder gibt es die Akte und die Gewandstücke, die Liegenden, Stehenden, Gehenden, die Tragenden, Ziehenden, Schiebenden, die Rennenden oder Reitenden, die Stillleben und Historienbilder, die Landschaften und die Porträts. Aber die Anmutungen dieser Formensembles können schier grenzenlos variieren, je nach Stimmung und Beleuchtung, Perspektive und Präsentationslokal, verstärkt durch die Haltungen der Betrachter als Tempelgänger, Touristen oder Kenner. In diesen Anmutungen werden wir unserer geistigen oder seelischen Bewegung bewusst, bis zum höchsten Genuss der Selbstvergessenheit, wie sie Kinder beim Spielen erreichen, oder bis zur Aggressivität der zerstörerischen Selbstaufhebung. Die zeigt sich in der durch Formgebung hervorgerufenen Gewalt oder, wie Naphta sagt, im Terror. Mit dem Ikonoklasmus als höchster Form der Bestätigung von Bedeutsamkeit und Wirkmacht der Formen werden wir ja gerade in der herausforderndsten Konfrontation mit den Werken bekannt. Dass auch Wilhelm Lehmbrucks Werke als entartete deklariert, also mehr oder weniger der Vernichtung anheim gegeben wurden, ist die höchste Form der Anerkennung von künstlerischem Arbeiten in der Welt der Macht. Welchen größeren Beweis für die Kraft der künstlerischen Formgebung hat es je gegeben und kann es je geben als die Bestätigung durch Diktatoren und Zensoren, die sich vor ihnen fürchten, weil sie ihren Machtanspruch gefährden könnten?
Wilhelm Lehmrucks Autoaggression, wie die unzähliger anderer Künstlerinnen und Künstler, resultiert nicht zuletzt aus ihrer praktischen Erfahrung des Zusammenhanges von Formen und Entformen respektive Deformation als Formierungskraft. Aus der Art und Weise, wie sich die Künstlerin oder der Künstler und die Betrachtenden zu den Formen verhalten, entsteht die Information. Sie liegt nicht im Artefakt selbst. Gegenwärtig scheint außerhalb einer allgemeinen leeren Belobigung Wilhelm Lehmbrucks die Frage offen, wie wir uns in die von ihm geschaffenen Formgefüge einstellen sollen, das heißt, welche Information mit dem Blick auf Lehmbruck gegenwärtig am weitesten trägt. Thomas Mann gab und gibt die verbindlichste Empfehlung.
(1) Elisabeth Bergner: Bewundert viel und viel gescholten. Unordentliche Erinnerungen, München 1978, S. 38.
(2) Anm. d. Red.: Beispiele hierfür sind Werke wie Verzweifelte Mutter (1910), Kniende (1911), Der Gestürzte (1915), Begrabene Hoffnung. Gethsemane I (1918) oder Kopf eines Denkers (1918).
(3) Thomas Mann: Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde, Frankfurt/Main 1986, S. 70.
(4) Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit, hrsg. von Ernst Teubner, Göttingen 2016.
(5) Arnold Schönberg: „Franz Lists Werk und Wesen“, in: Allgemeine Musik-Zeitung, 38, Nr. 42 (20. Oktober 1911), S. 1008-1010, hier S. 1009.
(6) Thomas Mann: Der Zauberberg, Frankfurt/Main 1924, S. 414-416.
(7) Ebd., S. 418-422.