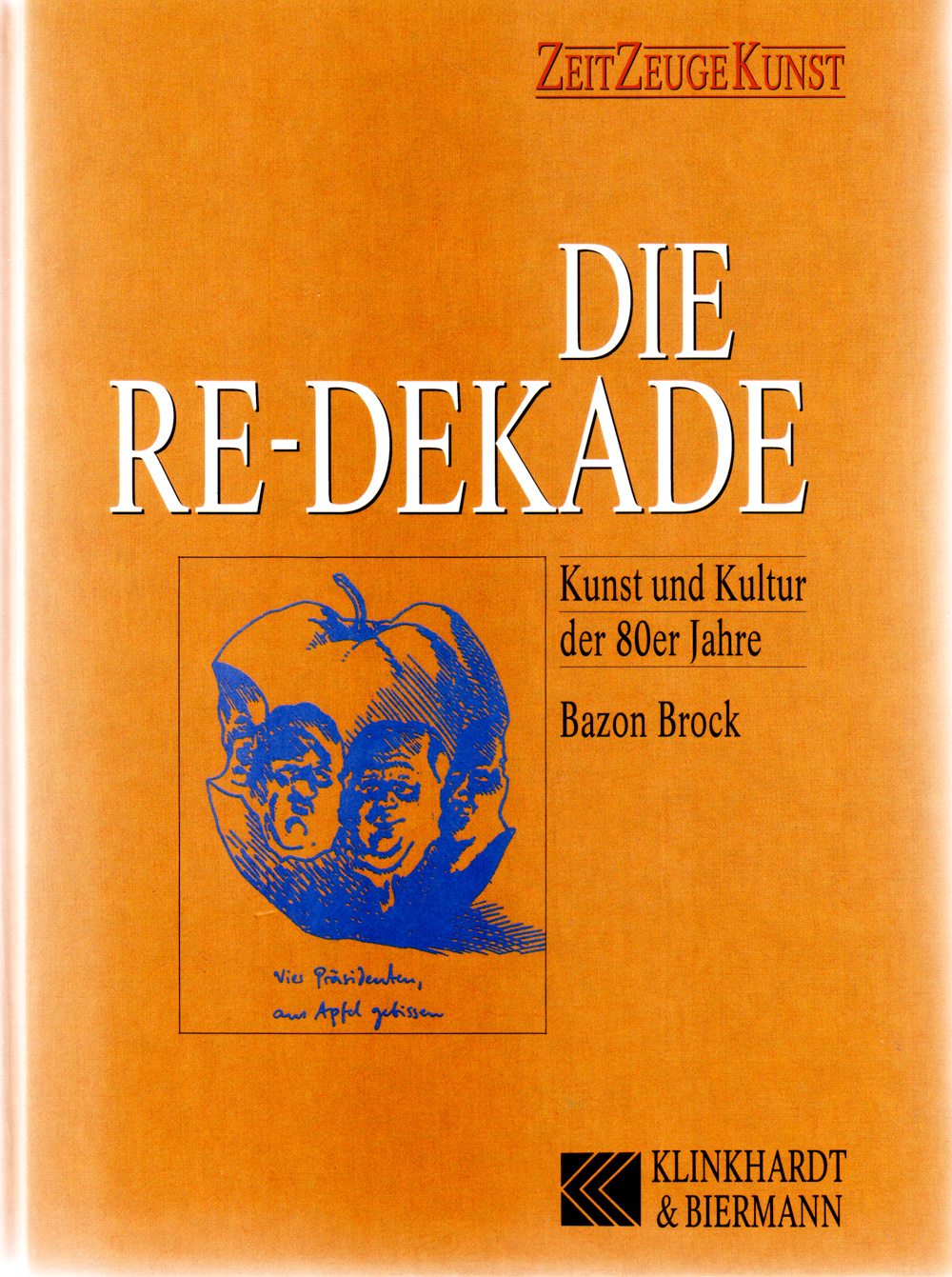Auf den ersten Blick scheint es jetzt und für alle Zukunft absurd zu sein, den Kulturtopos STADT gegen den längst etablierten Zivilisationstopos METROPOLIS verteidigen zu wollen, und mit neuen Inszenierungen der Stadt die Wüste der weltweiten Metropolis zu beleben.
Ist das auch auf den zweiten Blick absurd? – Jedenfalls dann nicht, wenn man überhaupt noch wagen will, in die Welt zu blicken, anstatt der Prozession der Blinden zu folgen, deren absehbarer Sturz schon zu Bruegels Zeiten alle Tragik verloren hatte.
Versuchen wir also, die Sehenden zu sein, die das Bild der Blinden auf ihrem Zug durch die Wüste von Metropolis betrachten. Bekennen wir uns ruhig zu unserer Besserwisserei und Arroganz der Aufgeklärten; möge unser entlastendes Lachen eher verzweifelt klingen als zynisch.
Spätestens seit Fritz Langs Film ist der Begriff METROPOLIS negativ besetzt: Der Begriff kennzeichnet den Lebensraum von Menschen, der durch technische Funktionalität bis in die Sphäre des Privaten beherrscht wird: technische Funktionalität und nicht Rationalität, wie man bis in unsere Tage immer wieder leichtfertig behauptet. Eine folgenschwere Verwechslung; denn die innere Logik der Technik, deren Gefüge von Gesetzmäßigkeiten, ist nichts anderes als die Fortsetzung der inneren Logik der Natur.
Die technische Funktionalität war so erfolgreich, weil sie auch bloß natürlich ist, gewalttätig auf den Überlebenskampf gerichtet, ziellos und inhuman. Die romanischen Kulturen haben das immer gewußt. Ihre Städte als Terra murata waren ein gegen die Natur ausgegrenzter Bezirk, in dem nicht die Natur des Menschen herrschen sollte, sondern rationale Konzepte des Sozialen.
Die Künste und Wissenschaften, das Recht und die Architektur, die Sitten und das Handwerk, die Verwaltung und der Handel folgten jenen Konzepten der Rationalität als Beherrschung und Überwindung der Natur, auch der Natur des Menschen; denn der natürliche Mensch ist bloß ein Affe, ein Wolf oder ein Schaf. Den romanischen Kulturen war deshalb jede Anbetung der Natur, wie sie die germanischen Völker entwickelten, völlig fremd. Ein Naturbegriff, wie ihn die Engländer und die Deutschen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hervorbrachten, blieb Franzosen, Italienern und Spaniern verschlossen – Gott sei Dank.
Heute, seit die dritte industrielle Revolution den gesamten Globus überzieht, sieht die Sache allerdings anders aus. Auch die Romanen haben zu lernen, daß die technisch-ökonomische Funktionalität die Wiederkehr der Natur auf einer neuen Stufe der Evolution darstellt, die leider bisher allzu wenig den Geboten der Rationalität des menschlichen Geistes genügt. Die alten Metropolen des utopischen Humanismus wurden in das weltweite Metropolis verwandelt, in die zeitgemäßen Verwüstungen der sich selbst überlassenen Natur des Menschen. Die Natur ist ein gleichgewichtiges und gleichgültiges Gefüge von Abhängigkeiten aller Lebensformen als totale Funktionalität. Das eben ist Metropolis auch, es kennt keine Zentren der Höherentwicklung, keine ausgegrenzten Bezirke als Tempel, in denen Gott und Geist sich manifestieren; in Metropolis sind alle Programmatiken gleichwertig; der Zugang zu allem ist jedermann jederzeit umstandslos als abstraktes Recht gewährt. Es gelten keine normativen Werthierarchien außer der Macht des Faktischen:
Wer Erfolg hat, hat auch das Recht; wer sich durchsetzt, hat auch die Macht.
Aber Macht, Erfolg, Durchsetzungsfähigkeit und soziale Mitleidlosigkeit bleiben bloß punktuell; sie ereignen sich überall in Metropolis, ohne sich selbst noch zu einem neuen System der Herrschaft über Natur und technische Funktionalität zu transzendieren. Die punktuell erfolgreichen, gewissenlosen und auch noch durch das Recht legitimierten Mächtigen von Metropolis gleichen nur den mächtigen Herdenführern der Affen, Wölfe und Schafe, die es aber als Affe, Wolf oder Schaf niemals dazu bringen können, Herr der gesamten Tierwelt zu werden. Überall in Metropolis gibt es mächtige, gewalttätige, seelenlose Herrscher, aber Metropolis als Ganzes ist nicht beherrschbar, nicht einmal verwaltbar, geschweige denn als die eine Gesellschaft der Menschen in Anerkennung und Durchsetzung humaner Rationalität zu bestimmen.
Willkür der lokalen Machthaber: das genau heißt Provinzialismus. Metropolis ist überall, und das heißt, daß heute der Provinzialismus überall ist. Das aus Geistlosigkeit, Phantasielosigkeit strikt funktional bestimmte Eigeninteresse, das keine übergeordneten Konzepte der Rationalität anerkennt – das ist der Provinzialismus. Kritik durch Rationalität brutal mit dem Hinweis auf funktionalistische Sachzwänge abzuschmettern – das heißt Provinzialismus. Die Lebensräume der Menschen in Konstruktion, Material und Fertigungstechniken bloß nach ökonomischen, bürokratischen und sozialpolitischen Minimalstandards ohne symbolische Repräsentation zu bauen – darin manifestiert sich der Provinzialismus. (75) Wenn die Eliten blöder als die Massen werden, weil sie nicht mehr den Willen zur symbolischen Repräsentation allgemein verbindlicher Rationalität besitzen – dann werden diese Eliten zu Provinzgrößen, über deren Privatleben die Provinzpresse so berichtet, als handele es sich um Staatsaffären, jene Provinzpresse, die Metropolis allein noch zu bieten hat und die folgerichtig über die tatsächlichen Staatsaffären so berichtet, als handele es sich um Privatangelegenheiten von Provinzfürsten.
Die Ideologie des Provinzialismus heißt in Städtebau und Lebensformen „Regionalisierung“ und „Autonomie“: die Schafe beanspruchen Autonomie in ihrer Weideregion, die Wölfe und Affen in der jeweils ihrigen. Das ist die Naturalisierung der Kultur zur technischen Zivilisation von Metropolis.
Wir haben die Natur nicht mit der technischen Funktionalität zurückgedrängt oder gar zerstört, sondern wir haben ihr erst zur völligen Durchschlagskraft verholfen Deswegen verträgt sich der vor allem in Deutschland erfolgreiche Imperativ „Zurück zur Natur“ ganz ausgezeichnet mit dem technologischen Imperialismus. Die Gift und Gas produzierenden Industriellen wie ihre Klientel (also wir alle) glauben ganz von unserem Affenherzen her, die Einheit von Natur und Technik harmonisieren zu können, ein Programm, vor dessen Absurdität nur berstendes Gelächter entlastet.
Wenn man unter Natur die Lebensvoraussetzungen der Menschen versteht, müßte der Slogan der zukünftigen Entwicklung heißen: „Voran zur Natur.“ Unsere humane Rationalität hat eine Natur erst zu schaffen, wie Gott einst die Welt schuf. Nur so werden wir aus den Klauen einer blindwütigen Evolution entrinnen. Das aber bedeutet, die zweite Natur der technischen Zivilisation genauso zu bekämpfen und zu beherrschen wie die erste. In den technisch zivilisierten Wüsten von Metropolis sind an vielen Orten Metropolen (als Terra murata) aufzurichten, aber diese Lebensräume humaner Rationalität inmitten weltweit herrschender Zivilisationswüsten werden ganz anders aussehen müssen als die alten Metropolen.
Ich bin mir bewußt, daß ich mit dieser groben Argumentation verdächtigt werden könnte, einer in Deutschland seit hundert Jahren mit verheerendem Erfolg geführten Zivilisationskritik zu folgen. Diese Verdächtigung wäre voreilig. Wo etwa noch Thomas Mann (wie die Mehrzahl der großen Repräsentanten deutscher Geistesgeschichte der vergangenen hundert Jahre) in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ von 1918 (76) vor allem die deutschen Weltkriegsgegner bezichtigte, weltweit das verwüstende inhumane Werk des technisch-funktionalen Zivilisationsprozesses zu betreiben, und wo Thomas Mann, wie die vielen anderen Großen, der durch die Deutschen repräsentierten Kultur die Aufgabe zusprach, humane Rationalität gegen die technische Zivilisation durchzusetzen, da wird wohl heute niemand mehr mit nationalen oder rassischen oder weltanschaulichen Argumenten die rationale Kultur gegen die funktionalistische Zivilisation aktivieren wollen. Dieser in Zukunft bestimmende Kampf der Kultur gegen die Zivilisation ist der einen Weltgesellschaft (eine ebenso bedeutsame deutsche Begriffsbildung wie die Differenzierung von Kultur und Zivilisation) aufgegeben. Diese Auseinandersetzung tritt an die Stelle der alten Klassenkämpfe und wird größere Auswirkungen haben als die Klassenkämpfe.
Die herkömmlichen Strategien, die Künste als genuine Repräsentanten humaner Rationalität gegen Metropolis ankämpfen zu lassen, sind nicht sehr erfolgreich. In der Bundesrepublik Deutschland erteilten in den vergangenen Jahren zahlreiche Kommunen, darunter Berlin, Düsseldorf, Kassel, Münster, Essen, Hamburg, Köln, München, ebenso zahlreichen Künstlern den Auftrag, mit ihren Werken in den Wüsten von Metropolis zu intervenieren. Das Programm hieß „Kunst im öffentlichen Raum“. Aber sind die Straßen, Plätze und Parks von Metropolis überhaupt öffentliche Räume?
Die Frage stellt sich schon deshalb, weil man nach einer Klärung dafür sucht, warum selbst die Arbeiten hervorragender Künstler in diesen Ausstellungsarealen auffällig blaß und nichtssagend bleiben. Die Enttäuschung ist groß, und das kann ja nicht nur auf allzu geringe Qualität der ausgestellten Werke zurückgeführt werden. Sie bleiben in diesen Ausstellungen weit unter ihrer Wirkungsmöglichkeit, weil sie eben nicht in öffentlichen Räumen stehen, sondern in bloßen Zwischenräumen des Ungestalteten und Unartikulierten.
Eine Straße wird ja nicht schon zu einem öffentlichen Raum, weil sie keinem Privatmann gehört. Eine Straße ist öffentlicher Raum, wenn die Fassadenarchitektur der sie definierenden Häuser daraufhin konzipiert und gebaut wurde, die Grenze von innen und außen, von privat und öffentlich zu thematisieren.
Wo gibt es in unseren Städten solche architektonischen Zielsetzungen noch, die einstmals den Markusplatz in Venedig, die Piazza della Signoria in Florenz und unzählige Residenzstädte in vielen Teilen Europas zu tatsächlichen öffentlichen Räumen werden ließen? Unsere Straßen und Plätze sind bloßes Niemandsland, Packhalden der um sie herum wahllos aufgestellten Betonsilos, Lagerbaracken, Garagen und jämmerlichen Behausungen, die wir nur aus Mangel an Phantasie und historischer Kenntnis als Häuser bezeichnen. (77)
Weil der öffentliche Raum in unseren Städten gar nicht existiert, finden die Kunstwerke keinen Standort, in dem sie ihre Definition erfahren können. Ohne definierten Raum kann sich das Kunstwerk nicht behaupten, und sei es als Einzelnes noch so bemerkenswert. Der einzige öffentliche Raum, der in unseren Städten noch einer ist, bleibt das Museum, das sich die meisten Künstler eben deshalb auch als alleinigen Ort der öffentlichen Präsentation ihrer Werke vorstellen können. Auf diesen definierten Ort hin konzipieren sie ihre Arbeiten – mit den Parametern des Museums wissen sie umzugehen. Sie wüßten sicherlich auch mit den Parametern von Straßen und Plätzen als öffentlichem Raum zu rechnen, wenn diese Orte tatsächlich öffentliche Räume wären. Sie sind es eben nicht; den Beweis mag man allein schon darin sehen, daß Museumsausstellungen mit ähnlichen Werken der gleichen Künstler, die man jetzt in den touristischen Feriencamps unserer Städte sieht, offensichtlich besser gelingen, sowohl in der Präsentation der Werke wie in deren Konfrontation mit dem Publikum. Seien wir optimistisch, gehen wir also davon aus, daß die Veranstalter der besagten Ausstellungen von Kunstwerken in Straßen und auf Plätzen unserer Städte nur allzu gut wissen, daß diese Orte eben keine öffentlichen Räume sind, aber durch die aufgestellten Skulpturen zu solchen werden sollten. Kunstwerke als kosmetische Korrektur? Kunstwerke als Narbenpflaster auf Wunden, die, wie Stadtväter sich auszudrücken belieben, der Krieg und die rasante technische Entwicklung der jüngsten Vergangenheit den historisch gewachsenen Städten schlugen? Um das zu erreichen, hätten die Kommunen Tausende von Kunstwerken ins gestalterische Chaos ihrer Lebensräume verfrachten müssen. Wo sollten diese Werke herkommen? Der Aufwand ihrer Plazierung und der Aufwand der Durchsetzung ihrer Wirkungsansprüche gegenüber den Bürgern wäre so groß, daß man gleich mit klassischen architektonischen Mitteln der Stadtgestaltung grundsätzliche Veränderungen hätte in Angriff nehmen können, anstatt sich mit kosmetischen Schönheitsoperationen am Körper der Stadt zu beschäftigen. Statt Kunst am Bau und zwischen Bauten gälte es, Architektur am Bau durchzusetzen. Es ist auffällig, daß an den hier in Frage stehenden Ausstellungen kein einziger Künstler beteiligt ist, der etwa, wie Wolfgang Körber (78), eben diese Zielsetzung einer Architektur am Bau entwickelt hat. Architektur ist keine Kunst unter anderen bildenden Künsten, die in Eigenheimen privatisiert werden kann. Architektur ist die Kunst, öffentliche Räume zu schaffen, auch dort, wo sie nur Bauten von Privatleuten realisiert.
Im Unterschied zur bloßen Skulptur vermittelt die Architektur zwischen der Definition von Körpern im Raum und dem durch diese Körper geschaffenen Raum. Die Skulptur bleibt nur Körper im Raum, vermag selbst aber nicht Raum zu schaffen. Aus solchen über Jahrhunderte systematisch diskutierten Eigengesetzlichkeiten der verschiedenen Künste ist zu schließen, daß noch so viele Skulpturen auf Straßen und Plätzen diese nicht als Räume artikulieren können. Es ist grundsätzlich verfehlt, Skulpturen solche Aufgaben abverlangen zu wollen.
Sind also alle diese Ausstellungen, die selbst in ihrer Kläglichkeit durchzusetzen, von ihren Veranstaltern so viel Mühe verlangte, gescheitert? Das eben nicht, und darauf sollten wir Künstler, Bürger, Stadtväter und Ausstellungsmacher immer wieder mit Nachdruck hinweisen. Alle diese Ausstellungen sind insofern sinnvoll und nützlich, als sie den Bürgern unabdingbar klarmachen, wie es um ihre Städte als öffentliche Lebensräume steht.
In Berlin scheint das bereits gelungen zu sein. Die, milde gesagt, heftigen Reaktionen vieler Bürger auf Wolf Vostells oder Olaf Metzels Beiträge zum Skulpturenboulevard sind ganz sicher darauf zurückzuführen, daß den Bürgern schmerzlich bewußt wurde, was ihnen durch die Zerstörung der öffentliche Räume an Lebensformen und Lebensqualität vorenthalten wird. Der Widerstand gegen Vostells Arbeit wird durchweg so begründet: Es ist ein Skandal, daß dieser Künstler uns vor Augen führt, worunter wir täglich leiden. Die ohnmächtige Wut richtete sich aber nach dem bekannten Psychomechanismus, den Boten zu köpfen, um die Botschaft nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen, gegen Vostells Artikulation der Zerstörung des öffentlichen Raums durch den ziellos wuchernden privaten Automobilverkehr. Die Bürger glaubten, Vostell habe mit seinem Denkmal die unerträgliche Situation noch glorifizieren wollen. So tief steckt in den Bürgern das verständliche Vorurteil, Kunstwerke dienten der lobpreisenden Überhöhung ihrer Themenstellung.
Es wäre Aufgabe der Kulturvermittlung und der Veranstalter, den Bürgern klarzumachen, daß ihnen in den Arbeiten Vostells oder Metzels nicht zynisch das Recht genommen werden soll, sich wenigstens noch zu empören, wenn sie an ihrer Situation schon nichts ändern können; die Werke selbst sind Formen der Empörung, aber mit der Fähigkeit, wenigstens zu artikulieren, wogegen sich die Empörung richtet: eben gegen Zerstörung des öffentlichen Raums.
Wie ist es zu dieser Zerstörung gekommen? Es gab ja einmal die alles beherrschenden Interessen der Zünfte, der Kirchen, der Fürsten, der Stadtherrschaft und des Staates, gegen die das Bürgertum den Anspruch des Privaten durchzusetzen hatte, der von der Unverletzlichkeit der Wohnung bis zur jede Öffentlichkeit ausschließenden Intimsphäre reichte. Dieser Anspruch auf Sicherung der Privatheit gegen die Interessen der Öffentlichkeit führte auch zu einer Privatisierung der Künste, zu deren Genuß und Nutzung als Besitz. Was zunächst als persönliche Aneignung der Künste und als Schutz vor Zensur und Meinungsmonopol der Öffentlichkeit sinnvoll zu sein schien, erwies sich aber bald als Einschränkung der Wirkungsmöglichkeiten von Künsten. Die Emanzipation des Bürgertums hatte nicht als das Recht auf Privatisierung gegen den Zugriff der Definitionsmacht von Institutionen erkämpft werden können, sondern war von der allmählichen Durchsetzung einer anderen Form von Öffentlichkeit getragen worden. Die Privatisierung der Kunst hinderte sie daran, selber Definitionsmacht der bürgerlichen Gegenöffentlichkeit zu werden. Die Kunstwerke verkümmerten zu Objekten privater Erbauung. Die Ausstellungen von Skulpturen in unseren Städten lassen diesen Mangel bewußt werden und versuchen, den Werken einen Teil ihrer Entfaltungsmöglichkeiten als Definitionsmacht von Öffentlichkeit zurückzugeben. Auch wenn das unter den vorherrschenden Bedingungen nicht gelingen kann, bleibt es doch ein Verdienst zu zeigen, was fehlt und wonach sich offensichtlich viele sehnen.
Publikum zu sein, reicht als einzige Form gesellschaftstiftender Gemeinsamkeit nicht aus. Zur Gemeinschaft der Gläubigen, der Parteisoldaten und der Wahrheitssucher werden wir kaum zurückkehren können. Da liegt es nahe, den Künsten mit ihren überindividuellen ThemensteIlungen die Aufgabe zu übertragen, Öffentlichkeit (ihren Raum und ihre Aktionsformen) bestimmen zu lassen. Das aber verlangt von den Künstlern eine grundsätzlich andere Haltung als die von Privatiers, die im Bewußtsein einer gesetzlich geschützten Autonomie Privatunterhaltungen mit einem einzelnen, aber nur abstrakt vorgestellten Adressaten pflegen.
Ein Leonardo, ein Michelangelo, die Mehrzahl der Künstler im Barock und Klassizismus waren sich nicht zu fein dafür, eine Ikonographie der Öffentlichkeit, der höfischen wie der bürgerlichen, der kirchlichen wie der staatlichen zu entwerfen und zu realisieren, und sei es nur für vergängliche Augenblicke öffentlicher Feste und feierlicher Staatsakte.
Man kann davon ausgehen, daß die bewährte Autonomie der Künste zu den entscheidenden Entwicklungsschritten in der Geschichte der bildenden Kunst erst geführt hat, wo die Künstler bereit waren, aus dieser Position heraus in die öffentlichen Belange hineinzuwirken. Wieso sollte eigentlich eine Gesellschaft bereit sein, den Künstlern für ihr privates Werkschaffen Tempel zu errichten, wenn man nicht erwarten darf, daß durch die öffentliche Präsentation der Werke auch Öffentlichkeit geschaffen würde, ja, daß die Künstler im öffentlichen Wirken ihr eigentliches Ziel sehen wollen? Wer dazu heute als Künstler bereit ist, dem bieten sich Aufgaben in solcher Fülle, daß man der Unsterblichkeit schon bedürfte, um sich auch nur einigen ausführlich widmen zu können.
Was heute Öffentlichkeit genannt wird, heißt in den klassischen Definitionen von Kultur der Stadt Urbanität. In L. Mumfords Studie über die Kultur der Stadt von 1938 wird mit vielen Belegen deutlich gemacht, worin Urbanität besteht. Die alte Urbanitas bezeichnete in erster Linie ein gutes Benehmen in der Gemeinschaft der Menschen; diese Gemeinschaft hatte Urbanität, wenn die Gemeinschaft von Formen humaner Rationalität in Recht und Sitte, in Verwaltung und Handwerk, in Handel und sozialen Ritualen geprägt war. Urbanitas als ein solches menschenwürdiges Benehmen wurde zur Kennzeichnung der Städte, weil in den Städten dieses menschenwürdige Benehmen eine größere Chance hatte, sich zu entfalten, als außerhalb der Städte. Die Städte wurden zu Metropolen der humanen Rationalität. Wenn in Zukunft in Metropolis solche Festungen wiedererstehen sollen, dann nicht in erster Linie durch neue Konzepte der Stadtplanung, sondern durch die Erweckung der Urbanität Der Metropolenbewohner lebt nicht in erster Linie in Ziegelsteinen, Marmor, Glas und Stahl, sondern in der Architektur des menschlichen Geistes, deren Fundamente jenes menschenwürdige Verhalten bildet, das Urbanität definiert.
Kulturgeschichtler, Stadtsoziologen, Sozialpsychologen und Stadtplaner gingen leider in den vergangenen hundert Jahren zu selbstverständlich von dem Gedanken aus, daß sich Urbanität als rationales menschenwürdiges Verhalten durch entsprechende Planungs- und Baumaßnahmen erzwingen lasse. Die Konzepte der Gartenstädte oder die der Trabantenstädte, die Konzepte der Stadtkernentflechtung von Wohnen und Arbeiten waren sicherlich gut gemeint, und sie dürfen auch in Zukunft nicht als totale Mißerfolge abgeschrieben werden. Wir müssen aber für die Zukunft der Metropolen in Metropolis lernen, daß Urbanität nicht durch Architektur und Stadtplanung hervorgerufen werden kann, sondern daß Urbanität in einer entsprechenden Nutzung von Architekturen besteht, wie auch immer die aussehen mögen.
Jenseits der historischen Analysen wird diese Tatsache für Jedermann empirisch erfahrbar. Man muß nur einmal jene Bewohner der Metropolis beobachten, die sich jede wünschenswerte architektonische Gestaltung ihrer Lebensräume leisten können. Diese Mächtigen von Metropolis besitzen dennoch keine Urbanität als rationales menschenwürdiges Verhalten, an dem sie nicht gehindert werden, weil sie menschenunwürdig hausen, sondern weil ihr strikt funktional bestimmtes Eigeninteresse sie an der Anerkennung verbindlicher rationaler Ideen des gesellschaftlichen Lebens hindert.
Urbane Architektur der Metropolen erzieht uns nicht zu menschenwürdigem Verhalten, zum guten Benehmen unter Kontrolle der Rationalität durch die Kraft der Ausstrahlung von Formen und Materialien; urbane Architektur führt uns die Verpflichtung auf humane Rationalität beständig vor Augen, wenn diese Architektur selber die Kraft zur symbolischen Repräsentanz rationaler Imperative hat.
Selbst die gotische Kathedrale überzeugt nicht durch die architektonischen Ideen und die Manifestation des geradezu ungeheuren Materialreichtums; die Kathedrale hat prägende Kraft, wo sie als symbolische Repräsentation des himmlischen Jerusalems verstanden werden kann. Die klassizistischen Herrschaftsbauten und die zu ihnen gehörenden städtischen Ensembles überwältigen nicht durch schiere Formensprache und materiale Monumentalität; die klassizistischen Herrschaftsbauten gewannen Einfluß, insofern sie dem Willen unterworfen waren, das transindividuelle Ganze der Gesellschaft zu repräsentieren. (79)
Natürlich ist der Einwand richtig, daß im elektronischen Metropolis der Zukunft es immer schwerer werde, die Imperative der humanen Rationalität noch zum Ausdruck zu bringen, sie zu gestalten. Wenn die Straßen in Metropolis zu Flugschneisen werden oder zu einem Geflecht vernetzter Datenstationen und personaler Computer, wenn die Plätze zu Bildschirmen werden und die Gärten zu TV-Studios, dann bleibt für die symbolische Repräsentanz, die ja immer materiell vergegenständlicht werden muß, kaum noch eine der bisher üblichen Realisationsformen. Aber weil gerade in Metropolis alles Design unsichtbar ist und alle entscheidenden Wirkungskräfte weder ertastet, gehört, geschmeckt, gerochen noch gesehen werden können, ist es umso wichtiger, die Imperative der Rationalität im urbanen Verhalten zu manifestieren, also nicht in den technisch rational gestalteten Dingen selbst, sondern im Umgang mit ihnen, dem Gebrauch, den wir von ihnen machen.
Urbanität ist nicht eine Qualität der Städte, sondern ihrer Bewohner
Urbanität wird nach herkömmlicher Auffassung durch Verdichtung erreicht:
a) als architektonische Verdichtung;
b) als soziale Verdichtung durch Steigerung der Bevölkerungszahl und Bevölkerungsvielfalt unter der Prämisse, eine Integration der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu erreichen;
c) als infrastrukturelle Verdichtung der vielfältigsten Versorgungssysteme;
d) als Verdichtung des kommunikativen Beziehungsgeflechts zwischen den Stadtbewohnern sowie zwischen ihnen und ihrer Außenwelt. Urbanität als kulturelle Leitvorstellung ist also auf die Verdichtung des Beziehungsgefüges zwischen Menschen ausgerichtet.
Dieses Beziehungsgefüge bezeichnen wir dann als die Kultur einer Gemeinschaft, wenn die Beziehungen zwischen den Beteiligten auf das Erreichen von Verbindlichkeit ausgerichtet sind, z. B. auf intersubjektiv geltende Handlungsnormen (zumeist institutionell ausgewiesen) im Kontext der jeweiligen Reproduktionsformen der Gesellschaft; auf eingespielte Kommunikationsformen des Selbst- und des Außenbezugs (informelle wie rituelle); auf allgemein zugängliche materiale Vergegenständlichungen von Weltbildern (Religion, Verfassung, Geschichte zumeist in architektonisch definierten Ereignisräumen der Gemeinschaft).
Der beklagte Verlust an Urbanität könnte demnach aus der Schwierigkeit resultieren, derartige Verbindlichkeit in den Beziehungen der Mitglieder einer Gemeinschaft noch zu erreichen. Aber – so wurde vermutet – dieser Verlust an Kultur ist möglicherweise gerade durch zu hohe Verdichtung bewirkt worden. Seit Aristoteles' Zeiten wurde ja immer wieder behauptet, es gebe optimale Größen für Gemeinschaften, die nicht überschritten werden dürften, wolle man die Urbanität nicht gefährden. Jedoch: keine Gemeinschaft kann sich selbst auf diese Größen beschränken. Gerade jene wuchernden Großstädte haben seit dem 19. Jahrhundert für sich Urbanität reklamieren können, die alle spekulativ oder empirisch als optimal erhobenen Größenordnungen sprengten. Man hat allerdings letztere Feststellung zu widerlegen versucht, indem man zeigte, daß nur ein innerer Kern dieser Großstädte tatsächlich über Urbanität verfügte; die nach Bevölkerungszahl und Flächen größeren Randgebiete blieben willkürliche Ansammlungen. Soweit unter diesen Randkulturen homogene Ethnien auszumachen waren, fehlte ihnen gerade deshalb die Urbanität, weil sie homogen waren: zur Urbanität gehört ja gerade die Verdichtung des Beziehungsgefüges heterogener Gruppen. (80)
Es wurde auch vermutet, Urbanität hebe sich selber auf, wenn die Verdichtung des Beziehungsgefüges zu viele Wahlmöglichkeiten für den Einzelnen biete; Überschwemmung mit Ereignisangeboten habe die Folge, keinem Ereignis mehr besondere Aufmerksamkeit widmen zu wollen; die dagegen mobilisierten Überbietungsstrategien brächen zwangsläufig nach kurzer Zeit in sich zusammen, da die Hinwendung auf derartige Auftrumpfereignisse von vornherein durch die Erwartung neutralisiert werde, der nächste Ereignishit könne nur dann einer sein, wenn er den vorhergehenden vergessen mache. Die Hinwendung zu bestimmten Ereignissen werde nicht mehr von übergeordneten Interessen der kommunalen Öffentlichkeit bestimmt, sondern von kurzlebigen privaten Vorlieben; privatistische Beliebigkeit zerschlage Öffentlichkeit. Urbanität sei nicht länger kulturelle Leitvorstellung, wenn sich die Sphären des Privaten und des Öffentlichen nicht mehr vermitteln ließen, wenn also Öffentlichkeit von entsprechenden Interessen fast vollständig privatisiert werde; was Öffentlichkeit noch sein dürfe, bestimmten die Besitzer und Beherrscher der Vermittlungsmedien von Öffentlichkeit.
Die herkömmliche Form, kurzfristige Privatinteressen daran zu hindern, Urbanität einzuschränken oder gar auszuschalten, bestand darin, die Verbindlichkeit im urbanen Beziehungsgefüge durch langfristig festgeschriebene Entwicklungsplanung zu sichern. Es hat sich jedoch herausgestellt:
a) Planung und ihre Verwirklichung sind zweierlei. Gerade in hochverdichteten Gemeinschaften beschleunigt sich die Lebensdynamik derart, daß Planung auf lange Sicht kaum mehr möglich ist. Sie ist schon zum Zeitpunkt ihrer Konzipierung veraltet. Es ist nicht möglich, dieses Manko durch entsprechend angepaßte Verwirklichungsformen auszugleichen, weil alle Produktionsformen inzwischen ihrerseits einen jahrelangen zeitlichen Vorlauf der Planung und Konzipierung benötigen. Was die Zukunft bringt, sind die längst als ungeeignet erkannten Projekte von gestern in Formen, Materialien und Arbeitstechniken, die vor allem ihre eigene Ersetzungsbedürftigkeit signalisieren. Darüber hinaus sind alle Verwirklichungstechniken im Grunde nur durch den Ausschluß von Alternativen zu entwickeln, an denen sie aber umso unnachsichtiger gemessen werden, als diese Alternativen nur Plan bleiben, d. h. nicht von ihrem Selbstwiderspruch eingeholt werden können. (81)
b) Repräsentanten gesellschaftlicher Öffentlichkeit besitzen nur noch formal Legitimation und Autorität, Planungen überhaupt verbindlich werden zu lassen. Die Sachzwanglogik der Alternativen ausschließenden Verwirklichungsstrategien durchlöchert die Planung bis zur Paralysierung.
c) Der Treppenwitz der Sache aber ist, daß vor allem „eiskalt“ durchgesetzte Planung schnellstens ihre eigene Widerlegung nach sich zieht. Insofern hat sich die Ohnmacht der Mächtigen (derer, die verbindlich für alle Urbanität planen dürfen, ihre Pläne aber nicht ohne Rücksicht auf planungsfremde „Sachzwänge“ verwirklichen können) als eine förderliche Voraussetzung für die Entwicklung von Urbanität erwiesen. Wann immer Mächtige mächtig waren, ihre Planungen im Verhältnisse 1 : 1 vom Reißbrett in die Urbs zu übertragen, kamen dabei nur „Idealstädte“ heraus, deren „Urbanität“ der von Lagern, Kasernen und Ghettos glich.
Fazit: selbst wenn wir über eine Polizei radikaler semantischer Überwachung – wenn wir über charismatisch mitreißende oder machttechnisch omnipotente Verwirklichungsstrategen genialster Planungen verfügten, wäre durch deren Wirken Urbanität nicht zu erzwingen. Bestenfalls könnten sie durch ihre Rigidität den Mangel an Urbanität sichtbar und spürbar werden lassen.
Man mag darüber streiten, ob es unseren Nachkriegsstädten an Urbanität mangelt, weil versucht wurde, interessenhörig unvollkommene Pläne zu rigide zu verwirklichen; oder ob gut gemeinte und perfekte Planungen nicht hinreichend unnachsichtig verwirklicht wurden; oder ob die Situation unserer Kommunen durch den Wildwuchs planlosen Aufbauaktionismus’ so entstanden ist, wie wir sie heute allseits beklagen. Auch die wenigen Beispiele situationsangemessener Planungen (variantenreich und fortschreibbar) blieben erfolglos.
Was also ist zu tun? Wir müssen verstehen lernen, daß Urbanität, wie andere kulturelle Leitvorstellungen, nicht in Handlungsanleitungen für die Erzwingung wünschbarer Formen von Gemeinschaften umgesetzt werden dürfen; sie sind vielmehr Vorstellungen, anhand derer wir die je konkret gegebenen Lebensformen und Lebensbedingungen zu beurteilen, d. h. zu thematisieren und zu problematisieren vermögen; sie repräsentieren ein utopisches Potential der Kritik, vor allem der Kritik an Behauptungen, irgendwelche Lebensformen und Lebensbedingungen seien so geschlossen und dicht, daß jedermann sich nur noch der Strömungsdynamik des Lebens zu überlassen brauche, um sich zu entfalten und zu entwickeln. Die kulturellen Leitvorstellungen können, wie die Geschichte lehrt, schwerlich so verwirklicht werden, daß wir ihrer im bloßen selbstverständlichen Lebensvollzug teilhaftig würden. Diese Leitvorstellungen dürfen tatsächlich nur Vorstellungen sein, denn nur solange vermögen sich Mitglieder einer Gemeinschaft gleichermaßen auf sie zu beziehen. Erst in dieser gemeinsamen Hinwendung nutzen wir die kulturellen Leitvorstellungen als tertium conjunctionis, also zur Begründung von Gemeinsamkeit. Menschen brauchen nun einmal Begründungen für ihr Handeln, vor allem wenn sie gemeinsam handeln: solche Begründungen als Rechtfertigungen sind billig zu haben (mit Vorliebe von Wissenschaften). Ob diese Legitimationen allgemein anerkannt werden oder nur partiell – was aus ihnen architektonisch abgeleitet wird (zumeist als Katastrophe), kann nicht rückgängig gemacht werden, indem man gegenläufige Begründungen und Handlungen nachschiebt; (es ist ja ohnehin klar, daß alle nur das Beste wollten und daß sie sich deshalb in jedem Handeln als Planen und Verwirklichen gerechtfertigt sehen). Wenn es zur Katastrophe gekommen ist, ziehen sich alle auf die tatsächlich richtige Feststellung zurück, die Konsequenzen eines Handelns seien für niemandem in vollem Umfang absehbar; wieso wird aber dann immer noch geplant, als sei das möglich? Eben darum erfüllen die kulturellen Leitvorstellungen ihren Zweck nur dann, wenn wir aus ihnen eine prinzipielle Kritik unseres Handelns als Verhältnis von Planen und Verwirklichen entwickeln.
Beispiel: Eine Kommune, die der Urbanität derart ermangelte, daß selbst die den Rat beherrschenden Privatinteressenvertreter das beklagten, lud mich ein, Vorschläge zur Besserung zu entwickeln. Ich hätte mich doch seit 25 Jahren zumindest mit dem Problem befaßt, kennte viele Städte, von denen man annehmen müsse, sie verfügten über Urbanität („warum sonst reisen da die Leute mit Begeisterung hin?“), und wisse deshalb wohl auch Rezepte zur Stärkung der Urbanität an diesem Jammerort der Republik. An Ort und Stelle demonstrierte ich einer lernbegierigen Zuhörerschaft, daß Urbanität durch noch soviel Einpflanzen preisgekrönter Architekturen kaum zu erzwingen sei. Ich begann, die Zuhörer dazu anzuleiten, ihre Stadt als das zu sehen, was sie wirklich ist und sie möglicherweise gerade deshalb lieben zu lernen, weil sie jedermann auf Schritt und Tritt dazu stimuliere, sich vorzustellen, wie denn eine Stadt und das Leben der Bürger in ihr auszusehen hätte, damit sie als urban, als schön, als heimatlich empfunden werden könne. Ich zeigte ihnen, daß das, was sie heute als abgrundtief häßlich in ihrer Stadt empfinden, die Schönheit von vor 30 Jahren gewesen ist, eine durch den Wandel der Zeiten bedingte Form der Häßlichkeit des Schönen, und ich zeigte ihnen die Schönheit der häßlichen Fragmente und Ruinen ihrer Stadtarchitektur – schön, weil diese Ruinen und Fragmente die Sehnsucht nach Schönheit und Vollkommenheit in der Vorstellung der Stadtbewohner zu wecken vermögen. Wir übten dann in der Begehung der Stadt den Balanceakt zwischen der Häßlichkeit des Schönen, das uns unser Denken und Fühlen zu Stein werden läßt, und der Schönheit des Häßlichen, das uns zu der Einsicht zwingt, noch so vollkommen und schön gestaltete Architektur bleibe nichts als tote Materie, solange wir sie nicht durch unser Denken und Fühlen mit Bedeutung zu beleben vermögen. Von dem Fragmentarischen und Ruinösen, dem Unvollkommenen und Provisorischen werden wir aber sehr viel intensiver und auch leichter zur Entwicklung eben dieses Bedeutungsgefüges veranlaßt. Wenn wir Architekturen und andere gestaltete Objekte des städtischen Lebensraums zu nutzen wissen, um über sie miteinander zu kommunizieren, dann entsteht Urbanität. Es komme also darauf an, sich miteinander die Stadt, wie sie nun einmal gegeben ist, zu erschließen, indem man sie zum gemeinsamen Thema von Geschichten und Geschichte macht. Und siehe da: die eben noch irgendwelchen Kulturbringern mit Heilserwartungen entgegenharrenden Bürger begannen, Geschichten zu erzählen, von denen sie bisher nicht einmal ahnten, daß es sie in ihrer Stadt überhaupt geben könne. Die angeblichen Hinterwäldler einer desaströsen mittelgroßen Stadt entwickelten urbane Züge, wie sie nur je irgendwo angetroffen werden können. Ich demonstrierte ihnen, daß auch die Einwohner Berlins nicht allein durch den Aufenthalt an dem geografisch, historisch und architektonisch definierten Ort „Berlin“ schon in den Genuß von Urbanität kämen. Um das zu erreichen, hätten auch die Bewohner herkömmlich als urban beurteilter Metropolen die gleiche Arbeit der Aneignung zu leisten wie die angeblich armen Provinzler.
In der Tat ist es sinnvoll, Provinz und urbane Metropole danach zu unterscheiden, was wo mit welchem Anspruch zum Thema erhoben wird. Provinz ist heute überall, denn auch in den Metropolen gibt es nur wenige urbane Menschen. Urbanität ist nicht eine Qualität der Städte, sondern ihrer Bewohner. Kulturbegründende Verbindlichkeiten stecken nicht in Marmor, Stein und Eisen, sondern in der Art und Weise, wie Menschen leben und das heißt in erster Linie, in welchem Beziehungsgefüge sie leben. Auf das Beziehungsgefüge kommt es an, deswegen helfen noch so gut gedachte und noch so detailliert entwickelte „neue“ Lebensformen einzelner gegeneinander abgeschotteter Kleinstgemeinschaften (von der Kleinfamilie bis zur New-Age-Sekte) nichts zur Entwicklung von Urbanität. Als vorläufiger Schutz vor dem bedrohlichen Mangel an Urbanität mögen diese „erfundenen“ Lebensformen durchaus hilfreich sein; je mehr man sich aber auf sie einläßt, desto schwieriger wird es, einen Eigenbeitrag zur Entwicklung von Urbanität zu leisten. Die gestalteten Anleitungen zur Urbanität auf Straßen, Plätzen und in den Parks, also die Architektur der Städte, definiert nur den Ort und den Rahmen, an dem und in dem sich die Beziehungen zwischen Menschen zu Lebensformen verdichten können. Urbanität herrscht nicht auf Plätzen, Straßen und in Parks, wenn sie nicht von den Menschen getragen wird, die diese Orte beleben. In diesem Sinne hängt die Zukunft der Städte nicht in erster Linie von ihrer architektonischen Gestaltung ab, sondern von den angemessenen Formen des sozialen Verhaltens, eines Verhaltens also, das sich auf Verbindlichkeit verpflichtet.
Provinz ist auch in der größten Metropole
Nach weit verbreiteter Auffassung wird die allgemeine Kulturdynamik durch den Konkurrenzkampf der Spitzenleistungsträger bestimmt; soll heißen, in den wenigen Metropolen der Kunst (z. B. Köln) werde darüber entschieden, wer zur 1. Liga gehört und am großen Rad des Kulturbetriebes mitdrehen dürfe – und sei es als aufs Rad geflochtene Schwungmasse. Entsprechend klassifizieren die Hochleistungsträger alle weniger herausragenden Künstler als Provinzler. Das hat wenigstens in einer Hinsicht sein Gutes; denn damit wird auch Köln insofern Provinz, als dort nicht nur Spitzenkünstler ihr Wesen treiben. Solche Abqualifizierung des Provinziellen hatte in der Geschichte aber nur selten Erfolg. Die Kunstgeschichte belegt schlagend, daß Künstler und Werke, die in Metropolen Spitzenplätze auf der Erfolgspyramide einnahmen, damit noch keineswegs für die zukünftige Entwicklung als bedeutsam gesichert waren; und daß angeblich provinzielle Größen, vielmehr Nichtgrößen zum Fokus unerwarteter, aber folgenreicher Konstellationen werden konnten, weil die später als erstrangig erkannten Werke gerade in der relativen Abgeschiedenheit der Provinz wachsen konnten.
Die Stigmatisierung der Provinz zum Lebensraum der Zweit- und Drittklassigen ist vor allem deshalb unsinnig, weil ja zentrale Spitzenleistungen als solche nur mit Blick auf die breite Basis der in provinzieller Anonymität Lebenden erkannt und gewürdigt werden können. In dieser Hinsicht wäre es besser, von der Provinz als der Basis zu sprechen, weil sich ja inzwischen herumgesprochen hat, welche enorme Bedeutung der Arbeit an der Basis zukommt, um je Spitzenleistungen erreichen zu können. Wie das desaströse Beispiel der Förderung von sportlichen Spitzenleistungen jüngst wieder belegte, bringt die vorrangige Förderung der Spitzenleistungen so gut wie gar nichts, es gilt vielmehr, gerade die breite Basis so weitgehend zu fördern, wie das nur immer möglich ist. Spitzenkünstler brauchen weder Kunst-Akademien noch Vermittlungsbemühungen oder dergleichen; soweit sie eben tatsächlich als erstrangig von den Kunstkritikern, Galeristen, Museumsdirektoren erkannt und anerkannt sind, assoziieren sich ihnen so viele Interessenten, daß sie auch ohne besondere Förderung als Spitzenkräfte ihren Weg machen. Der Förderung bedürfen aber alle „Provinzler“, damit sie sich soweit entfalten können, bis über ihre Arbeit überhaupt ein Urteil möglich wird. Wer nach solchem Urteil aber als „Provinzler“ etikettiert würde, hätte dennoch sinnvolle Arbeit zu leisten. Man lernt ja nicht nur zu lesen und zu schreiben, um Schriftsteller zu werden. Der malende oder anderweitig gestaltende Provinzler mag als Künstler weniger Aufmerksamkeit verdienen, aber als jemand, der über bildsprachlichen Ausdruck mit den Menschen seiner Lebensumgebung zu kommunizieren versteht, trägt er Wesentliches zur Herausbildung differenzierter Formen der Kommunikation bei. Auf diesem Wege leisten die angeblichen Provinzler für die allgemeine Anerkennung der bildenden Künste mehr als die herausragenden singulären Meisterkünstler, deren Geniezauber eher davon abhält, das künstlerische Schaffen als eine Form des Arbeitens unter vielen anderen anerkennen zu können.
Kulturarbeit in der Provinz, also an der Basis, verliert allerdings viel von ihrer Glaubwürdigkeit, wenn sie an Kriterien orientiert ist, die sich aus den jeweils aktuellen Spitzenleistungen ableiten lassen. Insofern ist die Arbeit an der Basis auch sehr viel schwieriger als die Arbeit in den überschaubaren Höhen des Außerordentlichen. Sie muß sich ihre Kriterien selbst erarbeiten. Daß die provinzielle Basis häufig so „alt“ aussieht, so privat und kleinteilig, hat gute Gründe, gute!, eben solche, die für die Basisarbeit in Anspruch genommen werden müssen, und nur für sie. Man muß sich also zum Provinzialismus, zur Basisarbeit bekennen, anstatt sich schamvoll hinter Schlagwortetiketten des kulturellen Highlife zu verstecken, Provinzialismus im herkömmlichen, abschätzigen Sinn bezieht sich ja auf eben jene Falschetikettierung der Normalleistung als bloßer Unfähigkeit zur Spitzenleistung. Je weniger man als provinziell gelten will, desto eindeutiger muß man sich darauf einlassen, daß die Arbeit an der Basis ganz eigenen Kriterien zu folgen hat.
Ausstellungen in der Provinz sind dann gelungen, wenn sie uns diese Kriterien vor Augen führen. Leider gelingt das seltener (weil es eben schwerer ist) als die glanzvolle Präsentation der Einmaligkeiten, mit denen sich der Kulturbetrieb so gerne legitimiert.
Fazit: Die Basis ist häufig schmaler als die Spitze!
• (75) Heinrich Klotz: Moderne und Postmoderne. Architektur de Gegenart 1960 – 1980, Braunschweig/Wiesbaden 1984, S. 34 f. („Bauwirtschaftsfunktionalismus“)
• (76) Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen, Stockholmer Gesamtausgabe, Frankfurt 1956. (Zum Wandel seiner Auffassung s. die Einleitung von Erika Mann.)
• (77) Walter Grasskamp: Unerwünschte Monumente, Moderne Kunst im Stadtraum, München 1989.
• (78) Wolfgang Körber: Bauen für den Augenblick / Kommunikationsbauten / Architektur am Bau, Retrospektivausstellung, Köln 1990.
• (79) Franco Borsi: Die monumentale Ordnung, dt. Stuttgart 1987.
• (80) Hannelore Schneider-Kuszmierczyk: „Urbanität und Ideologie. Zur kritischen Rekonstruktion eines funktionalisierten Begriffs“, Kassel 1986.
• (81) Lucius Burckhardt: „Wer plant die Planung?“, in: L.B., „Die Kinder fressen ihre Revolution“, Köln 1985, S.356 ff.