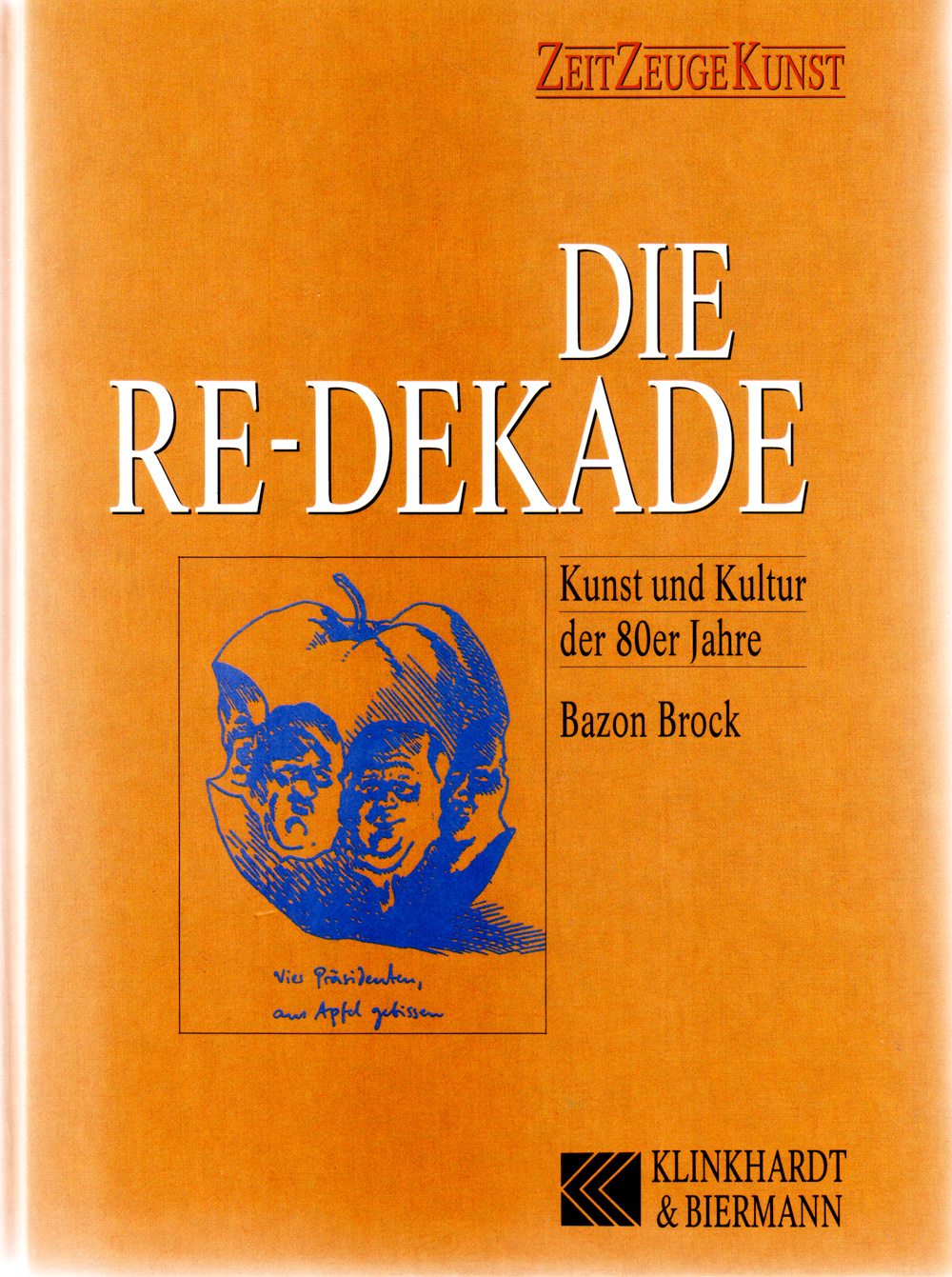Im öffentlichen Bewußtsein sind Kulturschaffende aller Sparten und Funktionen zwar einerseits immer noch die armen Brüder, die man mit Verweis auf den Anspruch, eine Kulturgesellschaft zu sein, durch gnädige Gewährung von Subventionen überlebensfähig erhält. Andererseits hat sich bis auf die kommunalpolitische Ebene die Erkenntnis durchgesetzt, daß es bei der Kulturpolitik um harte ökonomische Tatsachen geht und daß mit der Kulturpolitik eigentlich Probleme der Arbeitsplatzbeschaffung, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Infrastruktur angegangen werden.
Längst werden zum Beispiel große Ausstellungen nicht mehr nur mit dem Argument durchgesetzt, daß sie sich auf dem Umweg über den zu erwartenden zusätzlichen Umsatz von Hotels, Restaurants und Verkehrsbetrieben rentieren. Man hört vielmehr, große Unternehmen entschieden sich für ihre Standorte vor allem auch mit Blick auf die kulturelle Infrastruktur. Selbst pingelige Stadtkämmerer stimmen für die, abstrakt gesehen, hohen Theateretats, weil sie verstehen, daß 80% der Etats für Gehälter, Materialien, Transporte etc. ausgegeben werden und nur etwa 20% der Etats der künstlerischen Arbeit qua Theaterinszenierung zufließen. In vielen Instituten bleibt von der angeblichen Subvention künstlerischer Arbeit gar nichts mehr übrig, da der gesamte Etat für die Sicherung der Arbeitsplätze und der Basisfunktionen gebraucht wird.
Unter diesen sozialpolitischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen, wird der Kultursektor sowohl absolut wie relativ weniger subventioniert als zum Beispiel die Landwirtschaft oder der Bergbau, der Verkehr oder der Airbus.
Die einzigen, die nicht wagen, mit diesen neuen Tatsachen in ihrem eigenen Interesse zu argumentieren, sind die Kulturschaffenden selber. Sie scheinen immer noch von dem Bewußtsein geduckt zu werden, per Gnadenakt der Subvention in gesellschaftlichen Nischen überleben zu müssen und recht und schlecht auch überleben zu können, wofür sie sich gern dankbar zeigen. Sie verharren offensichtlich in diesem Bewußtsein, weil sie sich den neuen Anforderungen nicht gewachsen fühlen.
Die in die Kulturinstitutionen strömenden Massen sind kaum noch zu bändigen. Ihrer „Betreuung“ opfern die Profis ihre Zeit und Energie. Sie sehen sich zu Kindergärtnern umfunktioniert, was ihnen umso unerträglicher zu sein scheint, als sie für diese Aufgabe nicht ausgebildet sind und ursprünglich auch geglaubt hatten, anderen Arbeitsinhalten und Arbeitsformen sich widmen zu können. Es ist verständlich, daß da manche in lähmende Ohnmacht oder ohnmächtige Wut verfallen: Soll der oberflächliche Massenzirkus endlos so weitergehen? Wie ist aus der ziellosen Beliebigkeit solchen Tuns herauszukommen? Jedenfalls nicht so, wie es zum Beispiel das Centre Pompidou versucht: Es sichert den Bau gegen die statische Mehrbelastung steigender Besucherzahlen technisch ab, und es versucht, noch mehr Ausstellungsräume mit noch attraktiveren Programmen im Haus unterzubringen, indem es die zentrale Verwaltung auslagert (das Centre Pompidou hat gegenwärtig täglich 28000 Besucher zu verkraften; die Hochrechnungen ergeben schon für das nächste Jahr einen täglichen Besucherdurchlauf von nahezu 40000).
Ebensowenig läßt sich gegen den zerstörerischen Erfolg angehen, indem man, wie in Japan geschehen, den Zugang zur Ausstellung „Das Gold der Pharaonen“ strikt reguliert, was u.a. dazu zwang, die Verweildauer des einzelnen Besuchers vor den Highlights der Ausstellung auf 30 Sekunden zu beschränken.
Auch ein dritter Vorschlag, sich vom Erfolg beim Massenpublikum nicht zerstören zu lassen, dürfte wenig helfen; man schlägt vor, die Besucherströme aus den großen Attraktionszentren in jene Kulturinstitutionen umzuleiten, die heute noch relativ wenig nachgefragt werden. Aber diese „Provinzmuseen“ können ja in ihrem Schlummer nur deswegen noch verharren, weil sie sich uninteressant geben. Wenn sie sich ihrerseits für ihre lohnenswerte Interessantheit ins Zeug legen würden, hätten sie bald dieselben Probleme wie die Institutionen, die bereits für das Massenpublikum eine Interessantheit nach der anderen bieten.
Wer sich dem Erwartungsdruck des Massenpublikums anpaßt, kann ihn auch nicht bändigen, indem er etwa sein konservatorisches Gewissen geltend macht oder aber nachweist, daß die horrend steigenden Transport- und Versicherungskosten des internationalen Kulturwanderzirkus' nicht mehr aufzubringen seien.
Für ein Museum unter den Aspekten seiner tradierten Zielsetzungen ist das selbstverständlich alles nicht mehr zu rechtfertigen. Aber eben um diese Ziele geht es dem Wanderzirkus nicht mehr. Er versteht sich ohne Scheu als Wirtschaftsunternehmung mit kulturellen Gütern, wobei die Kulturgüter Vorwände – oder besser Veranlasser – der wirtschaftlichen Unternehmung sind. Wie sollten die Hunderttausende von Reisebüros, Transportfirmen, Hotels, Restaurants, Boutiquen, Andenkenläden die Publikumsmassen zum Beispiel zum Besuch von Paris überreden, wenn nicht mit dem Hinweis auf die dort vorhandenen Kulturgüter, von der Mona Lisa bis zum Arc de Triomphe?
Bei dem gegebenen Sättigungsgrad mit anderen Wirtschaftsgütern ist die Konfrontation mit kulturellen Gütern als Veranlassung wirtschaftlicher Unternehmungen noch enorm steigerungsfähig, sowohl mit Blick auf die einzelnen Kulturveranstaltungen wie mit Blick auf den gesamten Bestand der bisher in Depots ruhenden Objekte und im Hinblick auf die Vermehrung durch Neuschaffen zeitgenössischer Künstler.
Für die Aktivierung der Depotbestände werden immer neue Museen geplant und gebaut (Tausende von Museen ließen sich noch als Attraktionszentren etablieren). Angesichts dieser Tatsachen schrumpfen museologische Überlegungen zur Planung von Besucherverkehrsordnungen zur Abwicklung von Geschäften.
Eine noch so bemühte Arbeit an Ausstellungskatalogen wird zwangsläufig zur Schaffung eines Kaufvorwandes: Lesen kann diese Kataloge längst niemand mehr. Ein irrwitziger Zirkel hat sich etabliert: in den Ausstellungen kann man sich unter den gegebenen Bedingungen nur flüchtig auf die Exponate einlassen; so kauft man den Katalog, um im Nachhinein die Konfrontation zu vertiefen. Bevor man den Katalog auch nur etwas ausführlicher durchgeblättert hat, besucht man eine andere Ausstellung und so fort. Wenn andererseits Kataloge auf sinnvolle Weise schmal gehalten werden, scheinen sie dem Besucher nicht attraktiv genug, um sie zu erwerben und den Veranstaltern nicht attraktiv genug, um für sie einen hohen Preis zu erzielen.
Was also tun, wenn man den Erwartungen der Öffentlichkeit, der Wirtschaft, der Sozialpolitik sich nur um den Preis entziehen kann, in weitgehender Wirkungslosigkeit der eigenen Arbeit zu versumpfen? Was tun, wenn man sich nicht auf die Haltung eines dankbaren und unterwerfungsbereiten Gnadenbrotempfängers verweisen lassen will? Was vor allem bleibt zu tun, wenn man gegen die hier skizzierten Entwicklungen nicht einfach einwenden kann, sie seien kurzfristige Modeerscheinungen oder regulierbare Auswüchse, weil es einem langsam dämmert, daß an der Kulturarbeit in gewissem Sinne das gesamte Schicksal der Volkswirtschaft hängt? Es dämmert sogar dem Innenminister der Republik, und er gab beim Ifo-lnstitut in München eine Studie über volkswirtschaftliche Aspekte des Kulturschaffens in Auftrag. (64) Was die Münchner Forscher 1988 zutage brachten, ist bedeutsam genug, geht aber vollständig an den tatsächlich notwendigen Fragestellungen vorbei. Wo die Münchner feststellen, daß die Kultur immerhin zwischen 2 und 3% zum Bruttosozialprodukt beiträgt, haben sie diese Zahl nur an kulturellen Tätigkeiten im allerengsten Sinne festgemacht. Aber in volkswirtschaftlicher Hinsicht ist kulturelles Schaffen als Theater, Ausstellung, Konzert, Bücherverlegen, Programmemachen für Film, Fernsehen und Rundfunk völlig unerheblich. Kulturelle Leistungen gehen in die Produktion wirtschaftlicher Güter da ein, wo diese Güter als je besonders gestaltete oder auf besondere Funktionen und Kontexte ausgerichtete am Markt gehandelt werden.
Bleiben wir nur beim Design als Oberflächenfinish oder als Formgebung der Güter. Schlechterdings ist auch nicht mehr der kleinste Bestand an Objekten unserer Lebenswelt nicht gestaltet. In jedes, in tatsächlich jedes Produkt gehen kulturelle Distinktionsleistungen ein, von den kulturell erarbeiteten Sinnzusammenhängen ihres Gebrauchs und ihrer ideellen Wertigkeit ganz zu schweigen.
Die künstlerischen Aktivitäten im engeren Sinne (also als Malerei, Skulptur, Theater, Komposition etc.) haben ihre unmittelbare Wirksamkeit für die Gesellschaft in diesem Einfluß auf die Gestaltung unserer Lebenswelt. Sie sind zu einer entscheidenden Ressource geworden („Kultur ist Rohstoff“, sagt Karla Fohrbeck, „der die herkömmlichen wirtschaftlichen Umformungsprozesse speist.“) (65) Institutionen, die Kultur im engeren Sinne zum Gegenstand ihrer Arbeit machen, können sich also auch deswegen auf herkömmliche Vermittlungsformen nicht mehr beschränken, weil die Bedeutung von Malerei, Skulptur etc. gerade in ihrer Wirkung auf die Gestaltung unserer Lebenswelt liegt. Wie man die Sache auch dreht und wendet, es gibt kein Zurück hinter die Dornröschenhecken der herkömmlichen Kulturinstitutionen; man kann sich der Einsicht nicht verschließen, daß alle Aktivitäten mittelbar oder unmittelbar an wirtschaftliche Unternehmungen gekoppelt sind, ja, sie zu einem erheblichen Teil überhaupt in Gang halten – und wir haben es jetzt erst mit dem Vorschein von Entwicklungen zu tun, die diese Tendenzen zu den beherrschenden des gesellschaftlichen Wandels werden lassen.
Museen sind Schöpfer von Zeit
In gesellschaftlicher Hinsicht findet Musealisierung als Besetzung der Museen durch Sponsoren statt. Für sie sind Museen gesellschaftlich ausgezeichnete, bemerkenswerte Orte, deren behauptete Erlebnisqualität und Ereignisdichte sie für PR-trächtige Veranstaltungen prädestiniert. Das Museum wird zum Ereignisort für den Vollzug gesellschaftlicher Rituale, die anderen Ortes nicht mehr stattfinden können, es sei denn, diese anderen Örtlichkeiten hätten als Schlösser, Ruinen, Kulturdenkmäler selber einen musealen Wert.
Gesellschaftliches Leben als kulturelles Ereignis (wie es zum Beispiel ein Fest darstellt) ist immer an geeignete Orte gebunden, die den Teilnehmern durch ihre Aura die Einhaltung von Ritualen nahelegen. Je schneller sich die Kulturrituale, also zum Beispiel das Feste-Feiern, zu fast alltäglichen Veranstaltungen entwickelten, desto unverbindlicher und beliebiger wurden die Rituale, denen nur noch ein ausgezeichneter Festort ein stützendes Gerüst sichern konnte.
Die Musealisierung beliebig gewordener Rituale ist im Museum besonders leicht möglich, weil das Museum über seine Kunstwerke historische Passepartouts für Ritualisierung anbietet (Historienbilder, Gruppenportraits, Genrebilder, Veduten) und weil das Museum als gesellschaftliche Institution Lebensformen des feudalen und bürgerlichen Zeitalters vergegenwärtigt.
Der Aufenthalt in solchen Museen konditioniert das Verhalten der Besucher selbst dann, wenn die Besuchergruppe nicht homogen ist. (Sogar an Privatbesuchern kann man diesen Konditionierungseffekt ablesen: Verlangsamung der Bewegungsabläufe, Vermeidung von Spontanäußerungen, Einschränkung der Sprechlautstärke, hypnotische Konzentration des Blicks, offenbarungsbereite Öffnung des psychischen Systems – diese Konditionierungseffekte des Museums sind auch unabdingbare Voraussetzungen für jeden Vollzug anderer sozialer Rituale.)
Kein Wunder, daß Museen heute die bevorzugten Architekturen der Rituale sind – allerdings um den Preis, daß die Rituale selber musealisiert werden, und zwar auch solche normativ gesteuerten Verhaltensweisen, die ursprünglich nicht durch das Museum und im Museum entwickelt wurden. Dafür ein Beispiel: Vom neu erbauten Museum Ludwig in Köln schaut man durch eine bewußt gesetzte Öffnung der Architektur auf den nahen Kölner Dom. In dieser Konfrontation wird der Dom selber zu einem Museum der Ausstellung des Ritualverhaltens von Gläubigen, während die Betrachtung der zum Dom gehörigen Sakralmalerei im Museum Ludwig zum Ritual des säkularisierten Glaubens an die Werte der Kunst wird. Wie weit diese Verschränkung geht, zeigt die folgende, im Raum Köln viel beachtete, aber nicht wirklich verstandene Geschichte: Eine Eifelbäuerin besuchte in regelmäßigen Abständen ein Altarbild, das aus ihrer Heimatkirche wegen seines künstlerischen Wertes in ein Kölner Museum verschleppt worden war, um vor diesem Bild, wie sie es jahrelang getan hatte, zu beten. Eine im Museum vor Bildern betende Bäuerin — eine Zumutung für den Bildungsbürger; ein betriebsstörendes Ärgernis für die Museumsleitung, die der Bäuerin mit Verweis auf die Besucherordnung förmlich und drastisch nahezubringen hatte, derlei Mißbrauch des Museums gefälligst zu unterlassen! Statt der Bäuerin dürfen nun besser konditionierte Liebhaber und Sponsoren der Kunst ihr Selbstverständnis im Museum ritualisieren, um dem Glauben an die Werte der Kunst sichtbaren Ausdruck zu verleihen. (66)
In polit-ökonomischer Hinsicht wird Musealisierung betrieben, indem man den Museumswerken die Funktion von Urmetern des Kunstmaßstabs zugesteht. Die Aufnahme ins Museum wird (selbst wenn das die Kuratoren weit von sich weisen) mit einem säkularisierten Wandlungsläuten begleitet, das als Applaus für Künstler und Werk nach außen dringt! Kurios genug: auch avancierte Künstler versprechen sich offenbar viel für die Konsensfähigkeit ihres Tuns, wenn sie in ihren Katalogen berichten können, in möglichst vielen, möglichst großen und damit offenbar bedeutenden Museen vertreten zu sein; da ist dann nicht mehr von der viel beschrieenen, bloß persönlich getroffenen Entscheidung der Direktoren und Kustoden die Rede, nach der sie ihre Werkauswahl treffen.
Die Institutionalisierung des Kunsturteils folgt ökonomischen Gesichtspunkten, gerade weil kunstgeschichtliche und ästhetische Kriterien nicht mehr allgemein anerkannt werden. Überhaupt ist der Aufbau der kulturellen Infrastruktur, zu der Museen erstrangig gehören, inzwischen weitgehend von kultur- und bildungspolitischen Überlegungen abgekoppelt worden. An ihre Stelle traten arbeitsmarktpolitische, investitionspolitische und sozialpolitische.
Musealisierung sorgt für die Konsensfähigkeit von kommunalen Entscheidungsgremien. Diese politökonomische Dimension von Musealisierung wird weiter zunehmen, weil die Kultur als politneutraler, angeblich ideologiefreier Bereich der Gesellschaft Werte und Sinnhaftigkeit so generiert, daß durch sie kaum politischer Streit provoziert wird.
In volkswirtschaftlicher Hinsicht wird der Arbeit in den Sphären der Künste und der Kultur schon bald eine Bedeutung zuwachsen, die anzuerkennen vielen Künstlern, Museumsarbeitern und Kulturrepräsentanten, ja selbst vielen Unternehmern schwerfällt.
Wenn die in den Industrieländern für den Markt produzierten Güter in technischer Leistung und materialer Verarbeitung kaum noch zu unterscheiden sind, und wenn deren Funktionszuweisung fast in der ganzen Welt die gleiche ist, dann können sich diese Güter voneinander nur noch durch den Anteil kultureller Wertigkeiten unterscheiden, die ihnen vornehmlich durch das Design und die Werbung mitgegeben werden können. Diese den Produkten zugeschriebenen kulturgeschichtlichen, stilistischen, ästhetischen Wertigkeiten müssen der Wirtschaft von Kulturarbeitern aller Sparten zur Verfügung gestellt werden. Bereits jetzt verkauft sich die Mehrzahl aller produzierten Güter nur noch durch kulturelle Distinktionsleistungen und nicht mehr durch die rein technisch funktionale und materiale Umgestaltung in Verschleiß- und Innovationszyklen. Diese kulturellen Distinktionen sind nur durch Musealisierung historischer Lebensformen und die Neutralisierung ihrer historischen Einmaligkeit zu erreichen (wir erwarten demnächst die ersten Großraumflugzeuge im gotischen Stil).
In wissenschaftlicher Hinsicht stellt die Musealisierung eine der wenigen völlig unschädlichen Formen des Aus-der-Welt-Bringens dar; allgemein liefert ja die Kunst ein Paradigma für menschliches Tun ohne Folgen, und nach diesem Typus des Handelns besteht gegenwärtig große Nachfrage. Wo bisher alle Anstrengungen darauf gerichtet waren zu produzieren und auch das Konsumieren nur wiederum als Produktion von Abfall bemerkenswert wurde, liefert die Musealisierung ein Beispiel für das Aus-der-Welt-Bringen, das zumindest so kontrolliert stattfindet wie das ln-die-Welt-Bringen durch schöpferische Produktion. (67)
Wissenschaftlich gesehen, gelingt es der Kunstproduktion bisher am besten, dem Gebot zu genügen, menschliches Handeln so wenig wie möglich mit irreversiblen Folgen zu belasten. Wo diese Folgen dennoch auftreten könnten, wird durch Musealisierung jede Bestimmtheit und jeder Wirkungsanspruch der Werke relativiert, wenn nicht gar abgewiesen. Denn Musealisierung entlastet ja auch von den Wahrnehmungs- und Handlungsappellen, die die Werke an uns richten. Die Tafel wird leergeräumt, ohne das Abgeräumte zu Abfall zu verwandeln. Die archivierten und thesaurierten Bestände dienen als Barrieren gegen die bloße Anmaßung von vermeintlich Neuem und gegen die Überwältigung durch das bisher noch nicht Gesehene.
Das wissenschaftliche Prinzip der Musealisierung wird mit allem fertig, weil es rein formal und methodisch gleichförmig vorgeht, eine Haltung, die man sich außerhalb des Schutzbereichs wissenschaftlicher Musealisierung nicht leisten konnte. Auch auf der privaten Ebene spielt diese Form der Musealisierung eine immer größere Rolle: Es gibt ja kaum noch einen Fußnotenträger welchen menschlichen Handlungsbereichs auch immer, der sich nicht veranlaßt sähe, sich eine Biographie durch Musealisierung seines Lebens zuzulegen. Museumskunde bei Privatpersonen ist zu einer Behälterwissenschaft geworden, die die alten Schuhkartons mit Familienfotos und die Koffer mit persönlichem Krimskrams des gelebten Lebens umstülpt, chronologisch oder sonstwie ordnet, mit Anmerkungen bestückt, kommentiert und liebevoll konserviert. Alltagsgeschichten von Alltagsmenschen hat diese Behälterwissenschaft in den vergangenen Jahren zu Tausenden hervorgebracht; sie stülpte sogar die Inhalte privater Köpfe aus, um sie als Quelle und Faktum erzählter Geschichte den Archiven einzuverleiben. (68)
Nachdem wir wissen, daß auch große Männer nicht mehr Geschichte machen, sondern daß die Geschichte die zu ihr passenden Menschen formt, erzählen wir uns unsere Geschichten, um unser Leben als das von tatsächlich lebenden Menschen erfahrbar werden zu lassen.
Geschichte ist geschichtetes, verknüpftes Geschehen, und die Verknüpfung jener Inhalte des Gedächtnisses und anderer Behälter leistet die Erzählung. Das Musealwerden des eigenen Lebens steuert auch das zukünftige Leben, wenn es die Lebenden dazu anhält, ihre eigene Erzählung in die Zukunft fortzusetzen – in der Zukunft also so zu leben, daß es darüber etwas zu erzählen gibt. Sammler und Jäger der Spuren und Zeichen des eigenen Lebens verändern in einer doch wohl wünschenswerten Weise die Einstellungen und Haltungen: sie lassen sich weniger schnell in die Rolle der Opfer zwängen; sie sind verantwortungsbewußter gegenüber sich selber und gegenüber ihrem Leben mit anderen: sei es drum — leben, um eine Biographie zu haben, ist ergiebiger, als ein Leben in der bewußtlosen Wiederholung des Lebens selbst.
Alle Geschichtsschreibung ist auf die Gegenwart der jeweiligen Lebenden und nicht auf die Vergangenheit ausgerichtet. Geschichtenschreibung als Form der Musealisierung ist nichts als der Versuch, sich eine den gegenwärtigen Umständen und den optativen Zukünften entsprechende Vergangenheit zuzulegen. Die wirksamste Art, auf die Zukunft einzuwirken, ist die, sich andere Vergangenheiten zu erarbeiten; (69) denn jede Gegenwart ist im Sinne der Musealisierung eine zukünftige Vergangenheit. Die Fähigkeit, sich seine eigene Gegenwart und die an sie geknüpften Zukunftserwartungen als zukünftige Vergangenheit so zugänglich zu machen, wie uns alle Vergangenheiten zugänglich zu sein scheinen — diese Fähigkeit erwerben wir durch die Pompejianisierung unseres Blicks. (70) Die Pompejianisierung ist eine Art experimenteller Geschichtenschreibung; sie stellt unsere Gegenwart probeweise still, wie die Lava des Vesuvs das Leben im römischen Pompeji des ersten nachchristlichen Jahrhunderts stillstellte. Innerhalb der realen Geschichte und ihrer sozialen Lebensvollzüge sind ja Experimente nicht möglich, da Experimentalzeit und Realzeit zusammenfallen. Bei der virtuellen Pompejianisierung läßt sich der Realverlauf des gegenwärtigen Lebens als Experiment sub specie futurae stillstellen.
Wie kann gegenwärtige Zeit unter dem Blick aus der Zukunft stillgestellt werden, um die Gegenwart als zukünftige Vergangenheit erfahrbar zu machen? Wohl nur durch die Verwandlung der Vergangenheit in eine Gegenwart. Diese Verwandlung der Vergangenheiten in Gegenwart ist der eigentliche Sinn der Geschichtenschreibung, die logischerweise nur die Mitlebenden und nicht die Toten zu Adressaten werden lassen kann. Die Toten hören zwar mit, haben aber keine andere Stimme als die der jeweils Lebenden.
Die experimentelle Vergegenwärtigung der Vergangenheit sub specie futurae (also die Erfahrung der Gegenwart als zukünftiger Vergangenheit und der Vergangenheit als gewesener Zukunft – in den Zeitformen der Sprache als ‚vollendete Zukunft‘ und nicht ‚abgeschlossene Vergangenheit‘ ausgewiesen) ist nach meiner Erfahrung zum Beispiel so möglich: Man stelle sich vor, das Jahr 1990 sei 1945. Bei der Pompejianisierung des Zeitstrangs würde das bedeuten, 1984 habe der Zweite Weltkrieg begonnen; 1978 würde Hitler Reichskanzler. Diese Musealisierung historischer Verlaufsformen würde uns die Zeitdynamik nahebringen, in der etwa während der Epoche des Dritten Reiches die Vergegenwärtigung von Vergangenheiten und die Verwandlung der damaligen Gegenwart in eine zukünftige Vergangenheit, also die jetzige Gegenwart unseres Lebens in der Bundesrepublik, verliefen.
Eine Geschichtsschreibung, die uns von der Vergangenheit entlastet, anstatt die Vergangenheit in die Gegenwart aufzunehmen, verkürzt und simplifiziert unsere Zeiterfahrung; aber der Fließstrom der historischen Zeit im Gefälle kalendarischer Markierungen ist der Erfahrung nicht zugänglich; so bliebe Zeit nur ein abstraktes Konstituum von Geschichte. Die Geschichtenschreibung zwischen abgeschlossener Zukunft und nicht vollendeter Vergangenheit muß aber gerade deutlich machen, daß Zeit erst eine Qualität des Wandels des menschlichen Lebens und seiner Formen ist, wenn die Dynamik der Zeit von uns durch den wechselnden Austausch der Zeitformen geleistet wird. Die Erzählungen in diesem Wechsel dynamisieren die Zeit, ja, sie bringen sie erst hervor. Die Pompejianisierung des Blicks musealisiert die Zeit als Zeit der Erzählung; demzufolge ist die wichtigste Aufgabe der Musealisierung, uns Zeit zu schaffen; und zwar als Zeit zum Erleben und Handeln und nicht als Zeit zum Leiden und Verfallen unter der Herrschaft des unerbittlichen Chronos. Museen sind also Zeitproduzenten; Geschichtenschreiber, Musealisierer sind Schöpfer von Zeit.
Wer heute, 1990, das Jahr 1945 als entscheidende Vergegenwärtigung von Vergangenheit in der zukünftigen Gegenwart der Bundesrepublik (71) experimentell zu erfahren vermag, schreibt nicht einfach die Vergangenheit als das ab, woran doch nichts mehr zu ändern ist; sie ist ja zu verändern, indem wir sie in unsere heutige Gegenwart aufnehmen und auch für die Zukunft anerkennen, daß uns die Toten in die abgeschlossene Zukunft hinein schon voraus sind. Wir leben ja noch, aber die Toten haben unsere Zukunft schon erfüllt: sie sind bereits tot. Die Auferstehung der Toten ist heute wohl nur noch als Leistung der Lebenden zu garantieren, die Gegenwart als möglichst vollständige Erinnerung der Vergangenheiten aufzufassen und die Zukunft als Zeit vollständiger Erinnerung zu erwarten, in der nichts Gewesenes mehr verloren geht, also auch wir selber nicht. In diesem Sinne ist Musealisierung in der Lage, uns eine Zukunft zu schaffen.
• (64) Schriftenreihe des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung: Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur, München 1988.
• (65) K. Fohrbeck/A. Wiesand: Von der Industriegesellschaft zur Kulturgesellschaft, München 1989.
• (66) Bazon Brock: Kunst als Kirche – Gegen die Banalität der Macht, in: B. B., Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit, Köln 1986, S. 53 ff.
• (67) ebd.: Die Ruine als Form der Vermittlung von Fragment und Totalität/Die Ruinenkultur, S. 176 ff.
• (68) Günter Metken: Spurensicherung – Kunst als Anthropologie und Selbsterforschung; Fiktive Wissenschaft in der heutigen Kunst, Köln 1977.
• (69) Nikolaus Himmelmann: Utopische Vergangenheit. Archäologie und moderne Kunst, Berlin 1976.
• (70) Bazon Brock: Der pompejianische Blick/Das Leben im Schaufenster/Lebensinszenierung, in: B. B., Ästhetik als Vermittlung, Köln 1977, S. 501 ff.
• (71) s. Anm. 26.