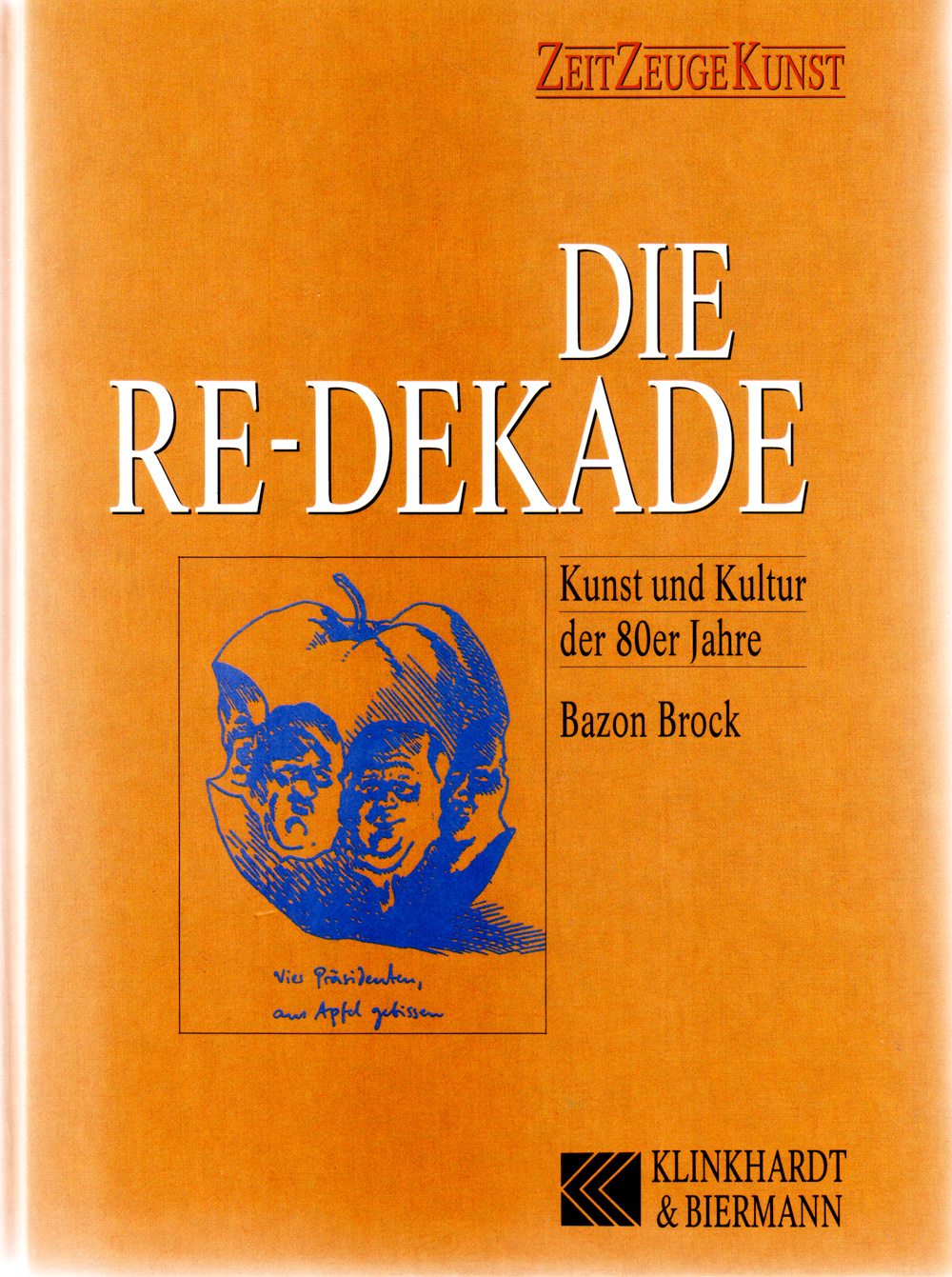a. Atlantis – Müller, Müller, Krier und wer?
Seit Jahren schon besetzt das Atlantis-Projekt von Leon Krier sowie von Helga und Hans-Jürgen Müller viele Gespräche, wenn es darum geht, bedeutende Obsessionen, große Leidenschaften und Herausforderungen für institutionelle oder private Mäzene zu benennen.
Niemand geht einem so auf die Nerven wie jemand, der unabdingbar etwas will; nichts stachelt die Häme und die mokante Besserwisserei kräftiger an als Pläne und Perspektiven, von denen angeblich jeder Vernünftige von vornherein schon weiß, daß sie als schierer Aberwitz ohnehin zum Scheitern verurteilt sind.
Warum aber dann überhaupt die Aufregung, warum haken sich solche Visionen in unserem Gedächtnis fest? Fürchten wir nur, es könnte aus dem schier Unmöglichen doch etwas werden – und wie blamiert stünden wir dann da? Oder entlasten wir uns nicht vielmehr durch zynische Distanzgesten und allzu vernünftige Aufrechnerei des angeblich sinnlosen Unterfangens von der Einsicht, zu welch armseligen Würstchen wir verkümmern, wenn wir uns mit noch so viel Vernünftigkeit verbieten, gerade das Unmögliche zu wollen? In einer Hinsicht entwickelt sich Kultur immer aus der Kraft zur kontrafaktischen Behauptung, deren bekannteste Ausprägung die Utopie darstellt. Das Atlantis-Projekt hat stark utopische Züge; sie machen in gewisser Hinsicht die Herausforderung des Projekts aus, sind aber nicht das Entscheidende. An den Projekten von Christo haben wir lernen können, dieses Entscheidende besser zu verstehen. Es liegt in dem sozialen Prozeß, den die Realisierung des Projekts in Gang setzt. Ja, Christo hat immer wieder betont, daß ihm das Endresultat, zum Beispiel als „running fence“, nicht so wichtig war wie das Beziehungs- und Kooperationsgefüge, das er bei der Verfolgung des Projekts zwischen Menschen unterschiedlichster Interessenlage, Kompetenz, Status und Funktion jeweils über Jahre zu entwickeln vermochte. (24)
Genau das verfolgen Müller und Krier mit Atlantis. Die Verpflichtung von Menschen auf gemeinsame Arbeit an unabweisbaren Problemen soll ja nicht erst in fernen Tagen einer möglichen Realisierung von Atlantis als Architektur angestrebt werden. Die Bindungskraft der Vision Atlantis soll sich jetzt erweisen, indem sie Interesse und Beteiligung so hervorruft, daß sich daraus möglicherweise auch die architektonische Realisierung ergibt.
Als Utopie betrachtet, stellt Atlantis vor allem durch die Entwürfe von Leon Krier eine grundsätzliche Kritik an jenen Architekturkonzepten unserer Gegenwart dar, die von sich behaupten, auf unsere Zukunft ausgerichtet zu sein.
Wie immer man Kriers Architektur beurteilen mag, ihr Grundgedanke ist zumindest so diskussionswürdig wie der der besten Architekten einer wohlwollenden Postmoderne. Kriers Grundgedanke lautet: Zukünfte werden nicht gesichert durch fortschreitendes Übertreffen und Erledigen des historisch Früheren und vermeintlich Veralteten, sondern durch die Entfaltung des Geschichtlichen in der Zukunft als aktuell wirksamer Kraft. Zumindest in dieser Hinsicht erledigen sich die Einsprüche gegen Krier von selbst; denn nur der historisch Blinde kann behaupten, Krier wiederhole die Architektur des Hellenismus. Auch mit bösestem Willen betrachtet, kopiert Krier nicht die archäologischen Rekonstruktionen von Ephesos oder Halikarnassos, weder im Detail der Architekturelemente noch im Gesamtentwurf. Wer sich die Mühe des konkreten Vergleichs macht, und das sollte wohl jeder Kritiker des Projekts, dürfte die Unterschiede schnell herausfinden. Man übersieht diese Unterschiede leicht, weil Krier mit strukturalistischen Argumenten völlig zu Recht behauptet, daß in architektonischer Hinsicht der Bedeutungsraum „Stadt“ für Europa seit der Antike die immer gleiche Herausforderung an Städtebauer darstellt. Wer das nicht sieht, hat den Lebensraum „Stadt“, ohne es zu wissen, aufgegeben zugunsten willkürlicher Ansammlungen bloßer Bauten, die sicher in vielerlei Hinsicht funktionstüchtig sind, zum Beispiel als Lebensfabriken, aber eben nicht mehr als Städte.
Die Zerstörung unserer Städte beklagen gerade die Kritiker von Krier, wie das inzwischen jedermann tut. Wenn da nicht nur Krokodilstränen vergossen werden, sollte man wohl bereit sein, die Behauptungen von Krier über den Zusammenhang von Architektur der Stadt und Architektur des Denkens und Vorstellens sowie der Architektur der Sprache und der verbindlichen sozialen Kommunikation zu diskutieren.
Im übrigen und ohne alle denkbaren Vorbehalte: Bei der Masse architektonischer Zukunftsvisionen, die uns im Auftrag amerikanischer Konzerne oder des französischen Staates zwischen Chicago und Toulouse von Architekten der neuesten Dekonstruktionsideologie als technische Visionen geboten werden, sollte man die Toleranz aufbringen, Krier und Müller ihre vergleichsweise bescheidene Vision verfolgen zu lassen. Bei den Hunderten in aller Welt vom Reißbrett bedenkenlos verwirklichten Tourismuszentren wäre es wohl einen Versuch wert, Atlantis als eine, dem Bauvolumen nach, winzige Alternative zuzulassen.
Es ist billig, Müllers Zielsetzung für Atlantis naiv oder unzeitgemäß, menschheitspathetisch oder interessenkaschierend zu nennen. Diese Kennzeichnungen träfen – „die Wette gilt“ – auf unser aller Vorstellungen zu, wenn wir nur den Mut hätten, unsere Wünsche am Schwanze zu packen. Selbst Habermas' Denkpostulat eines herrschaftsfreien Dialogs hat sich gefallen lassen müssen, als Wissenschaftskitsch bewertet zu werden. Das geht allen kontrafaktischen Behauptungen so, weil wir nicht darin geübt sind, die Bedingungen der Möglichkeit des notwendig anderen Denkens und Handelns zu unterscheiden von den Bedingungen seiner Verwirklichung. Die verwirklichte Utopie ist keine mehr. Aber – und Gott sei Dank – selbst wenn es Müller gelänge, eine neue mönchische Gemeinschaft der Gelehrten, der Künstler und Unternehmer, der Politiker und Gesetzgeber in Atlantis unter dem Sinnbild des geschichtlichen Verschwindens von Kulturen zusammenzubringen: es ist nicht zu befürchten, daß diese Menschen mehr gemeinsam hätten als alle Vorstellungskraft sprengende Probleme, die jede Heilsgewißheit schon im Ansatz unmöglich machen.
Darin trifft die Utopie des Projekts mit der sozialen Dynamik, die es auszulösen hofft, zusammen – darin treffen Kritik durch utopisches Denken und Verbindlichkeit stiftende Gemeinschaft zusammen. Nur wer sich mit anderen auf prinzipiell nicht lösbare Probleme einläßt, vertraut noch auf die Kraft sozialen Verhaltens, welche jene längst verloren haben, die in Begeisterungsgemeinschaften eintreten, um der rettenden Wahrheit teilhaftig zu werden. Gegen den naheliegenden Anschein offeriert uns AtIantis nicht rettende Heilsgewißheit, sondern bietet uns aus der Distanz der Utopie die winzige Chance, uns gegen das absehbare „atlantische“ Verschwinden kontrafaktisch zu behaupten.
• (24) Christo: The Running Fence, Stuttgart 1977.
b. Wiederkehr des Verdrängten – Die Forderung nach Schönheit ist revolutionär
Nicht erst die Nazis, sondern die Künstler selbst haben den Kampf der Schönheit gegen die Entartung geführt – weit früher und in aller Radikalität. Es war der Kampf der absoluten Kunst gegen situationsadäquaten Realismus.
Hat die vorherrschende Diskussion des Jahres 1986 um die Revision der Kunstgeschichte dieses Jahrhunderts uns erneut nur in die seit Jahrzehnten etablierten Konfrontationen zurückgepreßt? Hie vermeintlich einsichtige Trauer über Politperversionen der Kunst, dort scheinbar unbeugsames Beharren auf der Hoffnung, daß das Vergessen historischer Erfahrungen doch noch zur nachträglichen Umwertung des Gewesenen führen wird. Zwischen der Ankündigung der Amerikaner zu Beginn des Jahres, einen Großteil der requirierten Nazikunststückchen zurückgeben zu wollen, und der im Herbst vorgetragenen Propagandaoffensive des Kulturmagnaten Peter Ludwig (25) schien sich die entscheidende Diskussion auf den Disput zwischen dem Historiker Ernst Nolte einerseits und dem Kulturphilosophen Jürgen Habermas (26) andererseits zu verlagern. Zum Inbegriff der Thematik des Jahres 1986 wurde aber die Brekersche Zwillingsbüste des Ehepaars Ludwig.
So heftig und, dankenswerterweise, auch unverblümt die Auseinandersetzungen geführt wurden, neue Einsichten brachten sie kaum. So mancher Repräsentant der bundesdeutschen Wirtschaft und Gesellschaft ließ sich von Nazikünstlern nach 1945 porträtieren, der Sozialphilosoph Max Horkheimer inbegriffen, den man 1963 nicht davon abhalten konnte, seine Büste als Ehrenbürger der Stadt Frankfurt ausgerechnet vom „Angriff“-Künstler Knud Knudsen modellieren zu lassen. Auch das Argument Ludwigs, man dürfe die Nazikünstler nicht aus öffentlichen Museen „verbannen“, weil man sich sonst jener Diskriminierung schuldig mache, die von den Nazis gegen ihnen unliebsame Künstler durchgesetzt wurde, war in der Nachkriegszeit nur allzu beliebt. Gerade die Fadenscheinigkeit dieses Arguments zwingt ja die an der Diskussion beteiligten Ludwigs aus Kunst, Wirtschaft, Militärwesen und Politik zu ihren Aberwitzigkeiten. Nichts Neues also? Doch! Im Münchner Kunstverein realisierte Gerhard Merz seine neue Arbeit „Dove sta memoria“, und mit diesem Werk werden Positionen bezogen, aus denen man unsere Kunst- und Politikgeschichte mit tatsächlich anderen Argumenten zu werten vermag.
Zdenek Felix, der neue Leiter des Kunstvereins, hatte 1986 die Ausstellungsräume am Hofgarten in ihre ursprüngliche Gestalt zurückbauen lassen, Gerhard Merz formuliert nun die dreiteilige Saalflucht durch hochmeisterliche Pigmentierung der Wände in den Farben Türkis und Caput mortum als erstrangiges Zeugnis jenes Klassizismus, den wir bis heute nicht verstanden haben; ebenso wenig wie ihn Arno Breker oder Albert Speer oder gar Adolf Hitler je begriffen, Und diese Unfähigkeit hatte und hat Folgen. Für die Nazizeit produzierte die klassizistische Attitüde jenes unsägliche Gemisch aus Kitsch, Kraft und Propaganda für den Tod; heute demonstriert die Postmoderne mit ihren klassizistischen Lehrbuchanleihen, wie sehr wir immer noch im Verständnis des Klassizismus überfordert werden. Merz plaziert in seinen Tempel der historischen Erinnerung kühl kalkulierend sieben bildnerische Einheiten:
o eine Weihestele staatlicher Machtentfaltung mit olympischer Feuerschale, Requisit aller Todesfeiern im Dritten Reich;
o einen übermalten Siebdruck jener „entarteten“ Skulptur von Otto Freundlich, die 1937 als Umschlagfoto des Katalogs zur Ausstellung „Entartete Kunst“ herhalten musste (27);
o einen übermalten Siebdruck eines um 1500 entstandenen überlebensgroßen Heiligen Sebastian von Giovanni Battista Cima;
o einen übermalten Siebdruck eines Fotos von Gebeinen in römischen Katakomben;
o eine massiv gerahmte, monochrom ocker pigmentierte Leinwand in den Anmutungsproportionen eines antiken Sarkophags;
o sechs hochformatige, ebenso massiv gerahmte, monochrom türkis pigmentierte Leinwände in den Anmutungsproportionen antiker Tafeln, in die Imperatoren die Geschichte ihrer Heldentaten einschrieben;
o eine Inschrift in antiken Versalien: „Dove sta memoria“ (wo noch ist Erinnerung?). Sie stammt aus einem der „Pisaner Gesänge“ des amerikanischen Lyrikers Ezra Pound. (28)
Pound saß, als er sie schrieb, in einem Gefangenenkäfig auf dem Flugplatz von Pisa. Die Be- und Verurteilung seiner Haltung während des Faschismus in Italien durch ein amerikanisches Gericht führte zu seiner Einweisung in eine Irrenanstalt. Man gewährte ihm die Freiheit eines Künstlers um den Preis, ein Narr zu sein wie jene Künstler, denen auch Adolf Hitler 1937 mitfühlend offerierte, sich doch lieber als bedauernswerte Geisteskranke denn als anmaßende Nichtskönner qualifizieren zu lassen.
Merz stellt sich und den Betrachter seines Werkes in den Käfig der Erinnerungslosigkeit und des erzwungenen Vergessens. Die klassizistische Fassade signalisiert die Ausblendung von Geschichte durch die Schönheit des Absoluten. Das eben ist unser Mißverständnis des Klassizismus. So gut wie die Brekers und Speers glaubten wir, der Geschichte durch die Fiktion des Absoluten, Wahren und Schönen entkommen zu können: Aus den finsteren Katakombenöffnungen wurde ein schönes schwarzes Quadrat; so verkannten wir Malewitsch. Aus der penetranten Hinfälligkeit des Menschen wurde die Leugnung seiner konkreten historischen Existenz; aus den Epen der menschlichen Machtgier machten wir leere Tafeln und drückten uns so vor dem Anspruch absoluter Malerei. Ein Mißverständnis, wie gesagt.
Der Raum im Münchner Kunstverein ist überwältigend – wieso? Weil hier ein erstrangiger Künstler unsere Geschichte rekonstruiert, wie es sie 1933 und in den folgenden Jahren leider nicht gegeben hat. Zumindest in den bildenden Künsten gab es sie nicht. Die besten Künstler waren vertrieben, hatten Berufsverbot oder gingen im KZ zugrunde wie Otto Freundlich. Aber hätte es viel bedeutet, wenn es auch in der bildenden Kunst und in der Architektur Kaliber wie Gustaf Gründgens im Theaterbereich, Wilhelm Furtwängler in der Musik oder Gottfried Benn in der Literatur gegeben hätte? Das eben will Merz herausfinden, indem er uns den Zugang zu künstlerischen Konzepten eröffnet, die mit ihrer scheinbaren Vereinnahmung durch die Nazis bis heute der Diskussion entzogen sind.
Die Dispute um den historischen Stellenwert der nationalsozialistischen Ära, in die wir, nicht nur im Jahr der 50. Wiederkehr der Kampagne „Entartete Kunst“, weiter verstrickt waren, umgehen die zwingende Einsicht, daß nicht erst die Nazis, sondern weit früher die Künstler selbst in aller Radikalität den Kampf der Schönheit gegen die Entartung, den Kampf der absoluten Kunst gegen situationsadäquaten Realismus geführt haben. Was an den Nazis dran war, kommt uns erst zu Bewußtsein, wenn wir erkennen, daß sie überhaupt keine eigenständige Position bezogen haben; sie erhoben nur deutsche Kunstdogmatiken in den Rang gesellschaftspolitischer Handlungsanleitungen.
Unsere Dispute werden sich erst lohnen, wenn wir zu erkennen vermögen, daß die von den Nazis wortwörtlich genommene deutsche Kunstdogmatik von den „geächteten“ Künstlern der Moderne wie Wassily Kandinsky und Franz Marc, Emil Nolde und Ludwig Mies van der Rohe, Arnold Schönberg und Rudolf Steiner getragen wurde.
Gerhard Merz rekonstruiert die tragische Dimension dieser Tatsache, wobei ihn weniger interessiert, warum viele dieser Dogmatiker der absoluten Kunst es kaum fassen konnten, daß ausgerechnet sie von den Nazis abgewiesen wurden, zumal ihre italienischen Kollegen dem dortigen Faschismus uneingeschränkt willkommen waren. Merz setzt historisch tiefer an, im kaiserlichen Rom der Christenverfolgung, auf das Cima mit seinem Gemälde des Heiligen Sebastian so ausdrücklich hinweist.
Und da sind wir beim Kern des Problems. Schon der Maler und Künstlerbiograf Giorgio Vasari (29) merkt Mitte des 16. Jahrhunderts an, daß der so betörend schöne und als Akt gemalte Jüngling Sebastian die Kirchenbesucher in sehr ambivalente Gefühle versetzt haben dürfte. Einerseits sollte ihnen das Gemälde im sakralen Kontext das Leiden des Märtyrers in der Nachfolge Christi nahebringen; andererseits verführte sie die malerische und ästhetische Qualität des Bildes dazu, das Leiden des Märtyrers zu verdrängen und seine Darstellung zu genießen. Das schreckliche, das todbringende Leiden, das kreatürliche Elend wurde in der künstlerischen Bewältigung zu etwas Schönem, Großartigem.
Die Ambivalenz von Schönheit und Schrecken, von Zerstörung und Schöpfung, das ist das „Sublime“, eine bestimmende Kategorie im Programm des Klassizismus von seinen Ursprüngen her; er wollte gerade verbindliche und nicht leere Abstraktionen als zeitenüberdauernde Schönheit gegen die jeweils konkreten historischen Befindlichkeiten der Menschen setzen. Folgerichtig waren auch die Verfechter der absoluten Kunst mehr oder weniger radikale Sozialutopisten. Die Kampagne gegen die gegenstandslose, abstrakte oder absolute Kunst hatte zum Ziel, diesen sozialrevolutionären Impact des Klassizismus zu zerstören. Gerade der mit den Mitteln der abstrakten Kunst in unserem Jahrhundert formulierte klassizistische Anspruch, daß die Forderung nach Schönheit ein sozialrevolutionäres Programm repräsentiere, setzte diese Kunst wütender Verfolgung aus.
Zu dieser Einsicht führt die Erinnerung also den Künstler Gerhard Merz – und die Konsequenzen für die aktuelle Debatte? Gebt es auf, den Zugriff der Nazis auf einen falsch verstandenen Klassizismus weiterhin als Vorwand dafür zu benutzen, das Verlangen nach Schönheit und Dauer als reaktionäre Ausblendung sozialer Probleme, ja der Historie schlechthin zu stigmatisieren! Verbindlichkeit ist gefordert, und die Schönheit ist die einzige Verbindlichkeit der bildenden Kunst, so sagt Merz, in der die Pflichten des Tages und die Konfrontation mit den Konkretheiten der menschlichen Existenz bewältigt werden können.
Bemerkenswert: nicht ein deutsches Museum, sondern das Kunstmuseum Grenoble bot Gerhard Merz 1988 die Gelegenheit, in der bisher größten räumlichen Ausdehnung sein jüngstes programmatisches Werk zu zeigen. Wieso ausgerechnet Grenoble?
Nur wenigen Eingeweihten war nicht entgangen, daß die Franzosen eine besondere Affinität zum Werk von Gerhard Merz entwickelt haben. Das Museum in Straßburg kaufte 1987 den bis dahin größten Werkkomplex „Dove sta memoria“, den 1987 auch das Museum für moderne Kunst in Paris in einer der Münchener Uraufführung gegenüber leicht veränderten Fassung zeigte. Das Konsortium Dijon präsentierte 1987 in auffallender Weise „Inferno“ von Merz; für die neue Ausstellung, den bisherigen Höhepunkt der Präsentation von Gerhard Merz, ging Grenoble mit Dijon und Straßburg eine regelrechte Merz-Kooperative ein, der es auch gelang, eine aufwendige, formschöne und den Beiträgen nach substantielle Publikation unter dem Titel „Gerhard Merz MLXXXVIII“ zu veröffentlichen. (30)
Auf den ersten Blick scheinen die Franzosen Gerhard Merz deswegen so außerordentlich zu schätzen, weil sie die verständlichen deutschen Empfindlichkeiten gegen dessen angeblichen Neoklassizismus und Monumentalismus nicht beschweren. Das heißt zugleich, daß sie Merz weniger unproduktive Mißverständnisse entgegenbringen. Auf den zweiten Blick lassen sich bessere Gründe für das französische Interesse an Merz entdecken. Die Situation der bildenden Künste ist in Frankreich noch viel miserabler als bei uns. Die Ausrichtung der Künstler auf den amerikanischen Bilderdekor, auf die deutschen expressiven Ausdrucksgesten und die immer noch beschworene peinture-delicatesse der ehemals vorherrschenden französischen Malereikultur haben zu einer heillosen Desorientierung geführt, die Künstler und Publikum ermatten ließ. Wo die Not völliger Beliebigkeit am größten ist, scheint demnach also nun das Interesse an vielversprechenden neuen Ansätzen besonders stark zu sein. Daß Gerhard Merz unnachgiebig und konsequent Aufgaben und Möglichkeiten der bildenden Künste neu zu bestimmen unternimmt, ist kaum zu bezweifeln.
Bisher hatte sich Merz für seine Neuorientierungen in erster Linie auf die historischen Positionen der Futuristen und Konstruktivisten wie auf die jüngeren Klassiker der Avantgarde – A. Reinhardt, B. Newman oder D. Judd – eingelassen. Die Franzosen entdeckten nun über die Grenobler Arbeit von Merz unmittelbare Bezüge zu ihrer eigenen Tradition. Zum einen hatte Paul Valéry 1928 eine Text- und Gedankenarchitektur unter dem Titel „Eupalinos“ veröffentlicht, eine Art sokratischen Dialog über die Architektur als erste der Künste. Vier blockhafte Auszüge aus diesem Werk integriert Merz als Textarchitekturen in seinen Grenobler „Eupalinos“. Zum anderen führte der programmatische Titel eines anderen Werkkomplexes von Merz „ed io anche son architetto“ (in München, Düsseldorf, Genf 1988 gezeigt) die Franzosen auf die Spur ihres bedeutenden Revolutionsklassizisten Boullée, dessen ebenso programmatischer Anspruch „ed io son pittore“ das Verhältnis von Malerei und Architektur zu einer einheitlichen Formlogik zu verknüpfen versuchte, wie das eben auch Gerhard Merz unternahm. Zum dritten wurde den Franzosen durch Gerhard Merz bewußt, daß der französische Kunsthistoriker Focillon mit seinem lange vergessenen Werk „Das Leben der Formen“ einen theoretischen Ansatz entwickelt hatte, den es jetzt fruchtbar zu machen gilt. (31)
Unter diesen Voraussetzungen und Wirkungsansprüchen installierte Merz in der dreigliedrigen zentralen Raumflucht des neoklassizistischen Grenobler Museums seinen „Eupalinos“. Im ersten und dritten jeweils achteckigen Raummonument hängen je vier große, hochformatige, neapelgelb pigmentierte, monochrome Leinwände diagonal zur Raumflucht in dunklen, massiven, zweikehligen Holzrahmen; zwischen diesen beiden Raummonumenten der zentrale, rechteckige und längs ausgerichtete Saal.
Auf den mit Wandflächen gefüllten vier Winkeln des rechteckigen Raumes hängen vier T-förmige Reißschienen in Messing, das Hauptarbeitsgerät der Architekten. Auf den Längswänden paarig einander gegenüber vier gewaltige querformatige, elfenbeinschwarz pigmentierte Bildflächen, ebenso gerahmt wie die Hochformate im ersten und dritten Raummonument. Unter den Bildtafeln, wie schon angedeutet, die Textarchitekturen aus Valérys „Eupalinos“ in Antiquaversalien. Zwischen Bildtafeln und Textblöcken verläuft eine die Wände strukturierende metallene Hängeleiste, wie sie in klassischen Museumsbauten typisch war. Die beeindruckend proportionierten Wände des gesamten Ausstellungskomplexes, in dem sonst die Prunkstücke des Museums präsentiert werden, haben „von Hause aus“ einen ochsenblutroten monochromen Farbauftrag, der die architektonische Raumformulierung unterstützt: eine Merz entgegenkommende Wechselbeziehung zwischen Farbwertigkeit und Raumwertigkeit. Die Räume werden zum Teil vom Tageslicht (Glaskuppel), zum Teil von delikat gesetztem Kunstlicht erfüllt und akzentuiert.
Die Anmutungen der gesamten Ausstellungseinheit führen und verführen den Betrachter zu Erinnerungen. Vor den neapelgelben Hochformaten fühlt man sich etwa an Situationen erinnert, in denen man vor Tizians „Himmelfahrt Marias“ in der Frari-Kirche zu Venedig stand. Vor den elfenbeinschwarzen Querformaten erinnert man sich an Tintoretto in Venedigs Scuola San Rocco. Merz wird solche natürlich subjektiven Impulse zwar zulassen, das für ihn Entscheidende aber, und darauf beharrt er, besteht darin, daß diese Bildwertigkeiten allein durch formale und konzeptuelle Konstruktionen zustandekommen. Sie sind nach seiner Auffassung nicht ikonographisch, nicht ideologisch vorgegeben. Ihre unwiderstehliche Wirkung, so behauptet Merz programmatisch, entsteht durch die Einheit von Architektur und Bildwerten. Die Architektur ist nicht länger zum bloßen Bildträger entwertet, das Bild wie auch die Skulptur sind nicht länger durch die Ausgrenzung der Architektur als Nichtbild in ihrer Eigenständigkeit definiert. Dem Bild, der Skulptur, dem Text wird ihre Architektonik zurückgegeben und die Architektur als Bild erschließbar. Das Konzept, das beide gleichermaßen trägt, ist ein Ordnungsgefüge aus Maßen und Zahlen, und was wir daran als sublim, erhebend, feierlich empfinden, ist die überindividuelle und übergeschichtliche Geltung dieser formalen Ordnung, dieser Geometrie der Formideen, dieser Architektur der Gedanken und Vorstellungen.
Merz zufolge ist es völlig abwegig, diese Wirkung mit ideologischen Weltanschauungen zu verknüpfen, obwohl auch Merz nicht leugnet, daß dergleichen immer wieder versucht worden ist (z. B. in der Herrschafts- und Sakralarchitektur). Merz verweist zitierend häufig u. a. auf Gottfried Benn, der in seinem Werk nach den Erfahrungen von 1933 – 1936 versucht, die „Formvollendung“ vor ihrer ideologischen Inbesitznahme zu retten. Deutschen zumal fällt das bis heute schwer, weswegen sie sich mit Merz schwertun. Umso wichtiger ist es, sich auf die für alle Künste, ja die gesamte Kultur, tatsächlich entscheidende, von Merz gestellte Frage einzulassen, ob nicht jedwede stichhaltige Begründung von Wahrheitsansprüchen darin zu liegen hat, die überindividuelle Geltung von Formideen glaubhaft, evident werden zu lassen. Merz behauptet nicht, dergleichen Überlegungen als Neuheiten in die Welt zu setzen, ganz im Gegenteil. Er besteht darauf, daß diese seit der Antike entwickelten Argumente von den Gegenwartskünstlern zumindest hypothetisch aufgenommen werden müssen, um aus dem postmodernen Simulationsgequatsche, das nur noch zur Rechtfertigung von Beliebigkeit als bedingungsloser Willkür herhalten muß, je wieder herauszukommen. Daß Merz da herausgekommen ist, zeigten schon etliche seiner Arbeiten; daß aber Merz beispielhaft zu werden beginnt, zeigt uns vor allem der „Eupalinos“ in Grenoble. Ausgerechnet französische Museen geben dazu Gelegenheit. Der Chefkonservator von Grenoble und Sorbonne-Kunsthistoriker Prof. Serge Lemoine, hoffentlich auch weiterhin eine treibende Kraft in der Revitalisierung der lange Zeit vom Pariser Zentralismus geduckten Kulturprovinzen Frankreichs, sagte zur Eröffnung: „Wir können das zukünftige Europa nicht der technischen Normierung und nicht den Gleichmachern des ökonomischen Wettbewerbs überlassen. Europa ist ein kulturelles Kraftfeld der Zukunft, wenn es auf seiner Ideengeschichte besteht. Gerhard Merz ruft uns einen wesentlichen Aspekt unserer Ideengeschichte ins Bewußtsein: den Willen zur Form.“
• (25) Rainer Speck: Peter Ludwig, Sammler, Ffm 1986.
• (26) Eike Hennig: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Faschismus, Ffm 1988.
• (27) Führer durch die Ausstellung „Entartete Kunst“, für den Inhalt verantwortlich Fritz Kaiser, München 1937.
• (28) Ezra Pound: Cantos I – XXX, dt. von Eva Hesse, Zürich 1964.
• (29) Giorgio Vasari: Leben der ausgezeichneten Maler, Bildhauer und Architekten von Cimabue bis zum Jahre 1567, dt. von Ludwig Schorn, Wien 1983ff.
• (30) Dt. Ausg. Schellmann und Klüser, München 1990.
• (31) Henri Focillon: La Vie des Formes, Paris 1963.
• (32) Materialien zur Verleihung des Passepartout-Preises für Kunstvermittlung an das Konsortium Dijon, PAN 6/90.
c. Besetzung der Vergangenheit – Zu einem Frühwerk Anselm Kiefers
Im Jahr 1989 gelang es dem Berliner Galeristen Rudolf Springer, ein zentrales Frühwerk Anselm Kiefers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Kiefer, der neben Beuys international als bedeutendster deutscher Künstler der Nachkriegszeit gilt, hatte das Werk 1970 in Nîmes gemalt. Ein lokaler Künstler, in dessen Atelier das Gemälde bis 1989 verblieb, fotografierte Kiefer bei der Arbeit an dem Bild (ein einmaliges Dokument, da Kiefer sehr früh, 1973, entschied, sich nicht mehr fotografieren zu lassen – erst 1989 stellte sich Kiefer wieder der Kamera des Bonner Kunstjournalisten Walter Smerling für einen einstündigen Fernsehfilm).
Das wiederentdeckte Werk zeigt eine überlebensgroße männliche Figur in leichter frontaler Untersicht; der Dargestellte trägt einen langen grünen Überrock und ein schwarzes Halstuch – Kleidungsstücke, wie sie in Deutschland zur Zeit des Freiheitskrieges gegen die Napoleonische Besetzung Preußens üblich waren –, außerdem schwarze Schaftstiefel. Er steht, so könnte man meinen, in einer knapp angedeuteten Innenraumarchitektur; die Standfläche läßt sich als Parkettmuster verstehen; doch bleibt die Kennzeichnung des Standortes so unbestimmt, daß er auch als undefinierter Außenraum verstanden werden könnte. Die männliche Figur hat eindeutig Porträtzüge Kiefers; wir können das Gemälde also als ein Selbstporträt im historischen Kostüm bezeichnen.
Nicht nur das Kostüm, auch die Haltung des Dargestellten mit leicht über Schulterhöhe erhobenem, ausgestrecktem rechtem Arm ist historisch. Diese Geste changiert zwischen dem historischen römischen und deutschen Gruß einerseits sowie dem Aufmerksamkeit anmahnenden Rhetorikergestus und dem Segnungsgestus andererseits. Der Gestus bleibt ambivalent, da offene BeinsteIlung und zivile Haltung der Figur mit allzu martialischer Eindeutigkeit nicht vereinbar sind. Dieser Typus des Selbstporträts im grünen Überrock ist in einigen Werken Kiefers von 1970 zu entdecken, so in der Serie „Heroisches Sinnbild – 1-111“ und in dem Aquarell „Jeder Mensch steht unter seiner Himmelskugel“. Doch ist er in keinem der anderen Werke so ausschließlich zum Thema erhoben worden.
Die Entwicklung des Typus im Werke Kiefers ist eindeutig zu verfolgen. Sie stammt einerseits aus der Reihe der „Besetzungen“ von 1969 und andererseits aus Kiefers Hinweis auf Caspar David Friedrichs Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ (um 1818). Die „Besetzungen“ bestehen aus einer Reihe von Fotografien, die Kiefer mit römisch/deutschem Gruß in der Schweiz (!), in Frankreich und Italien zeigt vor Standbildern, Meeresküsten, vor dem Vesuv, vor und in dem römischen Kolosseum etc., also an geschichtsbesetzten Orten, die teilweise von Hitlers Armee erobert worden waren. Mit der Einübung in den Ritualgestus der antiken und modernen Imperatoren und der modernen Diktatoren Mussolini und Hitler stellte Kiefer für sich ein Stück deutscher Geschichte nach.
Die „Besetzungen“ wurden zum ersten Mal in der Zeitschrift „Interfunktion“ Nr. 12, Köln, 1975, veröffentlicht. Durch zwei hinzugefügte Bildverweise gibt Kiefer dort den Interpretationsrahmen der Arbeit. Ein Foto zeigt ihn im Gegenlicht im Inneren des Künstlerateliers frontal zur Kamera. Der „Sieg Heil“-Grüßende steht in einer mit Wasser gefüllten Badewanne, so, als ob er über Wasser gehen könne; ebenfalls ein Heilstopos, der die Heilsgeste ironisch kontert, weil man deutlich sieht, daß Kiefer auf einem Sockel in der Badewanne steht (Hinweis auf den zeitgenössischen Witz: Hitler habe versuchen müssen, durch reine Willenskraft über Wasser gehen zu können, weil er Nichtschwimmer war). Der zweite Hinweis ist die Schwarzweiß-Reproduktion von C. D. Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“. Das letzte Foto der Besetzungsreihe zeigt Kiefer, ebenfalls in Rückansicht wie den „Wanderer über dem Nebelmeer“, an der meeresschaumumspülten Felsenküste von Sète/Frankreich. Ganz offensichtlich ist dieses Foto in Analogie zu dem Gemälde C. D. Friedrichs inszeniert worden. Die Analogien zwischen „Wanderer über dem Nebelmeer“ und Kiefer vor dem Mittelmeer sind auffällig, ebenso die Unterschiede. Friedrichs „Wanderer“ in offener BeinsteIlung des Kontrapostes, den rechten Arm auf einen Wanderstab leicht aufgestützt, trägt jenen grünen zivilen Rock des Bürgers der Goethezeit, in den Kiefer im Selbstporträt gehüllt ist. Wissenschaftler deuten das Gemälde Friedrichs (anhand von Quellen) als Erinnerungsbild für einen im Freiheitskrieg Gefallenen, gleichsam im Rückblick des erinnerten Toten auf die Welt, in der er lebt. Die zivile Kleidung und Haltung verstärken den Eindruck einer bürgerlichen Kontemplation über die Summe des Lebens angesichts einer ewig gleichförmigen Natur. Ganz anders Kiefer, der den rhetorischen Gestus eines Demosthenes und den Imperatorengestus eines Xerxes vor den Gewalten der Natur so ausübt, als ginge es darum, der Natur den menschlichen Willen aufzuzwingen. In unserem Porträt kommen diese beiden Ereignis- und Bedeutungsstränge der Geschichte zusammen. Die Rückenfigur des „Wanderers über dem Nebelmeer“ und der die Geschichte besetzende Kiefer haben sich endlich umgedreht: Man kann ihnen ins Gesicht sehen. (33)
Das wiederentdeckte Frühwerk Kiefers ist ein Zentralwerk, Kiefer thematisiert die für das spätere Werk bedeutsamsten Problemkonstellationen in diesem Gemälde meisterhaft. Es ist neben seinen rein künstlerischen Qualitäten, die den höchsten Ansprüchen der Malerei des Jahrhunderts gewachsen sind, ein Werk außerdem, das die „deutsche Kunstdogmatik“ und die deutsche Geistesgeschichte der vergangenen 200 Jahre repräsentiert. Es ist in der Lage, den inneren und historischen Zusammenhang der Geschichte zu repräsentieren wie kaum ein zweites Werk deutscher Künstler, deren heroische Arbeiten darauf gerichtet waren, seelische Energie und geistige Kraft des bürgerlichen Subjekts als bestimmende Größe historischer Entwicklungen auszuweisen; ein Versuch, den die Angehörigen anderer Nationen wohlweislich nicht zu unternehmen wagten, weil sie nicht bereit waren, die Größe menschlicher Absichten an deren Scheitern zu messen. Deutsche Künstler haben das gewagt und damit das Risiko auf sich genommen, für das Scheitern ihrer Intention zur Verantwortung gezogen zu werden, ja wohlfeilen Einwänden selbstsicherer Rationalität ausgeliefert und lächerlich gemacht zu werden. Indem Kiefer seinem Selbstporträt als Pathosformel der deutschen Geschichte diese Dimension ironisch-zynischer Distanzierung selber mitgibt, erhöht er die Bedeutung seiner Behauptung. Wir können die Geschichte nur verstehen, wenn sie als Ausdruck unseres Willens und unserer Vorstellungen begriffen wird. Aber alles, was wir wollen können, als Künstler, Intellektuelle, als Unternehmer und Führer, als Denker und Weltgestalter, muß gerade deshalb zum fürchterlichen Scheitern verurteilt sein, weil wir Natur und Geschichte dem radikalsten Anspruch des Menschen unterwerfen wollen, nämlich Dauer zu erzwingen, im Dasein ein Bleibendes zu stiften und es als Heimat ein für allemal in Besitz zu nehmen. Das Selbstporträt Kiefers in historischem Kostüm und historischer Haltung des deutschen Bürgertums drückt die Tragik dieses Vorgangs aus. Je Größeres wir wollen, desto schuldiger werden wir, je zwingender unser Wille, desto unabweislicher das Eingeständnis unseres Versagens.
• (33) Bazon Brock: Dreh Dich endlich um, Kerl – Ein Versuch, Friedrichs Rückenfigur ins Gesicht zu sehen. FR 5.10.74, in: Bazon Brock: Ästhetik als Vermittlung, Köln 1977.