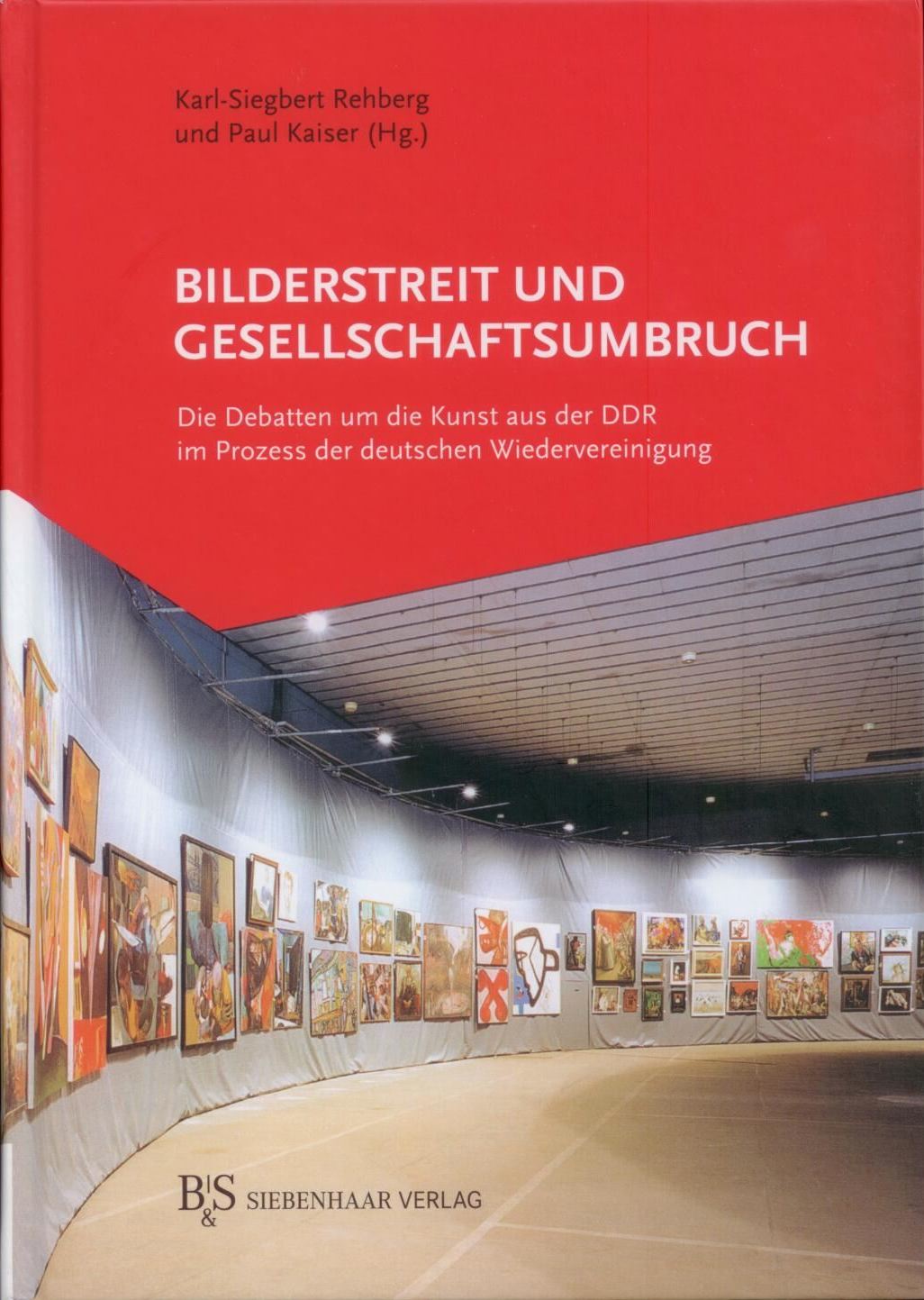Und die DDR hat doch gesiegt! In dieser Ausstellung ( „Offiziell/Inoffiziell – Die Kunst der DDR", Weimar, 1999) wird deutlich, dass das von der Öffentlichkeit getragene Kunstverständnis im Westen gegen allen Anschein auch in den Jahren 1950 bis 1990 nicht das der universalisierten West-Kunst gewesen ist, sondern immer noch das der Kultur-Kunst, wie sie in der DDR manifestiert war. Und die Empörung gegenüber Weimar zeigt, dass der Kampf um die Moderne keineswegs ausgefochten ist.
Bazon Brock, 1999 (1)
Es ist sehr bezeichnend, dass Karl-Siegbert Rehberg im Titel der Ausstellung „Abschied von Ikarus. Bildwelten in der DDR – neu gesehen“ den zentralen Begriff der BRD-Kunstprogrammatik, nämlich „Bildwelten“, verwendet. Soweit ich weiß, habe ich diesen Begriff zum ersten Mal für das Programm der documenta 5 1972 geprägt. Es ging dabei gerade um diese Differenz vom DDR-Weltbild zur BRD-Bildwelt. Dem entsprach die Differenz zwischen „Kunst als Kultur“ und „Kunst als transkultureller zivilisatorischer Praxis“. Innerhalb der leninistisch-stalinistisch bestimmten Auseinandersetzung im Ostblock war das durch den Kampf um die Konzepte der Internationale begründet, die Stalin ja auch des Formalismus, der Abstraktionsleere und der universalistischen Bekenntnisfreiheit verdächtigte.
Heute steht für „universell“ der Kapitalismus und für „regional“ der Kulturalismus. Die Tragik, wie schon im Konflikt um die eins, zwei, drei, vier Internationalen, besteht darin, dass der objektive Geist nur noch als Geld erscheinen kann und die Produktivität der regionalen kulturellen Differenzierungen nur als Systeme der erpressten Loyalitätsbekenntnisse wirksam werden können.
Bei der Neubewertung der DDR-Kunst käme es also darauf an, zwischen kulturalistischen und zivilisatorischen Ansätzen zu unterscheiden und die beiden in Hinblick auf Stil, Maniera, Material einander komplementär zu kennzeichnen. Im Politischen und Sozialen ist die Neubewertung eindeutig: Der vom Westen emphatisch beschriebene „Wandel durch Annäherung“ erfüllte sich gegen die Intentionen der Urheber Brandt und Genossen in der weitestgehenden Verwandlung der Bundesrepublik in eine generalisierte DDR. Im künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Kontext setzt sich diese Umwandlung der BRD in eine (Groß-)Deutsche Demokratische Republik dadurch fort, dass mehr und mehr Künstler nach dem Beispiel von Anselm Kiefer ihre Erfolgsaussichten dadurch zu erhöhen hoffen, dass sie in den Schoß der Kulturen zurückflüchten und zu fundamentalistisch agierenden Propagandisten der kulturellen Suprematie werden.
So ist das Urteil „Und die DDR hat doch gesiegt“ (aus meinem oben zitierten Text von 1999) wohl begründbar:
Erstens: Absoluter Anspruch der Parteien aus Vorherrschaft im Staat, legitimiert durch parlamentarische Mehrheitsentscheidungen, wobei die Minderheiten auch nichts anderes wollen als die Macht der Parteien zu stärken. Zweitens: Heutige Letztbegründung aller Autorität aus der Macht des Marktes; in der DDR Beschwörung des Weltgeistes als durch materielle Produktion erzwingbare Überlegenheit. Drittens: Forderung nach akademischer Bildung der Jugend, mit dem Resultat, nach Ende des Studiums arbeitslos zu sein – einstmals in der DDR Vergeudung des akademischen Potentials in der Wirkungslosigkeit. Die Argumentationstypiken von Ulbricht, Honecker und Co. wiederholen sich bis in kleinste Feinheiten in den Phraseologien von Kohl, Merkel und Co. Etwa Ulbrichts Satz, „niemand habe die Absicht eine Mauer zu errichten“ (sei aber gegen den eigenen Willen objektiv dazu gezwungen), entspricht Merkels, „niemand habe die Absicht, die Ersparnisse der Deutschen für die Rettung von internationalen Finanzspekulanten aufs Spiel zu setzen“ (sei aber durch die Mehrheitsbeschlüsse der EU-Regierungschefs gegen den deutschen Willen dazu gezwungen worden).
Das Resultat ist eindeutig: Mehr und mehr Deutsche wissen gar nicht mehr, worin einstmals die Entgegensetzung von Ost und West bestanden hat. Wer die heutige Situation zu akzeptieren gezwungen ist, zeigt mehr und mehr Verständnis für die Sachlage in der DDR, ja sogar für die Sachlage in Deutschland zwischen 1918 und 1933 mit den sattsam diskutierten Konsequenzen, die sich heute genauso wieder eröffnen.
(1) Matthias Flügge, Michael Freitag: Beten verboten! oder „Abschied von der Kunst“ in Weimar. Ein Gespräch mit Bazon Brock. In: neue bildende kunst 9 (1999), H. 5, S. 54-58, S. 55.