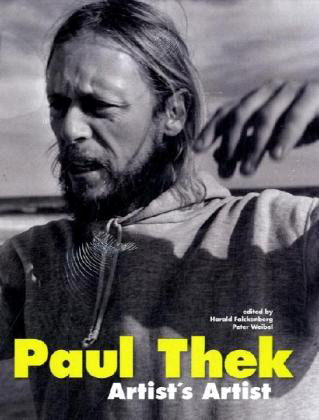Werkdetail Seite / Volltext
Seite 56-69 im Original
The Progress of Work as Process aims at Regress
Wie der Sarg, der Schuppen, die Designerstuhlreihen, die Pilotfische und andere Schönheiten auf Kunstwerke von Paul Thek verweisen, die es nie gab.
Muss ich nun auch noch meinen Senf dazu geben? Haben nicht gerade Roberto Ohrt, Axel Heil und Margrit Brehm ihre unterscheidungsreiche und nachvollziehbare (clare et distincte) Darstellung des Wollens und Werkens von Paul Thek zur Eröffnung der Ausstellung „Paul Thek - In The Context of Today`s Contemporary Art“ in Karlsruhe geboten. Verdient diese grandiose Darstellung nicht alle Anerkennung, indem man sie einfach so, wie sie ist, für eine Weile gelten lässt? Doch, doch, das soll alles gelten. Mit meinen Anmerkungen folge ich nur einer Exerzitienmaxime des „Saint Saul“: „freedom is first of all freedom from identification“. Diese Thek’sche Feststellung von 1973 sollte nicht, wie die zitierten Autoren meinen, vornehmlich so verstanden werden, als habe Thek derartige Freiheit „vor der Identifikation mit der Rolle des Autors (des Originalgenies, des Meisterkünstlers) geschützt“ (S.66), vielmehr gilt sie einem allgemeinen Bekenntnisekel. Das ist natürlich ein subtiler Verweis auf die historische Wandlung des hellenistisch-jüdischen Sektenbeauftragten Saulus zum Apostel Paulus des Sektengründers Jesus. Die Wandlung betraf einen mit allerlei Ausstellungs- und Inszenierungstechnik vonstatten gegangenen Wechsel des Bekenntnisses in Kulissen (Wüstensandboden, Schlangen und anderes Getier, Sträucherzweige, Verdüsterung und blendendes Licht mit Stimmungsqualitäten, wie sie Opernregisseure austüfteln), die bis vor kurzem noch von alternativen Künstlerkommunen auf Südlichen Inseln beschworen wurden. Und damit stecken wir schon mitten im Zähfluss der Argumente, um nicht zu sagen in der Asphaltfalle, wie sie Thek als Fangvorrichtung für den Beuys’schen Hasen so wappenhaft, emblematisch schuf.
Für unsere Generationskohorte der Nachkriegs-Euroamerikaner galt es gerade, die Bekenntnisfesseln der westöstlichen Ideologien loszuwerden, also sich vom Kultur-/ Religions-Paulus zum Kunst-Saulus zurückzuarbeiten, woraus sich unsere Tätigkeit am „work in regress“ ergab. Das Werk, zurückgeführt auf die Bedingungen seiner Entstehung, kann nur als abgelegtes Werkzeug gekennzeichnet werden, und der Fortschritt des Arbeitsprozesses ergibt sich als ein Durchstoßen zum verlässlichen Grund, zum Fundament, zur verlässlichen Basis oder zur arché (wie in Architektur). Lateinisch heißt dieser Ankergrund Religion.
Wie versuchte man immer schon solchen Grund zu erreichen? Durch Regress auf das, was man immer erneut vorführt, wahrnimmt, liest (releggere), weil man es für wiederholenswert hält. Das ist das Grundlegende. Aus solchen Gründungen der religio als releggere erklärt sich auch, warum Theks Arbeiten am „work in progress“ von 1963 bis 1977 so relativ wenige ikonografische Differenzierungen und materiell, organisatorische Erfindungen aufweisen, sondern von ihm kanonartig wiederholt werden. Diese Grundlegung durch immer erneutes Zeigen, Vorführen und Lesen ergibt eine andere Begründung für Parallelaktionen zum Thek-Werk wie „arte povera“ und „Minimalismus“, mit denen der Sache nach (Regress zum Kern) Theks Konzept direkt vermittelt ist.
Kann man diese Nähe Theks zu 60er-Jahre-Programmatiken bezweifeln?
Unsere allgemein anerkannten Autoren des angeführten Buches zur Thek-Ausstellung behaupten, Theks Maxime „more is less“ bedeute das Gegenteil von „less is more“, welcher alle „work in regress“-Avantgardisten folgten. Na, denn mal sehen: wenn less/ weniger Ornament und weniger Oberflächenattraktivität mehr / more Ausdruckskraft im Willen zur Form darstellt, dann ist mehr Oberflächengekreusel, mehr Pornografieattraktivität, mehr Unterwerfung unter Bildsuggestion und das gesellschaftliche Getue eben ein Weniger an Seelenkraft, an Gedankenmacht und an Formfügung. Also, weniger Fressen erhöht die Genussfähigkeit und viel/ more Fressen bedeutet weniger/ less Sensibilität für die feinsten Unterschiede, die erst den Genuss ermöglichen.
Demnach, liebe Autoren, bleibt es dabei, dass Askese (die ist mit less/ weniger gemeint) der erfolgreichste Weg zur Steigerung/ more des Reichtums an Bedeutungen ist, bei Thek ebenso wie bei Fabro (arte povera), wie bei Judd (Minimalismus) oder wie bei Sullivan, dem Programmatiker des „less is more“. Askese ist die einzig sinnvolle Form des Luxurierens.
Heute geht es vor allem um ein entsprechend asketisches Exerzitium für das Publikum, dessen fanatisierte Kulturgläubigkeit allein schon durch die schiere Masse von Anwesenden in Ausstellungen überall die Aporie produziert, dass das massenhafte Interesse der Ausstellungsbesucher gerade daran hindert, sich mit den ausgestellten Arbeiten in Ruhe und Intensität und Ausdauer beschäftigen zu können. Zum Teil werden die Verweildauern vor einzelnen Exponaten diktiert und der Durchgang durch die Ausstellungen strikt reglementiert. Daher wird es verstärkt zum Wirkungsziel für Kuratoren, auch für sich selbst kuratierende Künstler, die bekenntnisgeilen Kunst- und Kulturpaulusse von ihrem Erwartungsdruck auf Offenbarungsgeschehen und Ereignisattraktion durch Enttäuschung zu befreien ; das entspricht der alten Aufklärerstrategie, Enttäuschung, also Befreiung von suggestiv wirkender Täuschung durch brillante Darstellungs- und Ausstellungstechniken, anzustreben: eine erfolgreiche Aufklärung, denn das Gros postduchamp’scher retinaler Kunstberauschungsformen ist ja wahrhaft enttäuschend.
Die Entzauberung des Werkpathos zugunsten der Konfrontation mit den Werk-Zeugen als Werkzeug hatte Thek spätestens Mitte der 60er Jahre bei seinem Münchner Beuys-Erlebnis und seiner Konfrontation mit der Arbeit von Warhol in der New Yorker Factory mitgekriegt. Natürlich war die Diskussion über Werkgerechtigkeit und den Abschied vom Pathos des Kunstwerkschaffens seit Luther auch in der jüngsten Moderne schon grundsätzlich geführt worden. Thomas Mann lässt Adorno in Teufelsgestalt dem Avantgarde-Komponisten Adrian Leverkühn mit allem Nachdruck klar machen, warum es mit der Schöpferseeligkeit des künstlerischen Genius ein für allemal aus ist (Dr. Faustus, 25. Kap.). Statt das zu beklagen, sollten besagte Autoren im Hinblick auf das Fortleben der Thek’schen Werke eher als aussichtsreiche Perspektive begrüßen: „wo keine Werke ausgewiesen wurden oder Sequenzen herausgenommen werden konnten, wo nichts für eine Verwertung vorgesehen war, da blieb auch nichts nach ... nur einige Fragmente liegen irgendwo noch als Strandgut einer unbekannten Epoche herum ...“ (S.55). Jawohl, aber das ist gerade die Voraussetzung für das Wirken „meiner Ideen“, so Thek, „sodass man davon nicht mehr loskommt“. Wie das? Die Antikenrezeption, so lernte Thek bei seinem Romaufenthalt von 1963/64, hat gezeigt, dass man gerade von den Trümmern fasziniert bleibt, während inszenierende Rekonstruktionen zum Kitschklamauk der pleasuredomes werden. Selbst wissenschaftlich noch so einwandfrei begründete Rekonstruktionen der Polychromie von griechisch-antiken Statuen und Architekturen kommt gegen die geist- und gemütsstimulierenden Trümmerlandschaften in Schwarzweiß nicht an. Demzufolge können Theks „hemera kai erga“, sein Leben und Arbeiten nur wirksam bleiben, solange wir keine authentischen Rekonstruktionen seiner Ausstellungen besitzen, sondern nur ruinöse Bruchstücke, die auf ein Werk verweisen, welches es niemals gegeben hat, das aber in Jedermanns Vorstellung den Wunsch weckt, es möge existiert haben oder doch einmal den eigenen Sinnen gegeben sein.
Als uns Generationsgenossen damals Theks Arbeiten vor Augen traten, sahen wir sie als Verweis auf etwas zugleich Zukünftiges und Vergangenes; zukünftig als zu erwartendes ThekWerk und als Regress auf die Vergangenheit mythischer Überhöhung von banaler Lebensgeschichte. Man erwartete es als zukünftigen Triumph eines Werkes in der Imitatio der Schöpfung aus dem Nichts und als Reaktivierung ältester Wandlungstechniken, der Mythologisierung. Dafür gab es unter Künstlern das Beispiel der Jenaer Romantiker von 1800, die laut Novalis das Romantisieren und Poetisieren als mythisches Aufladen von Alltagsverrichtungen anstrebten. Wir hofften inständig, dass Beuys und Byars und Carolee Schneemann und Alan Kaprow und Wolf Vostell und eben auch Thek nicht auch als Nazarener im religiösen Dogmatismus landen würden, wie das für einige Romantiker (und nicht die Schlechtesten) nach 1806 der Fall gewesen war. Das jedenfalls steht fest: vor seinem Tode hatte Thek bereits die Ausflucht ins Nazarenertum hinter sich gelassen.
Nach dem Tode Theks wird niemand je sein großes Weltschöpfungswerk sehen, selbst wenn es gegen jede Wahrscheinlichkeit hätte entstehen können. Harry Szeemann versuchte schon früh einen Ausweg zu finden. Er vereinheitlichte den Anspruch auf Werkgeltung, die von keinem Individuum mehr einzulösen ist, mit dem Bedürfnis nach Überhöhung der armseligen Lebensäußerungen im Alltag. Szeemann postulierte mit Blick auf Thek das Rettungskomplett „individuelle Mythologien“. Aber, das ist nur eine poetische Fassung einer Aporie – Mythologien, die nur von Individuen hervorgebracht und genutzt werden, sind eben bloß Sammlung poetischer Metaphern, wie sie Lyrikbände bieten, also nur für ein Einzelwerk erheblich. Wer andererseits Mythologisierung nur als Konservierung von Spuren betreibt, überhöht nicht die Banalität der Alltäglichkeiten, sondern fixiert Vorleben und Vorwelt wie Insekten und Holzsplitter im Bernstein. Das bedeutet, Spurensicherung wurde häufig zur Strassproduktion und das Romantisieren als Bedeutungsanreicherung ergab Kunstgewerbe. Das soll nicht als Vorwurf individuellen/ künstlerischen Unvermögens denunziert werden, sondern als objektive Tendenz jener kunstseeligen Verwechslung von Werkpathetik mit der Demonstration von Werkzeuggebrauch.
Alle besagten Kollegen Theks wie auch er selbst waren teilweise dem Vorwurf ausgesetzt, zuviel Strass und Kunstgewerbe geboten zu haben, woraus sich die stauenswerte Rekurrierung von gläubigen, aber unbedarften Anhängern erkläre.
Mit der Erfüllung des Werkkonzeptes als Schöpfung ex nihilo ergeht es uns wie mit der Heimat, die laut Bloch jedem als unmittelbare Bestimmung seines Sehnens und Strebens nach Frieden vor Augen steht, in der aber noch nie jemand gewesen ist, geschweige denn je sein wird. Also hört auf, uns das Werk von Thek möglichst authentisch rekonstruiert doch noch bieten zu wollen. Die Ruinen reichen völlig aus, zwischen den Ideen, Vorstellungen und Willensäußerungen einerseits und den Resultaten der Anwendung von Ideen, Vorstellungen und Willen auf Arbeitresultate andererseits zu vermitteln. Mehr ist weniger.
Beuys hatte es als Erster geschafft, selbst bedeutende Museen zu veranlassen, seine Arbeiten ausschließlich als werkverweisendes Werkzeug abzulegen. Heute sollte doch jeder würdigen können, welche großartige Leistung er erzwang, als sogar seine populäre venezianische Installation der Straßenbahnhaltestelle von Kleve nach Übergabe ans Museum dort nur in unauffälliger Auffälligkeit, also ohne jede inszenierende Rekonstruktion schlicht auf dem Boden abgelegt werden musste. Man präsentiert Paul Theks künstlerische Potenz unter Wert, wenn man sich, wie jüngst in Luzern geschehen, zu einer inszenierenden Rekonstruktion Thek’scher Ausstellungen aus Restposten verpflichtet glaubt. Das ist beileibe kein neues Thema.
In den 60er Jahren verwahrte ich mich wie Kollegen gegen ähnlichen Umgang mit Spuren von action teachings, happenings oder fluxus-Demonstrationen: „Die Spurensicherung ist später zu einer regelrechten Mode künstlerischer Attitüden geworden, ohne das der entscheidende Gesichtpunkt aufgenommen, geschweige denn weiter entwickelt worden wäre, denn solches Vorgehen darf nicht über das künstlerisch instrumentelle Aktionsmoment hinaus zum Kunstwerk hochstilisiert werden. Es kann dann zwar marktträchtig werden, verliert aber für den Rezipienten seine Bedeutung als Erkenntnis- und Aneignungsmittel.“ Die Erkenntnis- und Aneignungsmittel nannte ich theoretische Objekte (siehe Begriffsregister im zitierten Band), um unsere Vergegenständlichungsformen eindeutig von den pathetischen Kunstwerkeleien abzuheben. Die Autoren, S. 57: „Thek ging es um die Aktualität des Geschehens und den unmittelbaren Gebrauch der Ausstellung. In diesem Sinne provoziert die Passivität der geschaffenen Werke das Scheitern ihrer Wirkung nur, wenn niemand bereit ist, die Botschaft zu verstehen und weiterzuführen“. Richtig, aber da muss man wohl daran erinnern, wie rigide gegen die Besucher von der Thek-Mannschaft vorgegangen wurde, wenn die Besucher sich anzumaßen schienen, die Arbeit „weiterführen“ zu wollen. Nix da von unmittelbarer Wirkung oder unmittelbare Reaktion der Besucher. Sehr prononciert stellen die Autoren fest, dass Thek die „Ausstellungen als einen Raum vorführt, indem das Kollektiv (seiner coop-Besatzung) gelebt hat, eine Werkstatt, in der aus ihren Lebensformen eine Pyramide oder anderes hervorgetreten ist, für eine Zeit, die ungezwungen und fließend von der gemeinsamen Produktion in den gemeinsamen Konsum wechselt“. Richtig! Aber wer das als Ausstellungsbesucher so glaubte verstehen zu sollen, wurde damals ähnlich rigide zur Besucherordnung gerufen wie heute, und zwar nicht nur vom Aufsichtspersonal, sondern von den Künstlern und ihren Mitarbeitern höchst eigenhändig (Ich habe mal versucht, ein Beuys-Werk weiterzuführen, um die in Besitznahme der Werkzeuge durch Kunstsammler ad absurdum zu führen – da heulten die Wölfe).
Zu „Lebensformen“, also Formen des Lebens im Museum möchte ich anmerken, dass wir im Stil der Avantgarde des frühen Zwanzigsten Jahrhundert zwar unter der Anleitung des Museumsreformers Gerhard Bott gefordert hatten, das Museum als Arbeitsplatz zu definieren und mit allen Möglichkeiten auszustatten, im Museum zu leben! Natürlich blieb das selbst in den bewegenden 60er Jahren ohne Erfolg. Auch der Wechsel in Ausstellungsorte jenseits der Museen führte nicht zum „ungezwungenen und fließenden Wechsel von der gemeinsamen Produktion in den gemeinsamen Konsum“. Stattdessen – und das ist nun wirklich ein bleibender Erfolg von Ausstellungsmachern - wurden die gelungensten Ausstellungen vielmehr zu „living museums“, zu Orten experimenteller Geschichtsschreibung wie etwa in der Archäologie, die historische Epochen auf Zeit von ausgewähltem Mitmachpublikum für definierte Experimente bis zu drei Jahren Dauer verlebendigen lässt. Thek hat fast unmittelbar Darstellungsformen archäologischen Arbeitens für seine Ereignisszenarios übernommen (Laufstege über ergrabenem Grund, Markierungstafeln, Kartierungsleinen, halb erst aus dem Boden ragende Strukturen nicht identifizierter Objekte, so genannte Ubos = unbestimmte bodenbewohnende Objekte.)
Ausstellungen wandelten sich von Tresorpräsentationen zu Demonstrationsarenen für Herstellung und Gebrauch von Werkzeugen der Erkenntnis, der Welterfahrung und der Zukunftsorientierung (daher ihre nichtleugbare Nähe zu Messen, Mustermärkten, Lehrmittelschauen). Der Wechsel von der Vorbildlichkeit der Kunstwerke (normativer Akademismus) zur Beispielhaftigkeit des Künstlerumgangs mit theoretischen Objekten veränderte den Status der Künstler von Experten der Meisterschaft zu Beispielgebern im Beispiellosen, also Beispielgeber für die Konfrontation mit dem Nichtwissen, Nichtvermögen, Nichtbeherrschen, d.h. mit der Wirklichkeit. In diesem Sinne ist auch die von Paul Thek geforderte Erziehung zum fruchtbaren Dilettantismus, einer Grundrichtung moderner Aufklärung, zu verstehen; die Wandlung von Experten als Problemlösern zu Experten der Problemfindung; Wandlung von der Präsentation der Selbstgewissheiten, des künstlerisch Meisterhaften zur Attraktionkraft radikalen Zweifels. Die überlebensnotwendige Hochspezialisierung von nahezu Jedermann in einem kleinen Felde führt zwangsläufig zum Anwachsen des allgemeinen Dilettantismus in allen anderen Feldern. Die Vermittlung solchen universellen Dilettantismus an die Gemeinschaften, vor allem auch Künstlergemeinschaften vom Bauhaus bis zum Thek’schen „Hühnerstall“ bildet den Grundgedanken der Demokratie als Verabredung zum Fruchtbarmachen der allgemeinen Beschränktheit all derer, die ihr ganzes Leben und Arbeiten leidenschaftlich einem einzigen Problem widmen, das gerade in dem Maße immer unberechenbarer also interessanter erscheint, wie man das Problem beackert. An erfolgreichen Gruppen können also nur leistungsfähige Spezialisten mitwirken, die es sich deshalb leisten können, ihr gerechtfertigtes Selbstbewusstsein zu nutzen, um die Beschränktheit in allen allgemeinen Belangen des Lebens souverän auszuhalten. Diese Qualität haben Künstlerjünger, Parteigänger, Delegierte, Glaubensgemeinschaftler im Durchschnittsfalle eben nicht. Auch Thek hatte es versäumt, darauf zu achten, dass seine Coopisten, jeder für sich, selber formidable Künstlerpersönlichkeiten waren.
Nur Anfänger demonstrieren, was sie alles können, Fortgeschrittene lassen sich auf das ein, was ihnen als Zumutung entgegen tritt, also das Leben. Thek formulierte „life is what happens while we are making other plans“. Zu Leben heißt also, sich auf das einzulassen, was sich den eigenen Vorstellungen und Vorhaben nicht unterwerfen lässt. Demnach ist eine gelungene Ausstellung im Sinne Theks wie aller postduchamp’schen Künstler die Versammlung dessen, was sich gerade nicht in die Form des Werkes bannen und in das explizite Konzept implementieren lässt. Derartige Ausstellungen präsentieren eben die Welt des Künstlers als Werkstadt (die für „Westkunst“ auch mit Bezug auf Paul Thek entworfen wurde und heute als Werkstadt Graz fortlebt), um die Gedanken des Schöpfers bei seiner Arbeit bestenfalls durch die Kenntnis des Werkzeuges erfahrbar werden zu lassen.
Seit die christliche Theologie zur Basis aller Kunsttheorie wurde, produzieren alle diejenigen, die wie Dürer in der Imitatio Christi oder wie Dürerschüler in der Imitatio Düreri stehen, also in der Nachahmung (mimesis) von Künstlerattitüden arbeiten, keine Werke mehr, sondern Wirkungen. Christus schuf keine Werke, sondern Wunder, und Wunder ist nichts als die Kennzeichnung einer spezifischen Wirkung. Auf diese spezifische Wirkung des Arbeitens von Künstlern kommt es an, und nicht auf die Verfügung über Werke der sekundären Schöpfung von Gottimitatoren. Der Meisterkünstler als Gottimitator ist nur noch eine Phantasmagorie, selbst wenn sie institutionell gestützt wird, wie Lüppertz durch sein Akademiedirektorat. Die Anderen, von Beuys über Thek bis zu Schlingensief und Meese, bewegen sich in der Tradition der Imitatio Düreri, also als Wundermänner. Aus der immanenten Konfliktdynamik zwischen Werk und Wirkung ergibt sich gerade nicht, dass etwa wie bei Meese das Kinderzimmer oder bei Schlingensief die Geisterbahn, bei Beuys das Depot des naturkundlichen Museums oder bei Thek das überdachte Areal eines archäologischen Grabungsfeldes zum modisch neuesten Werktypus erhoben wurden – obwohl sie nachweislich derartige ummittelbare Regressionen in Anspruch nahmen. Diese professionalisierten naturkundlichen Depots, Geisterbahnbetriebe, Kinderzimmersimulationen oder Schliemann’schen Felder sind nicht bloße Moden, nicht neue Gattungskreationen und Spektakelschöpfungen, die als action teaching, Lehren und Lernen als Aufführungskünste, Performancepraxis, Ritualkunst lauthals in Umlauf gesetzt wurden. Vielmehr entsprechen sie der Entdeckung und Anwendung von Wirkungsformen, von Wirksamwerden der Ideen, Vorstellungen und Willensäußerungen, die über sechshundert Jahre Kunstgeschichte zugunsten von Werkkunde und Erziehung zum Werkschaffen vernachlässigt worden waren. Mit der Indienstnahme von Kunstwerken als Ikonen des Kapitalismus, d.h. Ikonen der göttlichen Kapitalschöpfung aus dem Nichts, gab es als Alternative nur die Möglichkeit, sich vom Werkschaffen auf das Wundertun, also auf Wirkung ohne Werk, aber mit raffinierten Werkzeugen, auszurichten. Von der Zinsknechtschaft des Kapitals zur Wertevermittlung durch Arbeiten führte das Wandlungsgeschehen, das Beuys mit zartem Läuten als Fluxusmusik begleitete. Ludwig Erhardt hatte Kapital und Arbeit mit dem Konstrukt Soziale Marktwirtschaft so versöhnen wollen, wie Szeemann die Mythologie mit dem individuellen Bildgebrauch. Die von Erhardt angesprochenen optimierten Wirkungsabsichten durch entsprechende Zahlungsangebote, die man schlecht ablehnen kann, wurden durch die wunderbare Schilderung dieser Verfahren in „Some like it hot“ populär, d.h. als harmlose Lustbarkeit gebannt.
Die Künstler aktivierten aus den Epochen der Kulturen vor Erfindung der Kunst als besonderer Erkenntnisleistung etwa die römisch-antike Rhetorik, um Wirkungsoptimierung zu studieren. Das übertrugen sie nicht nur aufs Ausstellungmachen und Theaterinszenieren; sie studierten derartige Wirkungsoptimierung eben auch bei der Konkurrenz der individuellen Mythologen, den Sozialen Marktwirtschaftlern und ihren Kaufimpuls stimulierenden Warenpräsentationen in Kaufhäusern, sowie den Einsatz von Propagandamitteln in der Medieninszenierung der Politik sowie die Chuzpe der Lehrer in Schulen und der Pfarrer in Kirchen, ihre Klientel von Schülern und Gläubigen zu zwingen, gefälligst zu tun, was sie wollen. ”Herr Kurator, müssen wir Besucher heute wieder alles alleine machen, wie wir es wollen?“
In dem Maße wie etwa Anfang der 60er Jahre vom Papst Johannes Paul XXIII zur vermeintlichen Demonstration von Fortschrittlichkeit die hoch anspruchsvollen Rituale im katholischen Kult durch Liturgiereform eingeschränkt wurden, verlagerten die Künstler das unumgängliche Vermittlungsbedürfnis zwischen Geist und Körper durch ritualisierte Bewegung aus den Kathedralen in die Museen, wo nun auch Atheisten in den Genuss der Legitimation von Wirkungsanspruch des Geistes durch Verfahren kommen konnten. Happenings wurden deshalb so schnell abgewertet, weil die katholische wie die protestantische Kirche diese Form des Mitmachtheaters in die Organisation des Gottesdienstes einstellten - mit bedauernswerter Wirkung, ja geradezu kläglich angesichts des hohen Anspruchs auf Partizipationen der Gläubigen an den Verlebendigungsformen des Geistes. Bei allem Verdienst von Susanne Delehanty, die 1977 den Versuch machte, den „religiösen Hintergrund seiner großen Installation en detail aufzublättern“ (S.66), wurde es nicht plötzlich ruhig um Thek, weil sein Bedeutungsgeschiebe mit Sand, Splitterholz, Zeitungen, Gartenzwergen, ausgestopften Tieren und zum Lufttrocknen auf die Wäscheleine gehängter Fleischfetzen von Delehanty als bloße replica katholischer Ikonographie und Liturgie entlarvt worden wäre. Vielmehr wussten die Besucher seiner Ausstellungen immer weniger von eben jener Tradition der christlichen Ikonographie und katholischen Liturgie und noch viel weniger von dem Gründungswerk der europäischen Ikonographietradition, also von Ovids „Metamorphosen“, denen auch Thek in Rom zu huldigen gelernt hatte.
Darüber hinaus wurde für die wenigen noch Verständigen ein befriedigendes Missverständnis unproduktiv: die sogenannte Religiosität eines Künstlers. Auch unsere Autoren führen dieses unproduktive Missverständnis (S.60) exemplarisch vor „Paul Thek war sehr religiös und insbesondere dem katholischen Glauben verpflichtet. Er war darin jedoch weniger Dogmatiker oder fanatisch, noch ließ er sich auf den Bereich der christlichen Tradition festlegen oder wohlmöglich von einer aktuellen kirchlichen Institution vereinnahmen. In seiner Beziehung zum Glauben behielt er selbst immer die Initiative, und er mischte sich in Dinge ein oder mischte Dinge hinein, ein Herumhantieren mit Ikonographie von irgendetwas, wie dies weder die Kirche noch die Gläubigen geduldet hätten. Fragmente fernöstlicher Religionen oder Erleuchtung durch Drogen, die Idee des kollektiven Unbewussten oder Schamanismus ... alles das sprach er ohne Probleme an“.
Hmmh Hmh, so hat man sich das vielleicht als Yuppie in den 80er Jahre zurechtgelegt, wo Plünderung fremden Eigentums als kapitalistische Tugend auf die Künste und Wissenschaftspraktiken übertragen wurden, damit die weniger intellektuell Begabten sich ohne Skrupel fremder Ideen bedienen konnten oder hochtrabend in jeder Hinsicht dummes Zeug wie Nichtlinearität des Erzählens oder Tod des Autors und Dergel bedienen konnten. Man kann nicht dem katholischen Glauben verpflichtet sein und dann nach individuellem Belieben sich der Versatzstücke von Bildbedeutungen, Ritualen, Zeremonialgerät selektiv bedienen. Genau das eben charakterisiert den Unglauben; und wenn man sich aus den beliebigen Zugriffen so etwas wie einen Synkretismus als Methode oder auch als Weltanschauung zulegen möchte, gehört dazu die Verpflichtung auf Geltungsansprüche. Besteht man aber auf der Durchsetzung von Geltung, hört die schöne Eigensinnigkeit auf, wie auch das Herumhantieren mit Exotischem. Schamanismus zum Beispiel ist im Hinblick auf Legitimation mindestens so strikt rational wie bei uns Legitimation zum ärztlichen Tun aufgrund von bestandenen Examen und Appropriationen. Wer das nicht anzuerkennen bereit ist, sollte darauf verzichten, seinen Mutwillen mit Verweis auf fernöstliche Praktiken interessant zu machen. Und wem in den Sinn kommen sollte „all das auch noch ohne Probleme anzusprechen“ scheint vollständig auf der Teerfalle der Yuppie-Accessoires festzukleben.
Für Jemanden, von dem behauptet wird, wie die Autoren von Thek S.56, „die innere Dynamik dieses Dramas ist beherrscht von der Suche nach einer Rettung, nicht einfach der eigenen Haut, sondern der ganzen Welt“ scheint der Rückgriff auf beliebige Hantierungen mit Ikonographien fernöstlichen Erleuchtungen durch Drogen etc. als völlig unangemessen. Die Unangemessenheit enthüllt sich dann in zahllosen Details, wie etwa der Behauptung, „Paul Thek verstand die Passivität (als besonderes Merkmal seiner Kunst) als eine religiöse Bereitschaft, nämlich fähig zu sein, Gnade zu erwarten“. Da wird der Umgang mit Theoremen selbst zu einem Belieben, dass man eben noch Thek andichten wollte. Das Motiv der Gnade steht nun gerade für protestantische Orientierung auf das Prinzip der Wirksamkeit nach Wunderart. Nur die Gnade Gottes und eben nicht das Werkschaffen, nicht das Dinghantieren und die individuelle Bedeutungshuberei oder die touristengefällige Fernostbeschwörung führen nach Luther zum Erfolg der Rettungsversuche. Nichts kennzeichnet Luthers Absetzung vom Katholizismus, dem Thek doch angeblich so verpflichtet war, derart eindeutig, wie die Lehre, dass alles Werkschaffen uns der Gnadenerfahrung nicht näher bringt, sondern dass wir uns mit dem konzeptkünstlerischen Arbeit an den Ideen, Vorstellungen und Willensformen bescheiden müssen (selbst noch beliebigere Subsumptionen des Thek’schen Arbeitens unter die Bildorgien von „Clockwork Orange“ oder damenhafterer Selbstverwirklichungsbasteleien dürfte nicht zu der Behauptung führen, Thek sei Calvinist gewesen, der an seinem Kontostand den Gnadenstatus glaubte ablesen zu können).
Im Hinblick auf solche irritierenden Einlassungen der Autoren muss ich für sie als alter Hase der Kunstheologie (der Beuys dem Hasen die Kunst erklären hörte) doch noch auf einige Merk-Male Theks verweisen, wie der ungläubige Thomas auf die Seitenwunde Christi. Das darf sich ein Generationsgenosse und Kohortennachbar von Thek wie ich es bin, wohl doch herausnehmen.
Es war keineswegs der Unwille Theks über die Forderungen von Szeemann, Hultèn, de Wilde oder Ammann „immer wieder die entsprechenden Exponate (einige Meatpieces) und vor allem aber den Toten, der natürlich als Hippie (im Sarg) geordert wurde, zeigen zu müssen“ (S.52), mit oder ohne Varianten von hunderten von Knoblauchknollen auf der Leichenzudecke. Thek musste sich vielmehr mit der Sarginszenierung ungemütlich fühlen, weil seit 1966 durch Sergio Corbuccis Italowestern „Django“ mit Franko Nero das Motiv des Mannes, der einen Sarg hinter sich herschleppt, bis ins letzte Dorf verbreitet worden war. Und mit der Dracula-Welle wurde jedem die Knoblauch-Ikonographie so bekannt wie die der Ostereier. Es spricht für Thek, dass er sich genierte, als After-Künstler oder als Filmmythen-Illustrator belächelt zu werden.
Mich hat 1972 zur Dokumenta V bei der Installation des Thek-Beitrages das Verhalten von Thek und Mannschaft doch irritiert. Manch einer von den Vorabbetrachtern brachte dort deutlich hörbar mit maliziösem Unterton, also bewusst gegen die Dämmerungsaura verstoßend, jene Sandkastenarbeiten beim familiären Dünennestbauen und bei den Burgenbauwettkämpfen an westfriesischen Stränden ins Spiel. Das ist Thek und den Seinen sichtbar gegen den Gemütstrich gegangen. Sie meinten es ganz ernst mit ihren Regressen auf den Ursinn (arché) der religiösen Festformen und Kultriten – sie wollten tatsächlich die weitgehend sinnentleerten Feiern an Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten etc. auf neue Weise begründen und eine neue Ereignischronologie stiften.
Ich persönlich hielt das damals für die bedeutendste Ambition von Künstlern wie Beuys, Byars, Thek. Martin Warnke, Heinrich Klotz mit Kindern und Frauen und Melusine Huss erprobten unter meinem Dirigat Anfang der 70er Jahre in der Marburger Wohnung von Klotz derartige Neubegründungen zum Beispiel des Weihnachtsfestes. Thek hatte tatsächlich die Kraft zu einer solchen neuen Grundlegung als Recreatio, ja als Renaissance ritualisierter Vermittlung von Bewusstsein und Gesellschaft. Darin hätte man sehr wohl die von den Autoren angesprochene Rettungsstrategie sehen können. Es ging nicht nur um die Vergegenwärtigung von Überlebensvehikeln wie der Arche, des Floßes der Medusa, des Turmbaus zu Moskau (der Universalsozialismus galt ja durchaus als Rettungskomplett vor der kapitalistischen Vernichtungskonkurrenz und vor der Zerstörung der Welt durch Ausbeutung); sondern um eine möglichst grundsätzliche Veränderung der Einstellungen und Erwartungen gegenüber Rettungsphantasien. Wie gewichtig diese künstlerische Strategie war, ergab sich aus der zeitüblichen Anweisung an Schüler und andere Zeitgenossen, sich vor atomarer Zerstörungsgewalt durch Abducken unter Tische oder durch Abschattung des Gesichts mit einer Aktentasche zu retten. So heruntergekommen war die christliche Eschatologie unter dem Druck des Bilderzaubers von Massenmedien.
Thek versuchte zwei Verweise auf historisch erprobte Rettungskompletts zu rekreiieren, das Zeichen der Schildkröte und das des Grabmals wie auch die Verbindung beider. In Rom hatte er für diese Vermittlung hoch gerühmte Beispiele kennen gelernt, da sie in öffentlichen Räumen (vom Friedhof über den Platz bis zum Vatikanischen Museum) jedem Rombesucher entgegentraten. Das Prinzip der Ewigkeit als großer zeitlicher Dauer, für die die langlebige Schildkröte seit ältesten Zeiten stand, verband diese Tradition mit der Repräsentation platonischer Ideen in Formgesetzen der antiken Architekturen.
Der Obelisk auf der Schildkröte oder die Kultgerätschaften auf Schildkröten als Füßen waren in der römischen Ikonographie omnipräsent als Mahnung festina lente, d. h. schreite nur so schnell voran, wie du glaubst es auf lange Dauer durchhalten zu können. Natürlich hat Thek das Motiv der Schildkröte, dass uns etwas Entscheidendes lehrt, auch aus indianischen und asiatischen Traditionen angeeignet (unsere Autoren weisen darauf hin). Man sollte aber betonen, dass Thek aus der Gestaltungslogik eines Motivs seine Bedeutungsübertragungen erbringt, und nicht durch Vermischungswillkür in freien Hantierungen.
Die zweite Ebene der Vermittlung beider Prinzipien (Leben und Ewigkeit) boten die großen Museen vom Metropolitan Museum in New York über das Britische Museum in London, den Louvre in Paris und die Vatikanischen Museen in Rom, die damals wegen gesteigerten touristischen Interesses ihre Räume zu Erlebnislandschaften umbauten. Dabei wählten sie den historischen Typus des Mausoleums, einer späten Erfindung des Alexandernachfolgers Mausollos.
Es gab eine rege Debatte, ob den Museen gestattet sein dürfe, nicht nur Skulpturen und Mumien, sondern auch mumifizierte Körper in voller drastischer Identifizierbarkeit zu zeigen. Thek hat sich nachweislich auf diese Debatte eingelassen, seine vielfachen Variationen des Themas von „The Tomb/ das Grab“ seit 1967 gehen auf Besuche in den Katakomben Palermos wie Besuche der verschiedensten ägyptischen Abteilungen besagter Großmuseen zurück. Soweit ich weiß gibt es aber von Thek keine überlieferten Erörterungen über das „Konzept Mausoleum“, bei dem ja die Lebenden aufgefordert werden, die Toten zu besuchen – ein Unterschied ums Ganze zu den ägyptischen Memorialbauten, von denen Thek nicht nur das Formschema der Pyramide in mindestens vier Variationen übernommen hat. Der Besuch in einem Tresormuseum unterscheidet sich vom Besuch in einem Mausoleum vor allem dadurch, dass im Mausoleum der Tote als anwesend repräsentiert wird. Thek übertrug das Mausoleumskonzept auf das Museum. Wie er solche Übertragung im Hinblick auf große skulpurale und architektonische Formen zu bewerkstelligen wusste, zeigt die Arbeit „crèche“ von 1970 besonders überzeugend.
Ausgehend von der Tradition der Ikonographie, derzurfolge die Geburt Christi in einem verfallenen Stall mit Futterraufe etc. dargestellt wird, übertrug Thek einen alten Schuppen komplett mit allen Zerfallszeichen in einen musealen Raum üblicher Malereipräsentationen auf eine Art und Weise, als hätte er die Wirkung des Bildmotivs in 3-Dimension unmittelbar im Wahrnehmungsraum vor dem Gemälde realisiert. Das ikonographische Konzept besagt, dass sich mit Christus die Welt grundlegend erneuert, indem das Unterste und Niedrigste die Welt regieren wird, während die bisher weltbeherrschende Macht mit all ihren Insignien zerfallen muss. Die Tradition der gebauten Bilder, der medialen Transformation, beherrschte Thek in bewundernswerter Selbstverständlichkeit. Zuerst hat er dieses Verfahren der medialen Transformation bei seinen amerikanischen Popkollegen kennen gelernt, etwa bei Claes Oldenburg, mit dessen Transformation von Fleisch in Wachs, von Marmor und Stein in Sack und Leinen. Einer von Theks fabelhaften Anverwandlungen durch mediale und ikonische Transformation ist der „fishman“ von 1968, einer überlebensgroßen Männergestalt in schwebender Aufwärtsbewegung. Das Medium des Schwebens wird durch zahlreiche, den Körper angeschmiegte Fische, die Arm- und Handhaltung, sowie den Gesichtsausdruck als Wasser erfahrbar. Anfang der 60er Jahre brachten die ersten Großfilme aus der Tierwelt auch Aufnahmen von Walen und Haien, die von Pilot- und Putzerfischen begleitet werden. Durch die christliche Ikonographie ist aber der Fisch als Zeichen der christlichen Glaubenskraft bestimmt (iktús). In solcher medialen Transformation steht dann der Fischmann für die Gestalt des Auferstehenden. Thek setzt den Fischmann in die Baumkrone und weckt damit die Analogie von Aufwärtskraft durch die Flügel der Vögel und Engel mit der Leit- und Orientierungskraft des christlichen Glaubens. Zudem bietet der Fischmann ein Zeichen für den Künstler in den zeitgenössischen Strömungen und Kunstbewegungen wie Vortex, Fluxus, de Strom, die alle auf der Analogie von Zeitvergehen zu fließendem Wasser aufbauen.
Bei der New Yorker Präsentation von „fishman“ 1969 in der Stable Gallery blieb der Ausstellungsraum leer, eine wunderbare Rekreation von der legendären Ausstellung von Yves Klein in Paris 1957 mit dem Titel „le vide/ the void“. Damit wurde den Besuchern, die durch die leere Galerie in den Außenhof mit dem Fischmann strömten, eine eigene Himmelfahrtserfahrung geboten im körperlichen Durchdringen der Leere. Die in dieser Art und Weise von Thek angewandten Transformationsverfahren eröffneten sich stets den Besuchern, soweit die sich nur darauf einließen, Erfahrungen ihrer wie des Künstlers europäischer Lebenswelt intensiv zu erinnern. Thek verrätselte seine Motive nicht, er eröffnete sie vielmehr zumeist in ganz unmittelbaren Verweisen. So ist Theks Auftritt in der Galerie Thelen in Essen 1973 als Weg „zur Anerkennung des Fortschritts in der Ästhetik“ sofort erschließbar, wenn man sich an eine damalige Erfindung für die Repräsentation von Designkonzepten im benachbarten Folkwang Museum erinnert. Bis heute reihen Design-Museen oder Museen für angewandte Künste auf Augenhöhe ein Dutzend oder mehr Stuhldesigns mit dem Hinweisschild „vom Jugendstil, Werkbund über das Bauhaus bis zur Postmoderne“. Natürlich liest jeder Besucher das nicht nur als einen historischen Zeitverlauf, sondern als eine Entwicklungsgeschichte; und als grundpositiv gestimmte Bewunderer der Moderne verstehen wir Entwicklungsgeschichte automatisch als Fortschrittsgeschichte. Diese Fortschrittsgeschichte kontert Thek mit dem zweiten Teil seiner Projektbeschreibung: „Objekte, die theoretisch gesehen verbraucht, herumgetragen und herumgestoßen werden könnten, und die man als Winkzeichen einsetzen könnte“, die man aber praktischerweise so nicht benutzen kann, weil sie in der Ausstellung stehen und im übrigen bereits vom Künstler benutzt wurden, sodass sie vom Besucher in Praxis nur noch zu betrachten sind.
Thek bot damit einen überzeugenden Verweis auf das Verschwinden der Dinge durch ihre Verwendung und Vernutzung. Das Gebrauchen der Dinge ist eben ein Wandlungsgeschehen von der Art der metaphorischen Übertragung, der Veränderungen ihrer Funktionen und der poetischen Überhöhung zu Sakralzeichen und Kultgerät.
Die Essener Ausstellung des Thek’schen Vorgehens hatte für mich persönlich herausragende Bedeutung, mindestens zweifach: es manifestierte sich die philosophische Erfahrung, das auf das Wesen der Dinge kein Verlass mehr sei; vielmehr gelte es, mit den Dingen so umzugehen, dass sie den Anstrengungen, unser Leben zu entfalten und bis zur letzten Möglichkeit aufrechtzuerhalten, größere Hoffnung auf Gelingen zusprächen. Theks Arbeiten haben gerade als bloße Ruinen ihrer nur theoretisch postulierbaren, aber nie erreichten Werkganzheit die Kraft zu solchem Zuspruch für die Betrachter.
Ich beende meine kleine persönlich Beispielgebung mit dem ausdrücklichen Dank an Brehm, Heil und Orth für die Geschichten, die Thek uns gelehrt hat. Für mich gebe ich diesem Gelernthaben Ausdruck, indem ich Theks Essener Titel „A Procession in Honor of Asthetic Progress: Objects to Theoretically Wear, Carry, Pull or Wave“ übersetze in „Lustmarsch durchs Theoriegelände“, wie ich ihn bis heute als meinen Lebensausdruck betreibe.