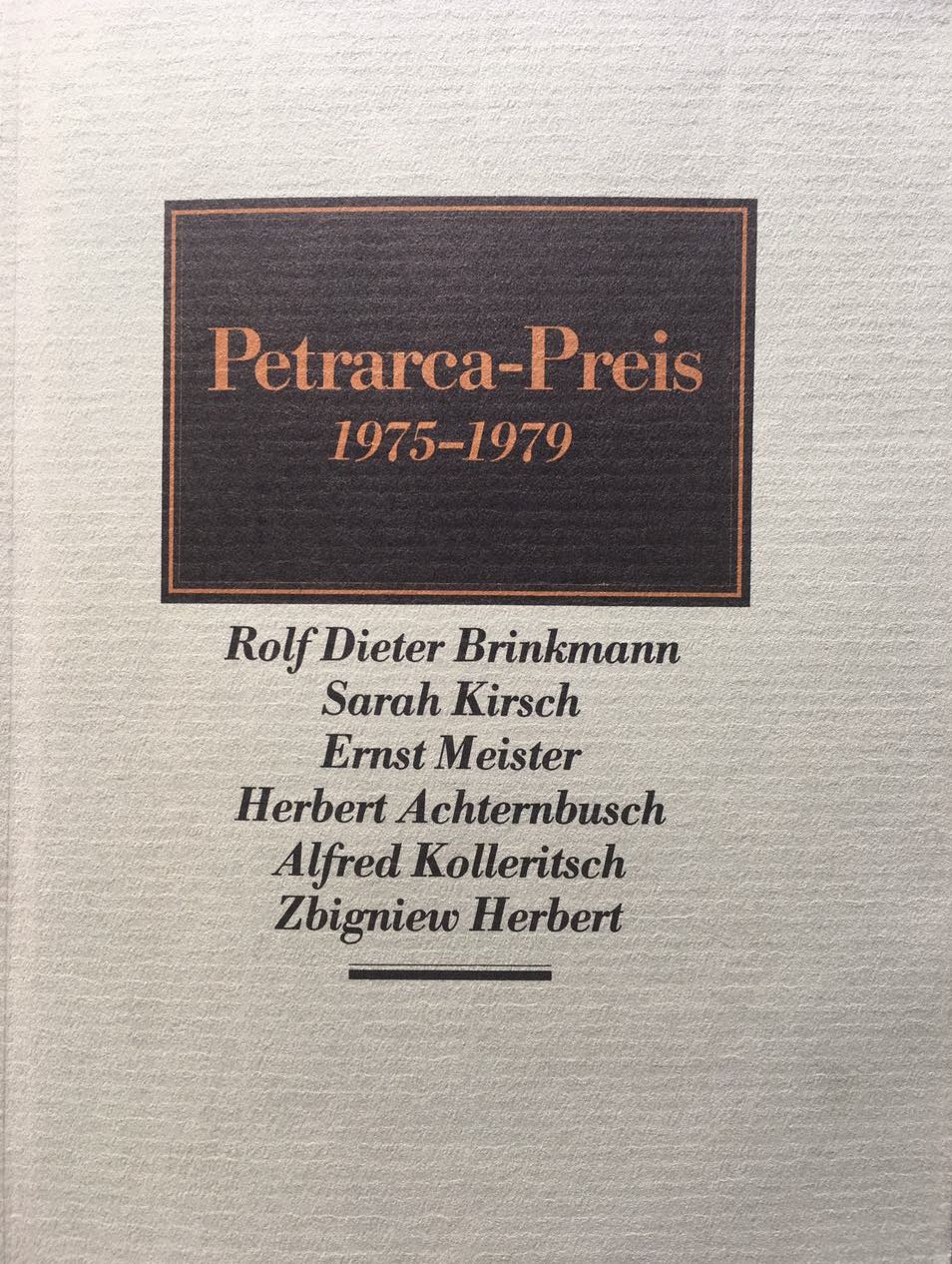Als wir uns 1974, in seinem sechshundertsten Todesjahr, Petrarca als Patron eines neuen Lyrikpreises anvertrauten, hatten wir uns vorgenommen, unsere Arbeit für den Preis auf fünf Jahre zu beschränken. Deshalb beschlossen wir, bei den Preiszusammenkünften die fünf wichtigsten Stationen von Petrarcas Lebenslauf aufzusuchen, um den genius loci und die Geopsyche der bestimmten Ereignisorte in jeweils einem der Themen zu versammeln, die Petrarca sein Leben lang beschäftigten.
1.
Als Stationen jenes Lebens auf Erden wählten wir für 1975 den Mont Ventoux, dem wir Petrarcas Topoi Berg und Theorie, Natur und Landschaft - der Wanderer als Subjekt der Landschaft - zuordneten;
2.
1976 wollten wir nach Arquà/Padua gehen, um uns an Petrarcas Alterssitz seinem Verständnis vom Humanismus als dialogischer Kommunikation und vom Leben als Exemplum auszusetzen;
3.
Für 1977 galt es, im Tusculum die Zukunft als Verwirklichung der Vergangenheit zu verstehen, also Petrarcas und seiner Freunde Versuch kennenzulernen, Zukunft zu erzwingen;
4.
1978 sollte in Arezzo/Siena am Beispiel von Lorenzettis Divisio die das 14. Jahrhundert beherrschende Frage nach dem Lebenszusammenhang, nach der Einheit von Kunst, Wissenschaft, Politik gestellt werden;
5.
1979 schließlich wollten wir in Verona, dem Ort, an dem Petrarca wesentliche antike Texte entdeckte, dem Kulturinstrument "Buch" nachspüren, das durch Petrarcas Arbeit seine bis in den heutigen Alltag andauernde Vorrangstellung unter allen anderen Kulturinstrumenten erhielt.
Wir wollten es - und wir taten es . Und daß wir es niemals wieder so werden tun können, gibt dem ausgeführten Plan seine Bedeutung: Es war einmal, wie es nie wieder sein wird - deshalb war es nicht vergeblich.
Ich gebe im nachfolgenden die Stichworte, anhand derer ich im Sinne unseres Planes bei den jährlichen Preisverleihungen versuchte, uns und unseren Freunden Petrarcas Problemstellungen zu vergegenwärtigen.
1. Wanderer und Gärtner
als Subjekte der Landschaft
Am 26. April 1335 besteigt Petrarca in Begleitung seines Bruders Gherardo den Mont Ventoux - eine für seine Zeitgenossen ganz aberwitzige Tat.
Warum sollte man sich einer menschenfeindlichen Natur, dem sturmgepeitschten Dornenurwald jenes Gipfels aussetzen, wo sie durch menschlichen Eingriff weder zu Ackerland noch zur Weide fürs Vieh umgestaltet werden konnte?
Ein Hirte, den Petrarca beim Aufstieg trifft, versichert ihm, daß es auf dem Berge nichts zu holen gebe - außer zerrissener Kleidung und geschundenen Gliedern. Petrarca bleibt unbeeindruckt, erreicht schließlich den Gipfel. Was treibt ihn an, die Mühen nicht nur nicht zu scheuen, sondern geradezu zu suchen?
In dem Bericht, den er unmittelbar nach dem Abstieg in einer Herberge verfaßt, enthüllt er seine Motive. Er hatte aus Livius herausgelesen, daß in der Antike derartige Bergbesteigungen zum Reiseprogramm der Kaiser und Könige gehörten; Philipp von Mazedonien bestieg zum Beispiel den Haimon, um vom Gipfel einen Blick auf die sein Reich begrenzenden Meere zu haben.
Zunächst ist auch für Petrarca die Nachahmung des antiken Vorbildes treibendes Motiv, das er auch durchhält: Auf dem Gipfel ist er überwältigt von der Erweiterung des Gesichtsfeldes in der Vogelperspektive, die es ihm ermöglicht, das bisher durch großräumliche Distanz Getrennte zusammenzuschauen. Während des Aufstiegs aber entwickelt sich bei ihm viel stärker ein zweites Motiv: Je größer die Anstrengungen werden, desto intensiver wird seine Selbstwahrnehmung; Körpergefühl und Selbstwußtsein bilden sich über jedes bisher ihm bekannte Maß hinaus.
Da er aber an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt, wird er sich zunehmend auch des Risikos bewußt, in das er sich begeben hat. Lustvolle Selbsterfahrung droht in Angst umzuschlagen. Er wird mit der Angst fertig, indem er nach einer Begründung für sein Unternehmen sucht, die über die Nachahmung des antiken Beispiels hinausgeht.
In einer Verschnaufpause fällt ihm diese Begründung mit großer Plötzlichkeit zu. Es wird ihm schlagartig die Analogie zwischen seinem augenblicklichen Tun und dem menschlichen Lebenslauf klar. So versteht er nun den Mont Ventoux als jenen Heilsberg, den zu erklimmen zum Beispiel Dante als Weg der Läuterung beschrieben hatte. Das Leben sei anstrengende und gefährliche Wanderschaft bis zu jenem Höhepunkt, an dem sich Seele und Selbstbewußtsein von ihrem leiblichen Träger trennen.
Der Gipfel des Läuterungsberges ist das Ziel aller Lebensbewegung und Ende des Lebensweges. Dort wird sich das Auge des Wanderers auf ihn selbst richten, um schließlich sein eigenes Inneres als die Welt zu entdecken, der er sich zu stellen hat.
So verwandelt sich für Petrarca sein praktisches Tun in ein theoretisches, in anschauende Betrachtung des Weltzusammenhangs, den der Schöpfer dieser Welt gestiftet hat.
Theoria - anschauende Betrachtung - ist das Mittel, sich selbst als Bestandteil jenes Weltzusammenhangs zu erfahren. Wo das gelingt, wird - wie sich Petrarca von Augustin sagen ließ - aus der anschauenden Betrachtung eine genießende: Die Selbstverwirklichung des Menschen wird bestätigt durch seine Fähigkeit, die Welt als das zu nehmen, was sie ist.
Aus dieser über weite Strecken noch ganz mittelalterlichen Vorstellung entwickelt Petrarca mit zunehmender Deutlichkeit bis dahin unbekannte Auffassungen und vor allem Haltungen, die ihn nicht nur sein Leben lang beschäftigen und die seine eigentlichen Beiträge zur Entwicklung dessen sind, was seit hundert Jahren mit dem Begriff »Renaissance« vergegenwärtigt wird; vielmehr markieren Petrarcas neue Auffassungen und Haltungen Probleme, mit denen wir gegenwärtig wieder verstärkt konfrontiert werden: Es ist die Frage nach der Vereinbarkeit von Subjekt-Anspruch und den Wirkungszusammenhängen des Weltganzen, das gegenwärtig unter dem Namen »Die Gesellschaft« firmiert. Ein Preis für Lyrik trägt den Namen Petrarcas mit gutem Grund, wenn der Lyriker nicht durch die spezifische Art seines literarischen Schaffens (Gedichte schreiben) gekennzeichnet wird, sondern durch spezifische Auffassungen und Haltungen, die zu der Art von Literatur führen, wie sie Lyriker produzieren. Petrarca selbst war in diesem Sinne Lyriker, auch, wo er als Historiker, Philologe, Moraltheologe oder praktischer Philosoph schrieb. Nur ein geringer Teil seines Werkes besteht aus Lyrik im engeren Sinne. Den Kern jener Haltung des Lyrikers bilden nach Auffassung Petrarcas die Fähigkeit und der Anspruch eines Menschen, »Ich« zu sagen. Dieser Anspruch wird aber nicht nur in der Hinwendung auf sich selbst eingelöst, sondern in der Fähigkeit, die Lebenswelt durch eigenständige Wahrnehmungsformen und nach Maßgabe selbst gemachter Erfahrungen zu gestalten. Das Ich wird zum Subjekt.
Petrarca demonstriert einen solchen Vorgang mit seinem Aufstieg auf den Mont Ventoux. Er geht von der Welt der Natur aus, wie sie anderen erscheint. Er versteht die Einwände des Hirten, er versteht, was Natur dem Hirten, dem Ackerbauern, dem Handeltreibenden, dem Krieger ist. Für sie werden ihre Auffassungen von der Natur durch die Art der Arbeit nahegelegt, ja erzwungen, die sie in ihren Berufen zu verrichten haben.
Petrarca als Lyriker versucht, Natur zu dem zu machen, was sie sein könnte, wenn sie nicht nur Gegenstand menschlicher Arbeit wäre: zur Landschaft als »freier Natur«. Wenn nicht objektive Bedingungen des Überlebens in der Natur, sondern die des subjektiven Erlebens der Natur unsere Haltungen ihr gegenüber beherrschen, formen wir sie zur Landschaft um. Der von Petrarca zum ersten Mal in der Neuzeit erhobene Subjekt-Anspruch erfüllt sich in dieser Hinsicht, wenn der Lyriker Natur zur Projektionsfläche seiner Wahrnehmungen und Vorstellungen macht, "zum Spiegel der Seele".
Bis auf den heutigen Tag sind wir genötigt, in diesem Sinne Landschaft zu erfahren; und es ist kein Zufall, daß Petrarca am Mont Ventoux, einem Stück zivilisatorisch unbrauchbarer Natur, seinen Landschaftsbegriff ausbildet; Natur als Projektionsfläche psychischer Prozesse des Einzelnen kann nur als Landschaft verstanden werden, wenn sie devastiert ist oder von zivilisatorischer Nutzung freigestellt zu sein scheint.
Bemerkenswert ist ja, daß unser Begriff "Kultur" sich aus der römischen "Agricultura" als der zivilisatorischen Nutzung der Natur durch Umgestaltung herleitet. Es muß so folgerichtig erscheinen, daß die Haltung der Künstler immer wieder als kulturfeindlich verdächtigt wird. Wer seit Petrarca darauf besteht, seine subjektiven Formen der Wahrnehmung und Vorstellung von Natur zur Landschaft umgestalten zu lassen, ist zumindest einem erweiterten Kulturverständnis verpflichtet, als es in Agricultura zum Ausdruck kommt.
Es ist ein theoretisches Verständnis: Die anschauende Betrachtung schließt nicht andere, weitere Horizonte, als sie in der kulturell genutzten Ebene möglich sind, zu einem Ganzen zusammen; das Ganze bildet sich nicht innerhalb neugesteckter Horizonte, sondern entsteht durch Entgrenzung, durch Öffnung der Horizonte.
Diese Haltung ist für den Lyriker aber nicht radikal durchhaltbar. Auch er kann immer nur Analogien für das bieten, was er meint. Worte und Wörter haben nur Modellcharakter, wie Petrarca versichert.
Mit Bezug auf die Landschaft ist ein solches Modell der Garten. Er ist einerseits ein Stück Kultur im Sinne der Agricultura, verweist aber andererseits über derartige kulturelle Gestaltungen der Natur hinaus. Das verstehen wir heute wieder sehr gut, wenn wir ohne weiteres akzeptieren, daß der Garten als Modell der Landschaft erst sichtbar wird, wenn in ihm das Unkraut sprießen darf. Wo ringsum alle Natur agrikulturell bestimmt ist, verdankt sich der Unkrautgarten einem anderen Kulturverständnis das Petrarca begründet hat. Er sah sich sein Leben lang nicht nur als Viator, als Wanderer, sondern auch als Hortulanus, als Gärtner. Wanderer und Gärtner sind das Subjekt der Landschaft. Der Wanderer bewegt sich auf ein Ziel zu, das zu erreichen er - wie Petrarca sagt - möglichst weit hinausschiebt. Der Gärtner ist schon im unmittelbaren Bereich seines Hauses einem Modell dessen konfrontiert, worauf sich der Wanderer zubewegt; aber eben nur einem Modell.
Der Hortulanus muß zum Viator werden, wenn er seiner Vermutung nachgibt, jemals mehr erfahren zu können, als ein Modell ermöglicht; der Viator muß immer zum Hortulanus werden, damit er wenigstens an einem Modell sich dessen bewußt werden kann, wonach er sucht.
Auch das sind zum größten Teil noch mittelalterliche Auffassungen, aber Petrarca versteht eben den Garten nicht mehr nur als Paradiesgärtlein und die sacra peregrinatio nicht mehr nur als heilige Wallfahrt.
Zwar zählt Petrarca auch die Apostel zu den ihm vorbildlichen Viatoren, aber viel mehr bedeuten ihm Scipio Africanus, Odysseus, Aeneas und Herakles als Beispielgeber. Er versteht also den Viator schon in ähnlichem Sinne wie Goethe seinen >Wilhelm MeisterBekenntnisse< er stets bei sich trägt), den er auch literarisch fixiert, macht er unbezweifelbar, daß es keinem der Dialogpartner gegeben ist, am Ende seine Wahrheit über den anderen triumphieren zu lassen. Petrarca und Augustin führen ihren Dialog in Anwesenheit aller Wahrheit, deren Urteil weder von dem einen noch dem anderen Dialogpartner erkannt oder gar vorweggenommen werden kann. Das ist ein entscheidender Schritt über das mittelalterliche Traktieren in moralphilosophischer und theologischer Absicht hinaus. Die Gesprächspartner sind der Wahrheit verpflichtet, ohne indessen selber deren Rolle übernehmen zu können.
Diese Bedingung offener Kommunikation, des würdigen Gesprächs, das den kultivierten Genuß des Gesellungstriebes aller Menschen verschafft, entdeckt Petrarca und verpflichtet sich ihr in viel radikalerer Weise, als es etwa Platon in seinen Dialogen vermochte. Petrarca entdeckt somit wieder, daß das einzelne Subjekt sich nicht aus sich heraus zu bestimmen vermag; was einer ist, erfährt er aus der Bedeutung, die er für andere als Partner hat. Demzufolge kennt Petrarca keine intensiveren Formen der Tätigkeit als die, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Dabei scheint es ihm fast gleichgültig zu sein, ob die Freunde leiblich präsent sind oder in der Ferne weilen bzw. überhaupt nicht mehr leben.
Er führt ausgedehnte Dialoge sogar mit Menschen, die lange vor ihm gelebt haben, die aber durch die von ihnen tradierten Werke und Taten wie unmittelbar gegenwärtige Dialogpartner in Erscheinung treten können.
Er schreibt ihnen Briefe, als erwarte er erst noch ihre Antwort. So entwickelt Petrarca die Gesprächskultur im Freundschaftskult vor allem als Briefschreiber. Erst im 18. Jahrhundert ist in vergleichbarer Intensität in Briefen kommuniziert worden, und ist die Bindung der Partner durch Freundschaft über alle anderen Formen gesellschaftlicher Bindung gestellt worden.
Ein besonderer Aspekt der Gesprächskultur ist für die Entwicklung der Literatur hervorzuheben. Mit ihr ergeben sich nämlich andere Formen und Strukturen des Erzählens, als sie Epik und Historiographie des Mittelalters kannten. Mündlichkeit und Schriftlichkeit des Erzählens gehen eine neue Symbiose ein. Die unter dem Druck des kontinuierlichen Sprechens in der mündlichen Erzählung entstehenden Eigentümlichkeiten, zum Beispiel sprunghafter Wechsel der Zeitformen oder Zwang zur gestischen und mimischen Begleitung der Erzählung durch den Erzähler, werden bei der Umsetzung in Schriftlichkeit als künstlerische Probleme entdeckt. So entsteht die Differenzierung von Ort und Zeit der erzählten Ereignisse und denen der Erzählung als Ereignis. Ihr Mittel ist die Differenzierung des künstlerischen Stils, die Differenzierung der Zeitformen, die Differenzierung von Form und Inhalt, von Konzept und Gestaltung.
Zwar lebte Petrarca noch im Bewußtsein der Vorrangstellung der Literatur gegenüber allen anderen Künsten; aber sein Lob für Giotto (»nostri aevi princeps«) oder das für Simone Martini (»il mio Simon«) belegen, wie deutlich er erkannte, welche Differenzierungsleistungen (im eben skizzierten Sinne) die bildenden Künstler seiner Zeit, im Unterschied zu den Literaten, zu entwickeln imstande waren; und Petrarca versucht, sich dieser Leistung der Maler zu vergewissern, indem er seine Metaphorik, seine Erzählweise und Darstellungsformen in Richtung auf eine Verbildlichung der Wortsprache verändert. Das macht auch verständlich, warum Petrarca selbst die von ihm verwendeten Begriffe nicht im Sinne scholastischer Verfahrensnormen bestimmt, sondern als Bildbegriffe mehrstufig - wie ein Landschaftspanorama - aufbaut.
Tiefe des Gedankens entwickelt er nicht mehr über die Verwendung geheiligter Formeln, er erzielt Tiefe im Sinne des bildlichen Ausdrucks als Erweiterung, ja Entgrenzung des Bildhorizonts, indem er die Übergänge vom Nahbereich über die mittlere Konfrontationsdistanz in die Tiefe des Bildes verschwimmen läßt - er erreicht damit schon fast ein >sfumato< des Begriffs.
Das philosophische und theologische Talent Petrarcas hätte in jedem Fall hingereicht, im Sinne der ihm tradierten Disziplinen Begriffe zu entwickeln und zu gebrauchen. Er hatte die Lehren aus dem Realismusstreit gezogen: Alle Sprachen verdanken sich der Konvention, dennoch aber ist es unendlich mühsam, diese Konventionen zu verändern.
Petrarca bleibt bei der hauptsächlichen Verwendung des Lateinischen, weil die Mehrzahl seiner Adressaten mit diesem Konventionsgefüge vertraut ist, obwohl er durchaus versteht, daß es die Aufgabe der Dichter zu sein hat, die Konvention der Sprache nicht zur Fessel der menschlichen Äußerungsfähigkeit werden zu lassen.
Freundschaft bekundet die Bereitschaft, den Partner auch jenseits der sprachlichen Konventionen verstehen zu wollen und zu können. Das macht die Freundschaft unabdingbar für das Führen eines offenen Dialogs. Dolcezza gewährt er durch das Bewußtsein, selbst da verstanden zu werden, wo die Unzulänglichkeit des eigenen Ausdrucks den Eindruck nahelegt, als habe der Sprechende selbst nicht verstanden, was er sagen will.
Die studia humanitatis, die solche Bedingungen der Kommunikation zu erkennen erlauben, treten damit an die Stelle gemeinsamer Verpflichtung auf die unumstößliche Offenbarung des eindeutigen Sinnes.
Petrarca beteiligt sich deshalb nicht mehr am Kampf um Häresien, um Abweichungen von; dem als verbindlich gesetzten Sinn der Worte, der sich für ihn doch immer erst im offenen Dialog entwickeln kann. Jeder Dialog wird so zu einem Beispiel für das, was Menschen sich zu sagen vermöchten, wenn sie Gesprächskultur hätten - also einander in Freundschaft verbunden wären.
Das war Petrarca mit einer unglaublich großen Zahl von Menschen, auch über seine Lebenszeit hinaus; sie konnten mit ihm den Dialog aufnehmen, wie er ihn mit den Toten geführt hatte - darin liegt wohl auch eine Erklärung für seine fast einmalige Wirkung durch die Jahrhunderte.
Ich hoffe, hinreichend sichtbar gemacht zu haben, wie wir selbst, die Mitglieder der Jury und die Beteiligten an den jährlichen Preisverleihungen, unsererseits den Dialog mit Petrarca wieder aufnehmen könnten.
3. Zukunft als Verwirklichung von Vergangenheit - Gloria und Lorbeer
Eine der folgenschwersten Konsequenzen aus der durch Petrarca entscheidend geförderten Umorientierung von der Theologie zur Anthropologie als Basiswissenschaft ist der Verlust von Zukunft, wie sie die Heilsgeschichte garantierte.
Was heißt dann noch Zukunft, wenn sie nicht mehr als Erfüllung eines vorgegebenen Plans der Heilsgeschichte bestimmt werden kann? Eine offene Zukunft als das schlechthin Andere, völlig Unerwartbare wagte noch niemand zu denken; es ist ja bis heute die Frage, ob damit überhaupt etwas gedacht wird. In seiner Neubestimmung der Zukunft ist Petrarca tatsächlich der Inaugurator der Renaissance; Renaissance aber nicht als Wiedergeburt oder Auferstehung der Antike verstanden, sondern als deren Verwirklichung.
Der Historiograph Petrarca war weit davon entfernt, ein Historiker im heutigen Sinne zu sein, und das nicht, weil er unfähig gewesen wäre, etwa dem Beispiel der arabischen Historiker der Stauferzeit zu folgen, sondern weil für ihn die Geschichtsschreibung im Sinne seines Verständnisses von der Verwirklichung der Antike eine völlig andere Funktion zu erfüllen hatte. So sind etwa seine Darstellungen des Lebens berühmter Männer nicht als Arbeiten eines Historikers zu verstehen, sondern als die eines Zoographos, das heißt eines lebenschaffenden Künstlers. Für die Zeitgenossen lag darin, vor allem unter Berücksichtigung der damals tausendjährigen theologischen Debatten um die Einmaligkeit der Schöpferkraft des dreieinigen Gottes, eine ungeheure Zumutung, die selbst hundert Jahre später noch nicht ohne weiteres hingenommen werden konnte, als einer der führenden Renaissance-Künstler, Pisanello, sich selbst als Zoographos bezeichnete.
Petrarca wollte sich nicht darauf beschränken, die antiken Gestalten im Leben ihrer Zeit lebendig zu vergegenwärtigen; er glaubte, sie als seine Zeitgenossen zum Leben erwecken zu können. Dabei mußten ganz selbstverständlich diese antiken Gestalten Wesenszüge und Erscheinungsmerkmale annehmen, die mit ihrem historischen Leben nicht viel gemein hatten. Sie erstanden nicht wieder, sie wurden nicht wiedergeboren, sondern sie wurden als solche lebendig, die sie in ihrer Zeit nicht hatten sein können, wozu sie aber geworden wären, wenn sie im Zeitalter Petrarcas zu leben gehabt hätten. Anders gesagt: Die antiken Gestalten verwirklichten sich erst in der Zukunft ihrer eigenen Geschichte. Und als solche Zukunft der Antike verstand Petrarca sein eigenes Zeitalter.
Ein Aspekt dieses Gedankens war bereits in der Antike deutlich verstanden worden und entwickelte sich zum entscheidenden Handlungsantrieb: die Gewißheit, daß Menschen unsterblich sind, also eine prinzipiell unbeschränkbare Zukunft haben, wenn sie um ihrer Taten willen im Gedächtnis der Nachgeborenen lebendig blieben.
Ruhmsucht war das kräftigste Handlungsmotiv des antiken Menschen, weil Ruhm zu erwerben bedeutete, unsterblich zu werden. Es lag an den jeweils Lebenden, sich selbst die Unsterblichkeit zu garantieren, indem sie in täglicher Übung ihrer Erinnerung die heroischen Vorfahren immer noch gegenwärtig und lebendig hielten.
Wer diese Unsterblichkeitsgarantie kraft eigener Erinnerung an die Vorfahren einlöste, konnte damit hoffen, daß auch seine Nachfahren ihm selbst Unsterblichkeit gewähren würden.
In diesem Sinne will Petrarca mit seinen zoographischen Arbeiten zur Geschichte der antiken Gestalten ein Beispiel geben, von dem er hoffen darf, daß die ihm Nachlebenden im gleichen Sinne Petrarca selber Unsterblichkeit gewähren würden und seine Hoffnungen haben ihn ja nicht getrogen. Auch dieser Aspekt des Umgangs mit Geschichte war in der Antike bekannt: Der Dichter wird in dem Maße Ruhm erwerben, in dem er es versteht, den Ruhm seines Heros zu begründen und lebendig zu halten.
Was also ist Zukunft ohne heilsgeschichtliche Gewißheit? Sie wird erzwungen, wenn es gelingt, Geschichte als Dimension der Gegenwart zu erhalten. Die Zukunft jeder Gegenwart besteht in der immer weitergehenden Verwirklichung der Geschichte als Gegenwart. Dabei wird aber nicht nur Vergangenes im Gegenwärtigen wieder zum Leben erweckt, es werden vor allem aus dem Potential der Wahrnehmungen, Vorstellungen und Handlungsmöglichkeiten der Vergangenheit jene in der Gegenwart verwirklicht, die in der Vergangenheit selbst sich nicht hatten durchsetzen und verwirklichen lassen. Das unterscheidet Petrarca von späteren historizistischen Auffassungen, die ihre jeweilige Gegenwart nur mit den Versatzstücken der Vergangenheit möblierten, ja, eigentlich derart verbauten, daß Geschichte ganz dimensionslos wurde.
Welchen Bedeutungszuwachs erfahren vor diesem Verständnis der Zukunft Petrarcas Handlungen und Haltungen! In den ihm teuersten Vergil-Codex schreibt er die Namen seiner Freunde, die der Pest erlagen - er memorierte sie bei jedem Lesen in dem Codex.
Seine Triumphzüge, ein Petrarcascher Topos mit großer Wirkungsgeschichte, werden, als ein tatsächliches Triumphieren über die zeitliche Bedingtheit menschlichen Lebens und allen Tuns, zu weitaus mehr als bloßen Allegorien. Sie sind Prospekte der Zukunft, ja, Handlungsanleitungen dafür, wie sich eine Gesellschaft Zukunft sichern kann. Und seine historischen Epen, vor allem das große Epos >AfricaPerspektive