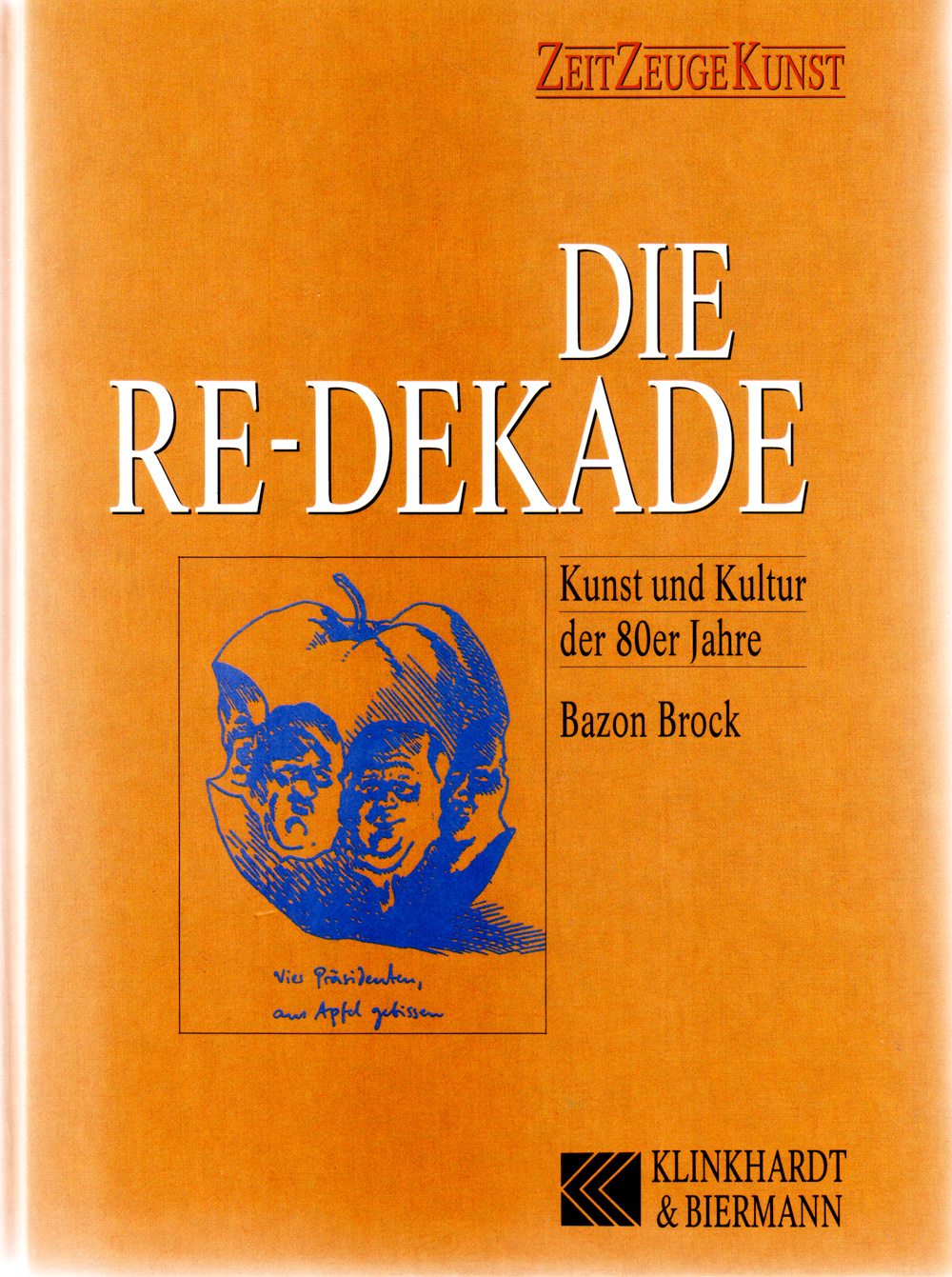a. Wer zahlt, braucht keine Argumente
Nach dem Börsenkrach vom Oktober 1987 erwarteten alle Auguren, auch wenn sie sich das tapfer nicht eingestehen wollten, den Zusammenbruch des Kunstmarktes. Die Vorhersagen konnten nicht auf ihre Stichhaltigkeit überprüft werden; bis der Kunstmarkt hätte reagieren können, erholten sich die Börsen durch finanzpolitische Interventionen.
Es läßt sich auch vermuten, daß der Kunstmarkt ein nie erwartetes Preisniveau erreichte, gerade weil die Aktien wackelten, in die, zumal in Deutschland, ja nur ein kleiner Teil des zur Verfügung stehenden Kapitals investiert wird. Sind Kunstwerke also nicht mehr Aktien an der Wand, sondern Alternativen zu Aktien, weil die Gesetze des Kunstmarktes eben doch andere sind als die der Börse? Das wohl nicht, aber die Kunstwerke sind andere Werte, als sie durch Aktien repräsentiert werden. Genau diese andere Werthaftigkeit und Bedeutung der Kunstwerke wird durch die enormen Preissteigerungen mehr gefährdet als durch einen möglichen Verfall der Preise für Kunstwerke.
Denn die Werke bildender Kunst verlieren durch die bisher unverstellbaren Preissteigerungen den Zusammenhang zu den anderen Bereichen intelligenter und kreativer Arbeit von Menschen. Ein Nobelpreis bringt heute rund DM 500.000, eine Summe, die mit frühen Arbeiten von Baselitz, Polke, Richter und erst recht mit denen Kiefers umstandslos erreicht wird. Mit dem Abwerbungsgehalt erstrangiger Wissenschaftler in Höhe von DM 250.000 brutto nehmen es einige hundert Werke zeitgenössischer Künstler aus den USA, aus Italien und der Bundesrepublik auf; desgleichen mit den Aufführungsgagen umjubelter Heldentenöre und Instrumentalsolisten; von den Entschädigungen für erstrangige Arbeit in den anderen Kunstsparten ganz zu schweigen. Die Entwicklung auf dem Kunstmarkt ist allenfalls noch mit der im Spitzenshowgeschäft vergleichbar, ein bedenklicher Maßstab.
An dieser Entwicklung, von der nur wenige vermuten, daß sie schnell abbrechen könnte, ist folgendes bedenkenswert: Der öffentliche Diskurs, der unter Beteiligung von Kunsthistorikern, Museumsdirektoren, Journalisten, Kulturtheoretikern, Ästhetikern, Galeristen und des Publikums über die Kunst geführt wird, trocknet aus. Die bemühten und anspruchsvollen Schreiber, die die Themen des Diskurses entwickeln, verfallen in Lethargie. Sie werden mit ein paar hundert Mark Honorar für Arbeiten über Kunstwerke abgespeist, die nicht zuletzt durchs Schreiben und Reden (als einzelne Werke) mehr einbringen, als das Jahresgehalt der Schreiber ausmacht. Man macht sich ja mit dem Geschreibe geradezu lächerlich vor den zahllosen Käufern der Werke, die mit dem Preis das Recht erwerben, jede Debatte um künstlerische Qualität und Position der Werke zu beenden.
Die Museumsdirektoren und Kuratoren können mit ihren Ankaufsetats eben noch ein paar museumsungeeignete Kleinformate von Künstlern des oberen Drittels erwerben. Die Sammlungen magern ab; Versicherungs-, Transport- und Leihpreise verhindern, daß qualitäts- und positionskritische Ausstellungen zustandekommen. Die öffentlichen Sammlungen sind auf Privatsammler angewiesen, das heißt, die Entscheidungskompetenz wird abgetreten; die Museen werden umfunktioniert zu Tresoren, in denen Privatbesitz verwaltet, bewahrt und möglichst glanzvoll präsentiert wird.
Die jungen Künstler starren verständlicherweise fasziniert auf die Marktentwicklung, um sich werkstrategisch auf sie einzustellen. Das muß schiefgehen, weil ein Künstler wenigstens 10 Jahre braucht, um einen halbwegs diskussionswürdigen Ansatz zu entwickeln. Diese Zeit kann sich der nicht mehr gewähren, dessen Absicht darauf gerichtet ist, im Kunstmarkt mitzuspielen, anstatt an dem öffentlichen Kunstdiskurs mit eigenständigen Behauptungen teilzunehmen.
Alle Bemühungen, einen Teil der erzielten Preissteigerungen in die künstlerische Arbeit zurückzuleiten und das Geld auf diese Weise produktiv zu verwenden, sind gescheitert. Sinnvolle Auftragsarbeiten werden von privaten Sammlern nicht erteilt. Die öffentliche Förderung der Kulturarbeit von Einzelnen und von Institutionen geht zurück, weil ja mit der Preisentwicklung bewiesen zu sein scheint, daß für die Künste genügend Geld zur Verfügung steht. Aber der Markt tut für die Entwicklung der Künste gar nichts, weshalb man sich nicht zu wundern braucht, daß in der Kunstszene gerade in jenen Zeiten wenig Produktives geschieht, in denen der Kunstmarkt explodiert. Je höher die Preise sind, desto abgesicherter müssen die Werke sein; je höher die Preise, desto weniger kann man sich also für ungesicherte Neuheiten interessieren. Das gilt vor allem auch für Sponsoren, die größere Beträge nur für Ausstellungen stiften, die nach bewährtem Muster Erfolg versprechen. Sponsorship baut auf Überbietungsstrategien, d. h. mehr des Gleichen mit mehr Aufmerksamkeit und möglichst überall. Fazit? Auch der Kunstmarkt bestätigt die Logik aller Märkte ungezügelter Raubtierökonomie: durch Erfolg zerstört.
b. Die nackten Formen – oder Pornographie
Als die Emma-Mannschaft 1987 die Pornographiedebatte eröffnete, glaubten alle, sich gähnend zurücklehnen zu dürfen. Was hätte man schon erwarten können von den an den Haaren herbeigezogenen klapperdürren Argumenten für und wider die Pornographie? Schade, daß so wenige Künstler geruhten, sich auf grundsätzliche Fragestellungen einzulassen, Künstler, die über Jahrhunderte das Monopol auf die Darstellung der nackten Tatsachen besaßen.
Auf pornographische Bilder scheinen alle Menschen mit starken Affekten so oder so zu reagieren. Ist es nicht das Ziel aller bildenden Künstler, eine so intensive Reaktion auf Bilder zu erreichen? Sollten nicht gerade deswegen die Maler, Bildhauer und Grafiker die Frage ernstnehmen, was eigentlich die Wirkung von Bildern ermöglicht, und wo sollte man das besser studieren als an der Wirkung der nackten Form in Aktion? Der Schutz der Kunst durch das Grundgesetz hat die Künstler eingeschläfert. Sie sehen sich nicht mehr genötigt, ihre Werke auf die Wirkungen zu befragen, die sie bei anderen hervorrufen. Sie tun so, als seien alle ihre Betrachter ihrerseits Künstler, die nur wissen wollten, wie die Arbeiten denn „gemacht“ seien, unabhängig von der Wirkung, die sie erzielen. Aber die Mehrzahl der Betrachter geht mit den Kunstwerken wie mit der Pornographie um. Die Wirkung ist entscheidend, nicht die Bildkunst.
Wer sich Pornographie ansieht, will stimuliert werden – aber wo? Die herkömmliche Behauptung heißt: am eigenen Leib und an allen Gliedern. Gerade das bestreitet man nun mit gutem Grund. Stimuliert wird der Kopf, beflügelt wird die Phantasie, Lust erregen die Vorstellungen und Gedanken, nicht die Vorder- und Hinterteile, an denen sich allerdings die Phantasie erst entzündet. Entscheidend bleibt die Frage, wie diese Phantasien auf das Verhalten und Tun der Betrachter zurückwirken. Wer die Bildvorlagen direkt als Handlungsanleitungen benutzt, wird zu keinen Phantasien oder gar spekulativen Gedanken mehr fähig sein: er wird in zwanghafte Abhängigkeit zu den Bildvorlagen geraten; er wird auf ein paar Auslöserreize festgenagelt und auch dann schließlich abstumpfen, wenn er eine gewisse Zeit lang zu immer stärkeren Reizen greift. So sehr auch alle Lust ewige Wiederholung anstrebt, diese Wiederholung wird durch Abstumpfung der Kraft zur phantastischen Spekulation immer weniger möglich. Das ist die einzige nachgewiesene, allerdings extrem schädliche Wirkung umstandsloser, nicht über den Kopf vermittelter Bilder, ganz gleich, ob sie Künstlerateliers oder den Studios von Pornoproduzenten entstammen. Scheuten die Künstler die Pornographiedebatte, weil sie die Köpfe fürchten und lieber auf die Bäuche setzen? Es wird uns ja ständig empfohlen, auf Kunstwerke mit dem angeblich so sinnlichen Bauch zu reagieren. Die Empfehlung zur sinnlichen Unmittelbarkeit ist ein Schmarren. Wer den Gedanken, den Vorstellungen nichts zu bieten hat, bietet gar nichts, vor allem keine Sinnlichkeit.
Da uns die Arbeit der Geschichte lehrt, daß selbst die besten Argumente keine Argumente sind, will sagen, daß kaum jemand sein Urteil an der Überzeugungskraft der Argumente ausrichtet, sondern die Größe seines Willens und die Macht seines Geistes durch kontrafaktische Behauptungen zu erweisen versucht, wird noch lange die Pornographie als Kunst gegen die Kunst der Pornographie ausgespielt werden.
c. Quotenfrauen – am besten halbe halbe?
Kein Zweifel, den Geschlechterunterschied gibt es. Kein Zweifel aber auch, daß Verhalten und Handeln der Menschen nicht in erster Linie durch die körperliche Geschlechtsbestimmung beherrscht wird. Die Quotierungsforderung behauptet gerade das und bleibt ein sinnloses Abzählspiel. Der Geschlechterunterschied ist bloß einer unter vielen Faktoren. Alter ist ein anderer Faktor, auch Zugehörigkeit zu Kulturgemeinschaften, sozialer Rang und Status, Begabung und Befähigung. Wenn man fordert, daß die Hälfte der an der „documenta“ teilnehmenden Künstler Frauen zu sein haben, müßte man dann nicht die Teilnehmer auch danach auswählen, ob Künstler aller Altersklassen, aller Begabungs- und Ausbildungsformen, aller Schichten- und Kulturzugehörigkeit angemessen vertreten sind? Eine groteske Forderung, ebenso grotesk wie die Quotenkünstlerin.
Im übrigen dürfte sich aufs Ganze zeigen lassen, was im einzelnen schon errechnet wurde. So hat zum Beispiel die Bergische Universität Wuppertal im Hinblick auf die eingegangenen Stellenbewerbungen prozentual zumindest nicht weniger Frauen als Männer berufen. Wenn man für die Berufung von Ausstellungsteilnehmern die Gesamtzahl der Kunstprofimänner und Kunstprofifrauen zugrundelegt, dürfte der Anteil der etwa für die „documenta“ ausgewählten Frauen nicht, wie immer behauptet, bei bloß 7% liegen, sondern bei etwa 40%. Das ist zu untersuchen! Aber was immer dabei herauskommt, wird die Quotenforderung nicht viel sinnvoller erscheinen lassen. Daß gleich viele Männer und Frauen die Kunsthochschulen bevölkern, besagt gar nichts; denn man wird ja nicht durch Studienabschluß zu einem Künstler, der etwas zu sagen hat. Die Quotenfrauen werden sich zu Künstlerinnen zweiter, weil geschlechtswillkürlicher Wahl herabwürdigen.