In: Eckhard Siepmann: Cheschahshit. Die Sechziger Jahre zwischen Cocktail und Molotow. Berlin 1984.
Wegwerfen auf Kredit
Hopp war der aus „Ex und Hopp“, der halb burschikosen, halb martialischen Typisierung unseres Verbraucherverhaltens; Teilnehmer an den Verkaufsschlachten. Er hatte als Hoppla die 20er Jahre mitgemacht! Jenny Lenya artikulierte „Hoppla“, wenn die Lebewelt der Dekadenz sich an ihrem eigenen Ende berauschte. In ihrer Kindheit hatten die Herrschaften noch Hoppe-Hoppe auf Papas befracktem Knie gemacht – so lernten sie frühzeitig, wie schön lustvoll der Schrei der Fallenden sein kann. Dann machte Hopp, der spätere Heros der Wegwerfkultur, ein anderes Training mit, bei dem zumeist gelangweilt und wie selbstverständlich „Ex“ konstatiert wurde, ganz so, wie über Generationen hin der Befehl zum Saufen an Akademiker ausgegeben wurde. Nun trank die Erde, soff die See „Ex“ das Blut der Säufer. Aber dann das strahlende konsumimperative „Ex und Hopp“: auslutschen, abkauen, wegwerfen. Immer raus aus den Bullaugen bei voller Fahrt, rein in den Bach aus allen Fabrikrohren. Ins Badewasser oder gar die Becken der öffentlichen Schwimmhalle zu pinkeln, galt als Ausgeburt des Asozialen.
Gewisse Wörter... durfte man nicht mit der Kneifzange anfassen, sie waren dreckig. Andere wurden erst dreckig durch menschliche Berührung: Vaterland und Heimat! Ex und Hopp. Ich gab damals Flüchtlingsausweise an Westdeutsche aus, damit sie rechtzeitig merken sollten, daß ihnen gerade (mit freilich anderen Methoden) so die Heimat genommen wurde, wie zuvor uns Ostflüchtlingen. Ausgereizt der Grund und Boden auf Kredit und ohne dafür Steuern zahlen zu müssen (das taten ja zwangsweise genügend viele Kleinstverdiener); also Ex und Hopp, raus aus der Wohnung, raus aus der Kasse, ausgesteuert, ausgepowert. Ex und Hopp! Doch Milch macht's – ein kräftigendes halbes Literchen für die Kohlenstaub- und Bleivergifteten, und Hopp mit der Einwegflasche, die im Straßengraben auf einigen zerschlissenen Taschenbüchern landete. Das Buch zum Wegwerfen! Zehn Jahre früher als Bildungsgut für Minderbemittelte eingeführt. Jetzt hatten die Armen endlich auch den Standard wahrer Bildung erreicht, Bücher nämlich nicht zu lesen, sondern vorzuzeigen. Wer mag schon Ex-Bücher vorzeigen, mickrig, vom Gilb entstellt, mit abgefressenen Rändern. Alles halb Angekaute, nicht ganz Gefällige, Angeschubste, Eingedrückte wurde in den Müll gedonnert.
Wegwerfen! Die entscheidendste Veränderung im kulturellen Verhalten der Deutschen während der 60er Jahre. Waren die Schlager der 50er Jahre verständlicherweise noch Hemden aus Kunstfasern, die selbst von Panzerketten (Wochenschaubeispiele) nicht zerstört werden konnten, so galt nun das Hemd als einzig zeitgemäß, das garantiert nur einmal getragen werden konnte. Übrigens ist Papier ja nicht nur geduldig, sondern hat den Vorzug, umstandsloser als jeder andere Stoff beseitigbar zu sein. Man denke: Tageszeitungen aus einem Material, das sich nur schwer zerstören ließe; eine Katastrophe. Es war die Zeit, da der industrielle Fortschritt auf denkwürdige Weise die Konsumpflicht des Bürgers rechtfertigte. Die Güter durften gar nicht lange halten, weil ihr Besitzer oder Gebraucher sonst womöglich jahrelang auf die inzwischen eingeführten Neuerungen verzichten müßte.
Aber schlagend waren andere Argumente, für die Hopp Parade laufen konnte. Man stelle sich den Fortgang der Massenproduktion in erwartbarer Weise noch auf Jahre (exponentiell gesteigert) vor. Und? Die Welt wäre vollgestopft mit Gütern, so daß sich die Frage, wohin mit dem ganzen Zeug, gar nicht mehr stellen ließe, denn wohin immer man das Zeug hätte bringen wollen, dort wäre eben auch schon viel Zeug. Früher schreckten solche Vorstellungen nicht. Zum einen lebte man ja früher in einer Mangelgesellschaft, zum anderen konnte man sich trotz einhundert Jahren Abrüstungskonferenzen und „Nieder mit den Waffen“ darauf verlassen, daß regelmäßig und bedarfsweise Kriege veranstaltet würden, in denen man durch Zerstörung alles loswerden konnte, was einen daran hätte hindern können, so fortzufahren wie bisher.
Freilich wurden ja in den 60er Jahren in anderen Weltgegenden kraftvolle, zerstörungspotente Kriege geführt. Lohnte es sich für uns nicht, unsere überschüssige Konsumproduktion mit Flugzeugen etwa über dem Vietcong abzuwerfen, wie ich das damals vorschlug? Es ist gegen die Vorschrift und deshalb verboten: Keine Gegenstände aus dem Fenster des Zuges werfen, geschweige denn aus Flugzeugen. Im übrigen wäre das ja gerade nicht Krieg gewesen, sondern eben auch bloß „wegwerfen“. Krieg ist, wenn man Dinge benutzt, um andere Dinge zu zerstören. Das ist ein Opfer! Frieden ist, wenn man Dinge verbraucht, indem man sie wegwirft. Das ist Freiheit! Aber wehe dem, der zum Beispiel weggeworfene Altbauten aufhebt. Das ist gesellschaftsschädlich, unhygienisch, freiheitsfeindlich. Da wird Konsum zum Krieg mit der Pflicht zum Opfer, also zum Zerstören.
Beseitigen und Platz schaffen. Volk ohne Raum sind Konsumenten ohne leere Stellflächen. Da wußten selbst die keinen Rat mehr, die aus dem Generalstab nahtlos in die „Stäbe“ der Firmen überwechselten, um dort nun Marktstrategien zu entwerfen. Sie hatten in den Sechzigern ihre Erfolgsorgasmen. Doch der geplante Verschleiß war alles, was ihnen einfiel. Mir fiel mehr ein. Ich empfahl zum Beispiel, auf dem Hinterhof von Kempinski, Berlin-West, Wegwerfübungen zu trainieren – aber als Gymnastik gegen das Habenwollen. (1) Das war meine Strategie, die der affirmativen Praxis: den Feind kann man nur mit seinen eigenen Waffen schlagen. Gegen Paragraph 218 hilft nur massenhafte Selbstanzeige, gegen Naschhaftigkeit nur Schokoladefressen bis man kotzt, gegen schlechte Arbeitsbedingungen hilft nur Dienst nach Vorschrift. Eulenspiegel, Nietzsche, Schweyk – lange her und immer falsch verstanden. Wir Popartisten, Happenisten, Action-teacher verstanden das nur allzugut. Blieben aber Hofnarren des Kapitalismus, Clowns, willfährige Werkzeuge in der Hand des Klassenfeindes, während die Herren Linksschwenkmarsch sich von eben den Kapitalisten einen Kulturpreis nach dem anderen abholten. Sie übten nur wegwerfende Handbewegungen, nachdem sie kräftig eingesackt hatten, diese selbstgefälligen Mafiosi des untergründigen Fortschritts in der Geschichte.
Aber es gab noch eine weitere schlagwörtliche Rechtfertigung für die hohe kulturelle Wertigkeit, die in den 60er Jahren dem Wegwerfen zuwuchs. Nicht nur Wegwerfen als Immunisierung gegen das Raffen, sondern gegen das Behalten. Die 50er Jahre über hatte man ja alles auf altväterliche Weise behalten, was einem tausend Jahre lang hoch und heilig gewesen war. „Es darf nichts weggeworfen werden“, sagte die alte Tante aus dem BDM und wandte ihre Untermenschenkenntnisse nun wieder staatsschützend gegenüber Kommunisten an. Es wäre ja nicht nur unmenschlich gewesen, auf die Mitarbeit der Generation von Globke und Co. zu verzichten, zumal die alle nur ihre Pflicht getan hatten. Vor allem wäre das Vergeudung gewesen. Nun, in den Sechzigern, konnte man sich langsam mehr und mehr Verzicht und Vergeudung leisten, man traute sich schon mal, alte Auffassungen von der deutschen Einheit, vom Deutschen Reich, von Bismarck als Gottgesalbtem und Hitler als Auserwähltem wegzuwerfen. Zu reparieren war da eh nichts mehr; eine neue Einheit wäre in jedem Falle billiger und besser geworden als die alte.
Auch das ein Verfahren der Marktwirtschaft, die freimacht: Der Neukauf eines Gutes muß billiger sein als die Reparatur, damit man neukauft. Schließlich ging man auch in der Chirurgie damals dazu über, nicht mehr hier zu schnippeln und da zu kleckern; Totalausräumung im Unterleib wie im Oberstübchen. Jawohl, auch bei den Ideologien, den Theorien, den Heilsempfehlungen und den Wahrheitsbeweisen. Positivismusstreit und Dialektik der Aufklärung – es konnte da keine Sieger geben! Wie schon der Münzkopf Max Planck festgestellt hatte, können echte Wissenschaftler nicht durch bessere Argumente zur Aufgabe ihrer Theorien veranlaßt werden. Nur weil sie ihre Wahrheiten mit ins Grab nehmen, hört der alte Unsinn zugunsten des neuen auf.
Nun, in den Sechzigern, erklären sich zum ersten Mal gestandene Wissenschaftler bereit, ihre Überzeugungen aus Pflichtgefühl zu wechseln! Gehorsam gegenüber dem Fortschritt: Öfter mal was Neues, nicht immer nur neue Waffen erdenken, auch mal dran denken, wie man auf neuem Wege mehr Geld beschafft. Nur die Militärforschung garantierte so recht die Freiheit der Wissenschaft, sie erhielt unbürokratisch und unkonventionell viel freies Geld. Wo Absatzschlachten geschlagen werden, bringt Konsumforschung möglicherweise auch Geld, sogar doppelt, wenn man die Kritik an diesem Konzept auch gleich als Warenästhetik mitliefert. Der Kunde weiß dann, daß die Wissenschaftler wirklich an alles und auch ans Gegenteil denken. Also – und das ist wirklich vergessen worden, Prof. Erhard war ja Wissenschaftler – schuf man die Glaubensvoraussetzungen für eine völlig neue Auffassung von Kredit.
Die alle anderen Tendenzen dominierende Wegwerfverpflichtung aus Konsumgehorsam mußte schließlich finanziert werden. Daß man Geld nicht einfach zum Fenster rauswerfen darf, braucht man niemandem zu sagen, der es verdienen muß. Aber der, welcher Kredit hat, kauft gerne all das, was ohnehin nur wert ist, rasch weggeworfen zu werden. Angst vor Armut essen Seele auf – Kredit essen bloß Zukunft, und davon hatte man ja eine Menge. Denn die Zukunft ließ sich ja machen. Zukunft konnte man herstellen in beliebigen Dimensionen. Die Zukunft bot sich unmittelbar in den Kaufhäusern an, auch das als Angebot an die dafür kaufkräftig gemachten Massen, eine alles bewegende Neuerung der 60er Jahre: Wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Kreditbüro, günstigste Teilzahlungsbedingungen für jedermann, ohne Bürgschaft, Verdienstbescheinigung genügt. Die Finanzierungskosten trugen die Rohstoffproduzenten der dritten Welt, na also! Man war nicht undankbar, denn bei jeder sich bietenden Gelegenheit wurde dazu aufgefordert, doch auch der armen Menschen in der dritten Welt zu gedenken: Die Armen, sie leben hoch, hoch, hoch! Und dann wurde getwistet. Und mit den Goldklunkern gerasselt, wie Beatle Paul das seinen Zuhörerinnen empfahl.
Op und Pop am Leib und in der Bude
Sex und Hopp – kam die Pille eigentlich vor dem Minirock oder umgekehrt? „Die wirft sich selbst weg“, hieß die Standardbezichtigung für kaiserlich-republikanische Kleinbürgermädchen. Unter A. H. galt das nur noch für Judenliebchen. „Ich bin am Ort das größte Schwein und laß mich nur mit Juden ein“, höhnten die abgeblitzten Laufkunden, die nichts gegen lockende Liebschaft hatten – aber diese Rassenschande! Mit der Pille wurde alles anders. Wer die Zeit des Übergangs vom Terror des Wenn-Falles zum wohlig verantwortungsfreien „Wie es Euch gefällt“ nicht miterlebt hat, kann sich nicht einmal annähernd vorstellen, was die Einführung der Pille bedeutete. Auch die heutigen Pillenverächter können sich das nicht vorstellen, weil es damals keinerlei (außer der kriminalisierten) Gelegenheit zum Schwangerschaftsabbruch gegeben hat. Ganz davon zu schweigen, daß sich die Liebestechniken und ihr Genuß fundamental veränderten.
Es gab nur eine Einschränkung, nämlich die penetrant vorgetragene Meinung, daß Freizügigkeit schnell die Sinne abstumpfe. Dagegen konnte dann nur die Erhöhung der Reize helfen: totale Beinfreiheit im Minirock. Die Gezeiten des Rocksaumes waren immer schon in Beziehung auf die Veränderungen der Moral und des Einkommens, der Aggressionspotentiale und der Gesundheitsvorstellungen gesehen und gewertet worden. Aber stets waren die gesellschaftlich führenden Schichten auch in diesen Fragen tonangebend gewesen. Mit Mary Quant setzte zum ersten Mal die Unterschicht ihre Modevorstellungen gegenüber den ansonsten immer noch aristokratisch verbrämten und distanzierten Oberschichten der westlichen Welt durch.
Das englische Ladenmädchen aus den Industrievorstädten als Modekönigin – das war doch wohl nur möglich, weil die Entscheidung für den Minirock endlich sanktionierte, was den höheren Herren so gut wie den Kumpels immer schon Ausdruck jeder modischen Masche gewesen ist. Nämlich Erhöhung der Attraktivität, das heißt der Anziehungskraft der Frauen. Am anziehendsten war seit Großvaters Zeiten jene handbreite, nacktfleischige Zone zwischen Strumpfband und Höschenansatz, die nach Einführung des Strumpfhalters von den legendären Strapsen jeweils paarig überbrückt wurde. Der Strapsenapparat, obwohl seinerzeit – vor siebzig Jahren – als Gesundheitsreformwäsche eingeführt, hinderte in der Freiheit jener Bewegungen, die der Mini gewähren sollte. Außerdem irritierte der unverstellte Dauereinblick in Vorhof und Arkanum der Miniträgerinnen. Ohne wenigstens teilweise Verhüllung kein Enthüllungseffekt! So fand dann eine eigentlich typische Schreibtischkonstruktion der Strumpfwirker sofort reißenden Absatz: die Strumpfhose.
Der Strumpfhalter schien damit so gut wie erledigt – leider auch jene Reizzone an den Oberschenkelhälsen. Aber dieser Verlust konnte vielleicht dadurch aufgefangen werden, daß man ein interessant gestaltetes Sichthöschen (neue Umsatzquelle zudem) über die Strumpfhose zog. Das ging nicht ganz so problemlos, sonst hätte es ja wohl damals nicht die ausdauernde Erörterung der Frage gegeben, ob man nun gegen alle hygienischen Argumente und gegen medizinische wie auch gegen Argumente des Wohlbefindens die Strumpfhose tatsächlich unter dem Höschen tragen dürfe oder ob nicht vielmehr etc. …
Diese gewichtigen Probleme wurden damals nicht nur in Frauenzeitschriften abgehandelt; ich selbst durfte im Feuilleton der ZEIT mich ausführlich ins Unterzeug legen. Auch bildeten sich damals die ersten Clubs gegen die Wegrationalisierung der Strapse. Dieser Widerstandsbewegung gehören ja heute sogar junge Leute an, die aus Jahrgangsgründen dem Straps nicht einfach bloß nostalgisch verbunden sein können. Eine euro-anthropologische Konstante, auf welcher schon der Strumpfbandorden und das Strumpfband als Unterpfand der Liebe basierten? Die Frage, ob der Mini die Pille erzwang oder die Pille den Mini ermöglichte, muß also suspendiert werden: Zumindest wirkte die Strumpfhose stark reizmindernd, ja desillusionierend – welcher Effekt offenbar auch durch die Überführung des Sichthöschens vom Tennisplatz ins Büro nicht ausgeglichen werden konnte.
Ins Umfeld des Problems gehörten in den Sechzigern die Dauerthemen Pille und Krebs, Pille für den Mann, die Pille und der Partnertausch, die Pille und das Ende der gewerbsmäßigen Prostitution, die Pille und die Freigabe der Pornografie. (Bevor es soweit war, bevor man also die sozialhygienische Funktion der Pornografie insofern anerkannte und die Pornografie nach skandinavischem Vorbild freigab, vermochten die monatlichen Ausklappseiten des Playboy manche sonst vielleicht kriminell ausagierten Energien zu dämpfen.) Langsam, langsam wagten es die Kioskbesitzer, ihrer Umsatzerwartung durch entsprechende Platzierung der Magazine im öffentlichen Sichtfeld nachzuhelfen.
Zwar hielt sich auch der Playboy noch über weite Strecken an die Vermutung, daß nackte Mädchen erst durch Künstlerhand wahrhaft ansehenswert werden. Vargas, der exklusiv bei Playboy unter Vertrag stand, war natürlich ein erstrangiger Zeichner, der auf einige Popmaler auch entsprechenden Einfluß hatte. Auch übten die ersten Nacktfotografen ihre künstlerische Freiheit ganz in der Tradition der Aktmalerei aus. Aber mit dem Aufkommen der billigen Farbfilme und Kameras verloren die Künstler das Monopol auf die Darstellung des nackten Körpers. Millionen Knipser zeigten sich und ihren Lieben wechselseitig, was das Objektiv von ihnen scharf mitbekommen hatte. Da bedurfte es der Künstler nicht mehr – erstens war die ständige Rechtfertigung aufreizender Darstellungen durch den Kunstvorbehalt nicht mehr nötig, zweitens ermöglichte das Objektiv An- und Einsichten der Leiber, die dem glänzendsten Künstlerauge unzugänglich blieben. Aber das ist ein Kapitel für sich.
Die Künstler vermochten einen Teil ihrer Privilegien nur noch als Comiczeichner zu retten, natürlich mehr oder weniger weicher Pornocomics. Mitte der Sechziger feierte dieses Genre einen ersten Höhepunkt mit Guy Peellaert/Pierre Bartier. „Die Abenteuer der Jodelle“: Nackt und bloß und mit allem Drum und Dran kämpft das zeitlose Großstadtmädchen Jodelle gegen die Usurpatoren der Macht des Weibes und gegen die Vorherrschaft der Waffen der Männlichkeit. Wie die zur gleichen Zeit sich rasant durchsetzenden Asterixcomics sind auch die Jodelle-Abenteuer überdeutlich auf die Analogie zwischen römischer und amerikanischer Weltmachtgier ausgerichtet. lm Kino trat Jodelle als Barbarella auf; erfolgreich dargestellt von Jane Fonda, die später eine der bekanntesten Antivietnamkämpferinnen Amerikas wird. Die Kostüme der Barbarella schienen alle von der Kunststoffindustrie aus Werbegründen gestiftet worden zu sein: Nackte Brüste oder Hintern, aber gerahmt von Klarsichtfolie, unter der die Fonda selbst in heftigster Bewegung nicht zu schwitzen schien. Kunststoffkleidung, Plastikplastiken auf lebenden Ständern! Ausdruck der Keimfreiheit und Sterilität wie Sex im Operationssaal? Oder eine zeitgemäße Form des Schleiers, den Cranach seinen Nackten aufhauchte? Der durchsichtige Regenschirm war aber akzeptabel, weil sinnvoll – weniger Karambolagen auf Trottoirs.
Eine wirklich philosophische Durchdringung des neuen Materials gelang erst Rudi Gernreich, dem Pariser aus Wien. Er kreierte den NOBRA, den Nichtbüstenhalter. (2) Die Dialektik von Verhüllen und Aufreizen – das Spiel um Durchsichtigkeit und Verschleierung – machte er sinnvoll mit seinem Büstenhalter, der zwar seiner Funktion nach einer ist, aber nicht wie einer aussieht. Sein BH ist hauchdünn und fast unsichtbar vor Durchsichtigkeit. Und er formt doch, aber nur als Unterstützung der natürlichen Brustformen. Aus der Position von Omas Massiv-BH und deren Negation im Oben-ohne, vorgetragen von vielen Emanzipierten, denen der BH als eine vom Manne verordnete Zwangsjacke vorkam, entbarg Gernreich mit seinem NOBRA die Negation: zwar BH, aber dennoch nackt. These: BH ist aus ästhetischen und medizinischen Gründen geboten; Antithese: BH ist abzulehnen, weil er entscheidend dazu beiträgt, die Frau zum Sexobjekt zu formen; Synthese: NOBRA unterstützt die natürlichen Formen und hindert dennoch den Blickkontakt und die Bewegung kaum. Natürlich blieb das nicht der einzige Rückgriff auf den jungen Marx in den 60er Jahren.
Unsicher ist bis heute, ob Gernreich zu Recht auch die Erfindung des Körperstrumpfs zugesprochen wird: sozusagen eines Büstenhalters für den ganzen Leib oder eines Strumpfes vom Zeh bis zum Hals. Er hat sich jedenfalls, das ist sicher, nicht durchgesetzt. Ganz anders versuchten Paco Rabanne und Courrèges zwischen Nacktheit und Bekleidung zu vermitteln, also dem Problem neue Facetten abzugewinnen, wie man sich anzieht, um ausgezogen zu werden. Die tektonische Lösung, Kleider aus Metallplättchen wie Häuser zu bauen, deren Türen und Fenster sich bequem öffnen und schließen lassen, wollte nicht recht überzeugen. Auch die Einarbeitung von vielen Lüftungs- beziehungsweise Sichtschlitzen zeigte nur sinnenfällende Resultate, wenn die Trägerin ziemlich stark nach vorne gebeugt stand oder ging, was schließlich nicht über längere Zeit möglich war. Immerhin verwandelten die Entwürfe von Courrèges und Rabanne die Angezogenen in Gestalten der Zukunft. Science-fiction-Attitüden zeichnen sie aus; denn nüchterne Geometrisierung oder apparative Strenge verliehen der Frau eine Distanziertheit, die auch als Unabhängigkeit vom Zugriff männlichen Begehrens interpretiert werden konnte.
Manchem erschienen die Courrègesfrauen eher den Gedanken an das Ein- und Ausschalten von Apparaten nahezulegen. In jedem Fall: Selbst die Kleider mit Avantgardeanspruch waren vergleichsweise billig und wurden (leider) nur allzu schnell weggeworfen. Die Meister in der Nachfolge Diors kämpften recht angestrengt dagegen an, daß sich in den Sechzigern langsam das eine Modezentrum der Welt – Paris – in viele Zentren zerlegte: Tokio, London, New York, Florenz, Mailand, Rom, Berlin. Sie rangen sich dazu durch, die Entwürfe der Haute Couture auch den Fabrikanten von Massenkonfektion zu verkaufen. Die gleichen Exklusivmodelle würden, selbst in Millionenauflagen über die ganze Welt verstreut, nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit sich nur höchst selten an einem Ort begegnen – und die Angst davor war ja schließlich der einzige Grund für den Kauf von Haute-Couture-Modellen; andere Gründe gab es nicht mehr, nachdem es möglich geworden war, rationell und doch identisch Schnitt und Verarbeitung praktisch unbeschränkt zu kopieren. Einen Weg schritten die Boutiquen, die in kürzester Zeit der bestexpandierende Geschäftstypus wurden.
Die Mode wird – durch ihre Auffälligkeit dafür prädestiniert – in den 60ern von allen Konsum- und Kulturkritikern heftig angenommen. Sie bleibt skandalträchtig, weil sie sich jeder Art von Vorhersage entzieht, ganz gleich, ob man sich für die Vorhersage auf den Bauch der Kundenkenner oder auf die ausgetüfteltsten wissenschaftlichen Methoden beruft. Die tatsächlichen Entwicklungen der zumeist kurzfristigen Trends bleiben ein reines Rätsel und damit ein Dorn im Auge der Kapitalisten (auch Millioneneinsatz für Werbung kann eine gewünschte Mode nicht lancieren) wie der Kapitalismuskritiker (Geld und Marktmacht scheinen doch nicht unbeschränkt: die Vitalitätsreserven des Systems kommen aus Eigentümlichkeiten des sozialen Verhaltens, die man weder als viehische Dummheit noch als Gehirnwäsche abtun kann). Das emanzipatorische Potential von Mode und Massenkonsum ist eben doch sehr viel höher zu veranschlagen als die nicht ganz unbegründete Furcht, der Warenfetischismus führe die einzelnen wie die Masse zurück auf die Stufe dressierter Haustiere des Kapitalismus. Das war eines der damals wichtigsten Themen der kultur- und gesellschaftspolitischen Diskussionen.
Wenn die Verteidiger des emanzipativen Effekts von Massenkonsum recht hatten, dann war auch zu verstehen, warum die Kapitalisten versuchten, ihre Vormachtstellung durch Kriege wie den in Vietnam zu verteidigen. Fürchteten die Kapitalisten die Konsequenzen ihres Systems selber? Massenkonsum ohne Auswahlfreiheit ist undenkbar – und Auswahlfreiheit ist immerhin eine Freiheit, die höhere Freiheitsansprüche ermutigt. Bezwang die Freiheit, die Eigentum der Kapitalisten geworden zu sein schien, womöglich gerade ihre Herren? War der Vietnamkrieg doch ein Freiheitskrieg auf beiden Seiten? Aber daß die USA den Krieg gewinnen konnten, wenn sie nur kräftig und ohne Rücksicht auf die humanitäre Selbstbeschränkung draufhauen würden, glaubten nur wenige Leutchen nicht. Ich glaubte es zum Beispiel deshalb nicht, weil die USA es unterließen, gleiche Kampfbedingungen für sich und den Vietcong herzustellen. Meine Empfehlung dem Vietcong zunächst einmal die gleichen Waffen zu schenken, mit denen man selber kämpfte, konnte nur als unsinnige Einmischung von Künstlern ins harte Geschäft der Macht eingeschätzt werden. Als typische Popmanier oder als typischer Happeningsklamauk.
Daß dieser Klamauk Methode hatte, ging damals kaum einem ernsthaft um Erhellung der Zeitabläufe bemühten Wissenschaftler, Politiker oder Journalisten auf. Freilich konnten sich diese Zeitgenossen dann auch nicht recht klarmachen, warum die Popartisten, die Happenisten und Fluxusflieger so versessen darauf zu sein schienen, im Museumsbereich nur zu wiederholen, was überall sonst, im Stadtbild und in den Wohnstuben des Westens, auf den Fernsehschirmen und in den Illustrierten ohnehin schon ablief – und zwar vor aller Augen und ohne besonderen Anlaß, es sei denn aus Gründen der Unterhaltung und der Werbung die aber auch eigentlich nur eine Form von Unterhaltung zu sein schien. Bestenfalls verstand man, daß die Künstler einer merkwürdigen Faszination durch Trivialmythen unterlagen – also dieser Entdeckung von neuen Mythen im Alltagsleben der Massenkonsumenten und der Medienwelt.
Die Kinder von HAMBURGER und COCA-COLA hatten offensichtlich das Bedürfnis, sich ihr Leben wenigstens in einigen lyrischen Fetzen und halbironischen Stereotypen zu überhöhen. Zunächst gingen sie bloß gemeinsam in die Kinos, um von Westernhelden und Indianern Zuspruch zu erhalten. Dann versuchten sie auch zusammen zu leben, sich gleich oder ähnlich ungleich anzuziehen und zu verhalten. Blumenkinder, Kommunarden; Hippies und Freaks; Stadtstreicher und Waldläufer wurden gerade durch die Mythisierung ihrer Existenz gesellschaftlich tonangebende Klatschgrößen; sie agierten wie das Personal eines uralten Mythos, dessen Erzähler jedoch mit der Erzählung nicht beginnen konnte, weil es ihn noch nicht oder überhaupt nicht mehr geben durfte. Ein schönes Durcheinander, ein farbiges Erscheinungsbild andauernder Folkloreveranstaltungen.
Aber auch in der Musik der Beatles steckte mehr Kraft der Emanzipation, als sich die Veranstalter von Teenagerfestivals wünschen mochten. Daß lange Haare Widerstandskraft signalisieren, war schon biblische Legende. Vor allem ebnen lange Haare Geschlechtsunterschiede ein, soweit man die am Aussehen von Menschen festzumachen vermag. Unisexuell eingeebnete Gestalten waren vor allem für Polizisten ein Problem, die ja doch immerhin Frauen gegenüber ritterliche Instinkte nicht ganz zurückhalten können. Da nahmen manche Demonstranten über das Verfälschen ihrer Geschlechterzugehörigkeit Hemmungsappelle für sich in Anspruch, die männlichen Lebewesen vor der Polizei nicht zustehen.
Das wurde dann 1968 auch anders. Nämlich fast wie früher. Früher, also vor der Entfaltung der Pop-Programmatik. Zwar hat diese Programmatik starke Wirkungen gezeigt, aber verstanden wurde sie kaum. Die Pop-Programmatik empfiehlt eine künstlerische Haltung, die sich nicht mehr aus der offenen Konfrontation mit den herrschenden Unsinnigkeiten der Konsumwelt, der Massengesellschaft, mit Hollywood und Fernsehschmonzes entwickeln sollte; die sich nicht mehr die Produktion von bloßem Widerspruch gegen alles das abverlangen läßt, was sich durch diesen Widerspruch erst recht demokratisch kritisiert und deshalb legitimiert darstellen kann. Die Pop-Programmatik empfiehlt nicht mehr, gegen die Zumutungen von Zuckerbrot und brutalen Spielen die Kulturweihwedel der hohen, hehren, ewigen Werte ins Feld zu führen. Die Pop- Programmatik empfiehlt Zustimmung als schärfste Kritik – empfiehlt, sich immer erst einmal auf irgendwelche unausweichlichen Rechtfertigungen für Machtpositionen einzulassen, diese Positionen dann beim Wort zu nehmen, sie bis zum Äußersten zu radikalisieren und sie durch die inakzeptablen Konsequenzen jeglichen Anspruchs auf absolute Geltung auszuhebeln.
Also: anstatt lang und erfolglos gegen die Kaninchenstall- oder KZ-Architektur der Nachkriegsneustädte zu polemisieren, jene Haltung vorzuführen, der sich diese Architektur verdankte: Abräummentalität, die die grauenvollen Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs herzlich begrüßte, weil so die alten deutschen Städte endlich modernisiert werden konnten. Also erbat ich Glückliche Bomben auf die deutsche Pissoirhausarchitektur, als die Frankfurter Nordweststadt als eines der ersten Retortenmonster entstand. Andy Warhol formulierte die Tendenz der Programmatik wahrhaft meisterlich: „Das Schönste an New York ist McDonalds. Das Schönste an Paris ist McDonalds. Das Schönste an Berlin ist McDonalds. In Moskau gibt es noch nichts Schönstes.“
Es wäre ja auch allzu lächerlich gewesen, sich als pinselschwingender Künstler den Milliarden bewegenden Konsummaschinen entgegenstemmen zu wollen. Campbells Suppendosen mußten ihren Anspruch auch in die hohe Welt der Kultur tragen, wenn sie schon die ganze Welt besetzten. Da durfte auf keinen Fall so getan werden, als sei die Kultur etwas anderes als Kaufhausangebot. Die einzige Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen, lag bestenfalls darin, den Leuten möglichst total und radikal die Konsequenzen ihrer Verhaltensweisen vor Augen zu führen – sie also möglichst schnell mit der ersehnten Schokolade so vollzustopfen, daß sie kotzen mußten.
Die Pop-Programmatik war affirmativ. Dummerweise hatte der alte Marcuse das noch nicht mitgekriegt und versuchte immer noch, den jungen Leuten jenen Typus von Kulturkritik nahezulegen, den er als junger Mann in den 20er Jahren kennengelernt hatte. Und Marcuse veröffentlichte einen alten Aufsatz, in dem er den affirmativen Charakter der Kultur geißelte. Da galt „affirmativ“ als positiv rechtfertigend und zustimmend. Davon konnte in der Popart keine Rede sein, obwohl es natürlich genügend Künstler gab, die selig zu sein schienen über die Gelegenheit, mit dem Talent von Plakatmalern und der Haltung von Werbefritzen ins Allerheiligste der Malereigeschichte vordringen zu können: ins Pantheon der allgemeinen Akklamation durch Herr und Gott. Marcuses platte Begriffshülse „affirmativ“ stiftete jedenfalls so viel Verwirrung, daß der philosophisch einwandfreie Begriffsgebrauch unter die Räder geriet. Affirmation ist ja Negation der Negation als erneute Ausgangsposition. Vielleicht hätte man stets negative Affirmation sagen sollen, wenn man die Haltung der Popart zu kennzeichnen versuchte. Aber nun ja – inzwischen ist allgemein bekannt, daß der Dienst genau nach Vorschrift die denkbar vollständigste Sabotage des Dienstes ist. Und also haben sogar schon einige Gewerkschafter verstanden, was affirmative Strategie bedeutet, was sie den Popartisten bedeutete. Was an der Popart noch heute beachtlich ist, verdankt sich dieser Haltung. Der Rest, vielleicht sogar der überwiegende Teil, ist doch bloß schlechte Reklamemalerei.
Wie es Mary Quant mit der Durchsetzung des Mini zum ersten Mal gelang, dem Unterschichtengeschmack zur Führung zu verhelfen, so gelang es der Popart zum ersten Male, dem Unterhaltungsbereich, dem Kitsch, dem Camp, wie Susan Sontag (3) den Kitsch für affirmative Strategen nannte, die führende Rolle in der effektiven Kritik an der Gesellschaft aufzunötigen. Und wer wollte es schon wagen, gegen die Unterhaltung vorzugehen, wenn sie so hundertfünfzigprozentig für den ihr nur neunundneunzigprozentig abverlangten Wahnsinn im Gewande der Alltagslogik eintritt? Der Kulissenzauber der Unterhaltungsindustrie ist durch die Popart zum Enthüllungskunststück verwandelt worden, wie es sich Brecht oder Krakauer oder Benjamin vielleicht auch schon für die erste Phase der Massen-/Konsumgesellschaft Ende der 20er Jahre hatten vorstellen können. Diese Verwandlungs- und Enthüllungskunststücke verlangten die zitierte Bereitschaft, nicht mehr an totem Material zu kleben. Weg mit dem Zeug, das uns einreden wollte, aus sich heraus kostbar, wertvoll zu sein. Noch besser, gar nichts erst haben zu wollen, was nicht nur Instrument ist, was Mittel ist.
Die angestammten Verlaufsformen von Popaktionen waren das Happening und das Fluxuskonzert. Geschehnisse ohne Rest, ohne Kulturmüll, der auf die Museumsdeponie befördert werden mußte. Das Museum selbst hatte vor zum Kaufhaus zu werden, eine Durchlaufstation, ein Umschlagplatz für Lebensmittel und Alltagspraktika. Es berührt doch merkwürdig (vor allem die damaligen Attraktionsstars), daß tatsächlich nichts übriggeblieben ist, weder im Designbereich noch in der Architektur. Es gab Wegwerfmöbel aus Preßpapier. Damals waren wir restlos erfüllt vom subversiven Geist der Zustimmung, das galt geradezu als alleiniger Maßstab. Scheel wurde angesehen, wer möglicherweise darauf spekulierte, seine Werbemalerei im Gewande der Kulturrevolution durch Pop zum Rembrandtersatz werden zu lassen. Es gibt kein Popdesign für Möbel und Architekturen über das hinaus, was in Las Vegas und auf Jahrmärkten, in Fernsehunterhaltungssendungen und auf dem Theater an Kulissenzauber entfaltet worden ist. Nichts davon blieb als schlechte Durchschnittsmalerei von Künstlern, die gar keine Popartisten waren und eigentlich auch nur akademische Maler sein wollten. Nichts blieb, alles löste sich in Aktion auf, vor allem in die Aktion der Studentenrevolution, in den USA, Frankreich, Italien und der BRD. Nichts blieb, und das ist ein Triumph, denn es bezeugt doch, wie wirksam die Pop-Programmatik gewesen ist.
(1) Vgl hierzu: Bazon Brock: Wegwerfbewegung. Gymnastik gegen das Habenwollen; Die Wegwerfbewegung. Zur Verteidigung der Unkultur; Strategie der Affirmation. In: Ästhetik als Vermittlung. Köln 1977, S. 423 ff. Sowie Bazon Brock: Aller gefährlicher Unsinn entsteht aus dem Kampf gegen die Narren. In: Bazon Brock: Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit. Köln 1986, S.288.
(2) Vgl. hierzu: Brust raus oder die befreite Brust. Zur Emanzipation eines Körperteils. In: Ästhetik als Vermittlung. Köln 1977, S. 521 ff.
(3) Susan Sontag: Kunst und Antikunst, München 1968.
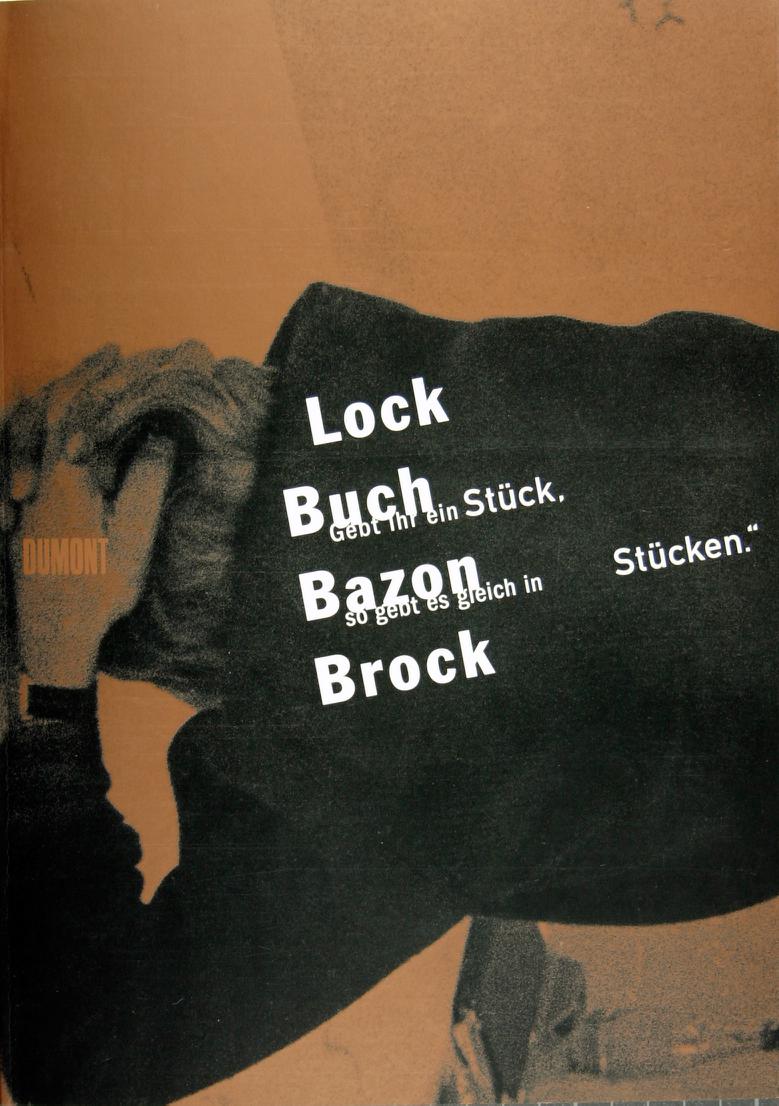 + 3 Bilder
+ 3 Bilder