Werkdetail Seite / Volltext
Seite 51 im Original
Zum dritten Male:
Bazon Brock: Ein Kritiker dessen, was es noch nicht gibt
Frühling, Frühling, etwas ist dran
Es ist wieder soweit. In jedem kleinen Vogel steckt ein großes Flugzeug, das nach Caroline fliegen will. The Venture Five aßen am Nollendorfplatz Schweinebauch und lasen die Zeichen von den Wänden des Pissoirs: „Tritt näher, als Du denkst!“ Mein Freund Karl Alfred Freiherr Revalier von Meysenbug träumte davon, wie er seinen Lieblingsprofessor vor den Straßenjungen bewahrte, indem er dieselben ohrfeigte und sie in die Ecke stellte. Und während den Kastanien von unzüchtiger Natur getrieben die Kerzenstengel steil aufragen, der fromm verwaltende Wind dafür sorgt, daß wieder viele kleine Kastanien geboren werden – während die alte Schweinerei als neues Leben besungen und gefeiert wird, sitze ich am Mischpult, um den Begriff etwas vom Leben in der Sache selbst zum Ausdruck bringen zu lassen: LUNA softeis oder RHENO grün. Wie weit Natur uns zur selbstgemachten, zur Ballsaaldekoration geworden ist, las ich im Taunusgebüsch: die nächste Toilette, großer und kleiner Gebrauch, fünf Kilometer weiter geradeaus. Nicht einmal das Militär steigt noch im einsamen Busch aus der Hose, um sich sichtbar dem Stoffwechsel mit der lebendigen Natur zu verbinden: das ist gut, so sollte es sein. Geschäfte werden im Freien nicht mehr verrichtet, also auch keine Poesie mehr, keine Literatur: die kann’s nur so geben, wie schon von Dame Edith Sitwell dem Baron Clouster nachgeschrieben: dessen Sohn hatte es satt, die Welt und Hügel grünen zu sehen jedes Jahr aufs neue, jedes Jahr gleich, tödlich gleich, langweilig dasselbe, unentschuldbar einfallslos. Baron Clousters Sohn wußte, wie sich da das Blühen ereignet, das Treiben in die Höhe und nach allen Seiten. Diesen Irrsinn kann nur ertragen, wem als Schöpfer der Begriff fehlt und wer zeitlos seine Steine wälzt, die Spule dreht. Clousters Sohn wollte sich umbringen, wenn’s diesmal wiederum so kommen würde, wie alle Jahre und Tage. Der Vater war Engländer genug, dem good LORD, o jesus, die Kompetenzen zu entziehen: er ließ das große Anwesen rot streichen – Goethe berichtet dasselbe als Verlangen Lessings im dreizehnten Buch von Dichtung und Wahrheit –, den Park, den lawn, das bedhouse, den wiggle, die Öchslein und Leibsklaven. Clousters Sohn schien gerettet, ließ sich indes nicht blenden. Schnurstracks ritt er aus seines Vaters Haus und erkannte sich getäuscht aus Liebe zum Leben. Der undankbare Sohn. Er hatte die stolze Geste eines Mannes, der heute ich bin, den Habitus und unverbrüchlichen Charakter eines Bekenners, die Moralität eines Agitators wider die höheren Rechte des Lebens. Er war jung und schrieb Tagebuch, ich heute filme. Da heißt es, die Technik habe unsere Umwelt verändert, und was tun die Deppen: sie schmeißen sich, kaum greints im Grund, unter die Bäume, lagern sich frischluftig ins Feld wie im Mittelalter das Liebchen zur Seite, zupfen den Halm, leben gesund, zelten am See, wandern durch Gottes dickes Fell. So seid gewarnt: die Anpassung unterm bettenden Busch ist schwerer abzubauen, im Freien werdet ihr gefesselt! Boykottiert den Sommer, bleibt in den Städten, tragt Schwarz bei Sonnenschein! Wo man im Hause die Ameisen jagt, spielt man da draußen Indianer mit ihnen, läßt sich willig einen roten Biß aufs Oberbein setzen und kaut den Sand mit Butterbrot. In den Städten hält man’s nicht aus, Wand an Wand mit Tausenden wahrhaft Lust sich zu gönnen, aber im Walde liegen die Paare zu Hunderten quadratmeterweise nebeneinander und zeugen für die Dummheit des Natürlichen auf einem dafür vorgesehenen Terrain, Eintritt ohne Wolldecke 2,50 DM; bewachter Schlaf.
Und solche Leute sollen was von der Kunst verstehen, der Literatur, dem Film. Und solche Regisseure wollen was vom Film verstehen, die die Handkamera draußen heben im richtigen Wald, an richtigen Bäumen aufschwenken und die wirklichen Eichhörnchen belauschen. Film, der aus dem Atelier ins Freie zieht, ist seiner selbst nicht sicher, versichert sich der bewiesenen Wirklichkeit als Bettstatt, der des Prokrustes. 1957 saßen wir sommers in Sellners Garten. Gründgens kam zur Inspektion. Der Nachmittag verstrich, es blieb sehr heiß. Die Abendvorstellung des Sommernachtstraums sollten wir besuchen. Gründgens schlug vor, die Aufführung im Sellnergarten stattfinden zu lassen, besann sich aber sofort, sagte: „Nein, nein, das geht nicht. Die Bäume sind ja wirklich!“ Die artifizielle Existenz verlangt allerdings, daß man sie durchhalte, vom Entschluß am Schreibtisch bis zum Lebensende. Daß da bei uns die Macher sich Künstler nennen, wenn sie ad hoc zu diesem und jenem einzelnen Fall eines Buches, eines Films sich den bösen Blick zulegen, ist schon ein starkes Stück Anmaßung. Erst als Künstler Ansprüche stellen und dann die Moneten als Bürger verleben, das ist ihr Ziel. Mit Recht verlangt auch das unvermutete Publikum von ihnen, daß sie sich von allem Privaten befreien, daß sie Tag wie Nacht durchformen und vorzeigen, woraus sie im einzelnen taghellen Premierenfall Ansprüche ableiten. Das Gekeife der Kulturmenschen nach der respektierten Sphäre auch bei den extemporierten Mitmenschen öffentlichen Interesses, zwingt sie unwissender gegenüber dem, was der schöpferische Fall ist, als die beschimpften Banausen, die für sich das Recht in Anspruch nehmen, ihren Star, Autor und Bildermacher des Nachts am Bettrand aufzusuchen und ihm beim Zähneputzen zuzuschaun. Gut so, brav mit Bravo. Wer’s nicht verträgt, baut sich selbst ab auf das, was er geblieben ist: ein Dummchen im Knoll International, ein „Möchte-gern-aber-nicht-für-immer-und-so-ganz-und-gar“. Für jeden Künstler sagt’s doch das Orakel an der Pissoirwand in Berlin: „Tritt näher, als Du denkst!“
Produkte unserer Branche können kein Angebot unter der Hand sein. Waschpulver kann es sein, Brot und Nähmaschinen. Wer Filme macht, schreibt und den Pinsel spazierenführt, ist anderm Anspruch ausgeliefert: dem öffentlichen, dem politischen. Nicht die abstrakte Form des willkürlichen Gesetzes verbietet es dem Ministerialdirigenten, mit seiner verheirateten Geliebten in einem Leihwagen auf einem Parkplatz die menschlichen Urstände zu feiern, sondern die Möglichkeit, dabei jederzeit mit ganzem Recht befragt zu werden, auf die Hand gesehen und in die Tasche gefaßt. Solches auch nur vierundzwanzig Stunden strengstens an sich auszutragen, macht den Kopf öffentlichen Interesses zum nota bene Künstler. Durchaus die Presse ist berufen, die Versagenden, Müden aus dem Rennen zu nehmen, wenn sie von allein nicht das Handtuch werfen. Es könnte denen so passen, für einen Tag König zu sein, mal auch den Speichel zu spucken, den sie mit den anderen sonst lecken. Für einen Tag König, wenn die Tage schön sind, die Hochzeit nah: für einen Tag Künstler, wenn die Gagen hoch sind und die Beweislast fern. Kritiker für einen Film sein, wenn der Film ein „Kunstwerk“ ist und man es den anderen sagen darf.
Nein, aller Tage Künstler, aller Tage Abend. Der Lebensbau ist am Reißbrett zu entwerfen. Das Ende von allem ist mitzuliefern, jeder Tag ein kleiner Weltuntergang. Dann kann jeder sein eigener Star sein, der Maschineneinrichter bei der VDO, die Kassiererin beim Kaufhof, der Verkehrspolizist an der Kreuzung. Bewußtsein von Öffentlichkeit ist ihnen dann vorweisbar, wenn sie begreifen, inwieweit jeder Schritt und jedes Armausstrecken, jeder gedrehte Kopf und der Blick nach schräg oben sie bestimmt, und wie sie fremdbestimmt werden. Nur wer auf sich selbst ständig reflektiert und sich beobachtet, wird auch anderes als sich selbst wahrnehmen. Mit der platten Identifikation ist nicht getan, wie das unsere Königskünstler glauben. Wir müssen unser Publikum zu Stars machen, zu Professionellen. Die Konsumierung, die Rezeption darf nicht länger eine Beschäftigung nach abgeschlossener Produktion sein. Der Industrie sollte das zumindest einsichtig werden: nicht in der Freizeit konsumieren, das ist nicht genug. Wir fordern die Achtstundenkonsumzeit. Die Aktivitäten sind die gleichen, ob jemand durch Arbeit produziert oder konsumiert. Wechselweise könnte die Hälfte der heute im Produktionsprozeß stehenden Menschen zur Konsumption beschäftigt werden. Wir fordern für die Rezeption von Literatur, Kunst und Film gleiche Zeiten und Mittel, wie für deren Schaffung benötigt wurden. Es geht nicht länger an, daß jemand zehn Monate für die Herstellung eines Filmes braucht, aber dem Zuschauer zumutet, diesen Film in 110 Minuten zu rezipieren. Auf zehn Monate im Kino sitzen für jedermann – welche Resultate wären zu gewärtigen! Dies ist die einzige Lösung der verkrampften Problematik, der bespiegelten Krisen des Films. Es gilt, das Pferd wahrlich beim Schwanz aufzuzäumen, sonst werden wir weiter rückwärts reiten. Als Kritiker dessen, was es noch nicht gibt, sehe ich mich berechtigt, solche vorderhand blödsinnigen Postulate zu stellen. Vor allem, den Primat der Theorie vor der Praxis aufrechtzuerhalten. Sonst bleibt kein Argument gegen Herrn Martin und den deutschen Film der Zukunft, die jederzeit darauf verweisen könnten, es gelte eben Filme zu machen und nicht zu reden, bloß einfach so Filme zu drehen ohne alles drumherum an Gedanken und Spekulationen. Und es werden immer wieder nur diejenigen Filme drehen, die es schon getan haben; die mit diesem Ausweis ihrer Überlegenheit durch Praxis dem Produzenten die sichere Gewähr für den Gebrauch seines Geldes sind – oder er dreht eben keine Filme mehr. Soweit sind wir ja bereits in Deutschland-West. Unsere Gesellschaft besteht aus einer zu kleinen Zahl an Individuen und deren Zusammenschlüssen, als daß sich solche selbst regulierten. Erst das Bewußtsein von der Problematik des Zusammenspiels, der Funktionsmechanismen gesellschaftlichen Lebens wird Regulative liefern. Deshalb gilt es, das Metier Film über alles auszubreiten, was unser Leben ausmacht. Deshalb gilt es, sich nicht auf das Medium einzuschränken: wer filmen will, muß auch Bücher schreiben, muß gut Auto fahren, Bilder sehen, Eis verkaufen, russisch essen, gerne fliegen, Söhne zeugen, Häuser bauen, Landkarten betrachten. H. C. Artmann kennen und viele Sprachen sprechen, ohne sie beherrschen zu wollen. Der beste Weg, Allgemeines vorzuzeigen, aus den Paßformen zu reißen, ist das Besondere, Spezielle, Einzelne. Eine spezialisierte Filmzeitschrift wird so welthafte Beziehungssysteme liefern können wie keine allgemeine Illustrierte, die es sich zur Aufgabe setzte, dergleichen als das immer Aktuelle zu bringen, indem sie alles zu bringen bemüht ist. Alles ist weniger als eines. Zehnmal eines ist mehr als zehn. Das ist der Weg, den wir gehen wollen zu dem, was es noch nicht gibt.
Nun haben mir und meinen Intentionen Wohlmeinende per Post Zweifel angemeldet, ob ich denn etwa an dieser Stelle, in FILM, auch tun dürfe, was ich nicht lassen kann. Ob nicht etwa der Verleger die Absicht hege, mich auf sein Revier zurechtzustutzen. Ich sage: zwar sind schon Zeilen von mir im Friedrich Verlag verlorengegangen, die ich hier aufrichtig betrauern will:
Ruhe bitte
jedoch keine, die zu einem Artikel in FILM gehörten. Einmal als Schreiber akzeptiert, dürfe ich in FILM schreiben, was ich für richtig erachtete, sagte der Verleger. Er hält sich daran, woran sich nicht halten würde, wer nicht wie er Verleger ist. Von weiteren Einsendungen zu diesem Thema bitte ich abzusehen. Die Bestattung findet nicht statt.
Als Magenschließer eine reiche Einzelheit aus meinem Album: der Grenadier und Ehemann in LE DIABLE AU CORPS trug auf seinen Mantelspiegeln die Regimentsnummer 189. Ich sah das, als François ihn um Feuer bat.
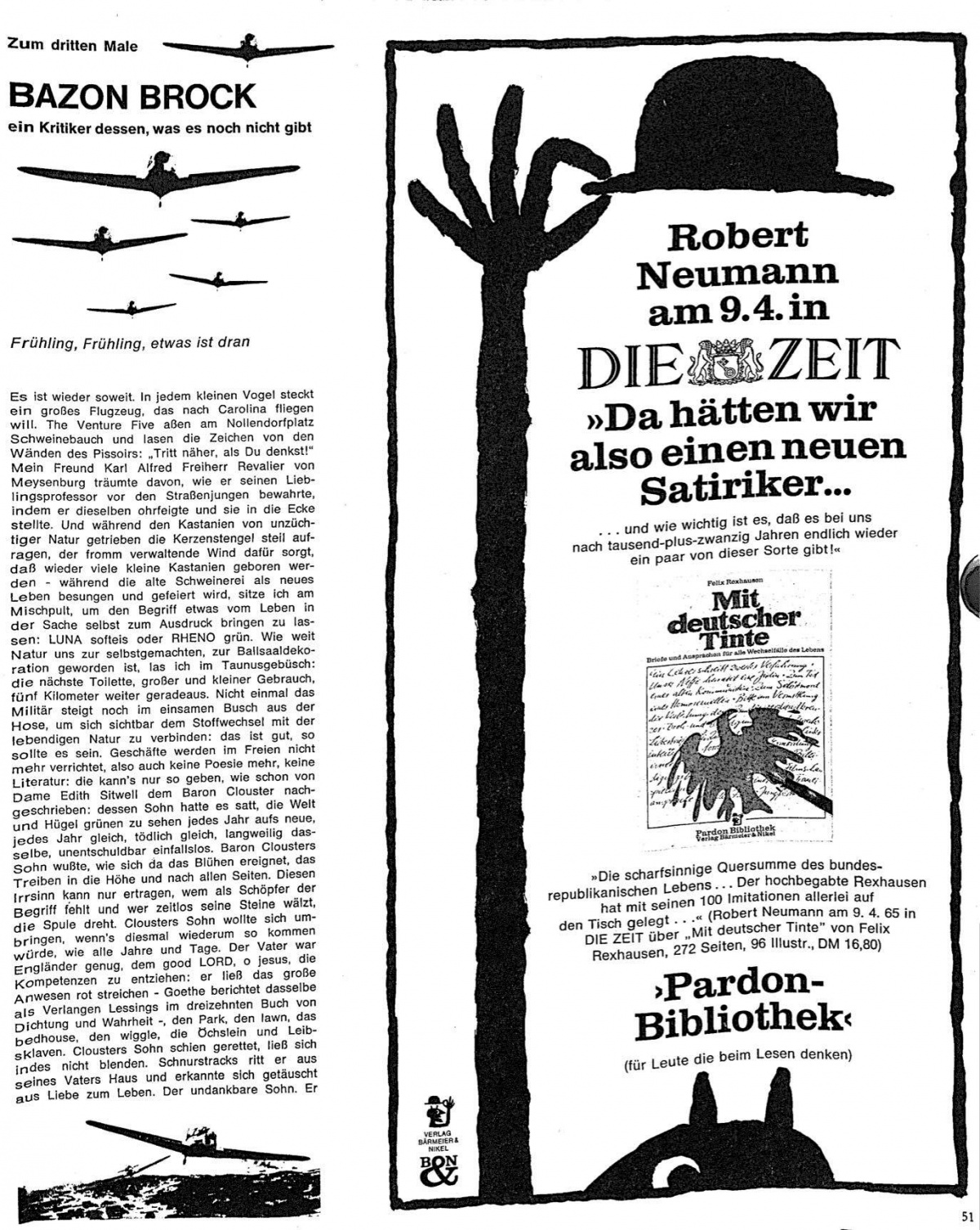

siehe auch:
-
Der Action-Film als Handlungslehre – Abschnitt in:
Ästhetik als Vermittlung
Buch · Erschienen: 1976 · Autor: Brock, Bazon · Herausgeber: Fohrbeck, Karla
