In: Gestaltung zwischen ›good design‹ und Kitsch (Katalog), IDZ, Berlin 1984
Den ›Kitschverdacht‹ erhebt man gegen gestaltete Objekte, die mit ihren Anmutungsappellen behaupten, als bloße Dinge tatsächlich die Erfüllung von Bedürfnissen zu sein. Diese Objekte geben das Versprechen ab, den Käufer, den Nutzer restlos zu befriedigen. Sie signalisieren etwa: »Hast Du Kummer, so nimm mich! Fühlst Du Dich lächerlich klein, stillt jenes Objektensemble Dein Verlangen nach Erhöhung und Überhöhung.« Dann aber nimmt doch das Objekt den Menschen und stellt ihn als seinen eigenen Traum in der Vitrine aus.
Das good design-Produkt dagegen signalisiert, daß das einzig Wirkliche, das, was zählt, Ideen seien, denen wir in Formen und Gestalten nahezukommen hatten. Die Materialien und die Methoden, mit denen wir unsere Gestaltungsarbeit den allen Formen zugrundeliegenden Ideen annäherten, müßten deshalb möglichst unerheblich sein, zurückhaltend, ja asketisch streng. Das good design signalisiert also: »Hast Du Kummer, dann vergiß ihn; fühlst Du Dich lächerlich klein, so denk an die großen Zusammenhänge, wie sie das good design als Welt, Kulturen und Geschichte umspannendes zeitloses Reich der Geometrie präsentiert.«
Angesichts dieser beiden Positionen ist die Frage nach einer dritten unvermeidlich, ja ganz selbstverständlich: Denn zum einen kann ja der weitaus größte Teil der Designobjekte den extremen Positionen nicht zugerechnet werden; zum anderen sind Kitsch und good design ja nur zwei Antworten auf ein und dasselbe Problem; und es wäre ja gelacht, wenn es ausgerechnet im Design auf ein entscheidendes Problem nur zwei Antworten geben sollte. (1)
Welche anderen Antworten hätten wir denn gern? Zäumen wir unser Steckenpferd ruhig mal von vorn auf. Also: Wir hätten gern gestaltete 0bjekte, die uns in bestimmten Situationen (zum Beispiel gegenüber Chefs, rücksichtslosen Nachbarn und anmaßenden Volksvertretern kräftig überhöhen. Normalerweise werden solche Objekte »Waffen« genannt, die wahrlich jenseits von Kitsch und good design liegen (oder sind die Designer des ›Leopard II‹, des ›Tornado‹ namentlich bekannt; sind sie Mitglieder von Berufsverbänden, erhielten sie Auszeichnungen?). So löblich auch das Waffentragen unter orthopädischen Gesichtspunkten sein mag – gestraffte Aufrechthaltung, sicher wiegender Schritt – so risikoreich waren dennoch diese kleinen Helfer des beschädigten Selbstbewußtseins im Alltagsleben. Wenigstens teilweise läßt sich das orthopädisch wie psychologisch gleichermaßen Wünschbare einigen gestalteten Objekten abverlangen, die allgemein verständlich allgemein akzeptierte Statushierarchien in Erinnerung zu rufen vermögen und die sich selbst an möglichst höchster Stelle in diesen Statushierarchien behaupten.
Leider gibt es nur noch ganz rudimentär derart allgemein gekannte und anerkannte Hierarchien sozialer wie gestalterischer Geltung. Jeder hat die Erfahrung, daß die modernsten sozialpsychologischen ›Waffen‹, also etwa Autos, Büroeinrichtungen, Wohnungsausstattungen, Architekturen, Bücher, Kunstwerke, Bekleidungsstücke, auch von komplett idiotischen oder mehr oder weniger kriminellen oder völlig unerzogenen und ungebildeten Zeitgenossen benutzt werden können. Sozialer Status, Persönlichkeitspotential, ökonomische Macht korrespondieren kaum noch (haben sie je korrespondiert?) mit der Folge, daß ein und demselben Objektensemble sowohl Überhöhungen in Richtung auf soziale Anerkennung wie in Richtung auf ökonomische Macht und das höchste Glück auf Erden die Persönlichkeit (2), abverlangt werden. Das kann nicht klappen – eine Welt voller Waffen ist sprechender Beweis für die Unhaltbarkeit von good design und Kitsch.
Um so dringlicher wünschen wir andere Vermittlungen zwischen den extremen Positionen der Kunstwerke und Waffen, wobei es genausogut kitschige Waffen wie gut designte Kunstwerke gibt. Wer mit Waffen irreversible Tatsachen schafft, ist ein Kitschier wie der Tod. Immerhin treten wir ja heute in großer Zahl für Waffen nur insofern ein, als durch Waffen der Waffengebrauch verhindert werden kann. Dieses Unsichtbarwerden der Waffen, dieses ›good design‹ der Abschreckung gilt auch für Kunstwerke, die uns weismachen wollen, daß Gedanken frei sind, daß Ideen nicht umzubringen sind und daß wir uns deswegen um unsere faktische Abhängigkeit und irdische Hinfälligkeit kaum zu bekümmern brauchten.
Nein, wir wünschen, daß die gestalteten Objekte uns in den verschiedensten Sphären unseres Alltagslebens Ruhe gönnen, nicht erst jenseits des irdischen Daseins; das heißt, wir wünschten von ihnen, daß sie auf Erden und unter Menschen zeitlos gültig wären.
Wenn wir wüßten, daß die neuen Designs auch nichts anderes waren als die Aktualisierung des Alten; wenn wir also wüßten, daß nichts verlorengeht oder gar wertlos wird, könnten wir ein viel unbekümmerteres Verhältnis zur Dingwelt entwickeln. Normalerweise behauptet man, daß wir nur aus Gründen knappen, schwer verdienbaren Geldes mit unseren Sachen so ängstlich-gouvernantenhaft umgehen. Viel wichtiger ist für uns sicherlich das Bemühen, den ideellen Wert der Dinge durch den Umgang mit ihnen nicht zu mindern. Das exzessive Schwelgen in Konservierungsmitteln für Antiquitäten, und seien es die 50er Jahre, die wir erst gestern vom Sperrmüll geholt haben, beweist das anrührende menschliche Verlangen nach Bewahrung, nach Dauer, nach Stabilität.
Wir verlangen unseren Möbeln diesen Hinweis auf Kontinuität, Verläßlichkeit und Unzerstörbarkeit ab. Die Objekte um uns herum sollen also auch Museumsreife besitzen.
Bisher scheinen uns unsere Wünsche konsequent auf das Kriegsdenkmal als dritter Dimension des Designs hinzuführen. Es vereinigt Effektivität der Waffe mit der kulturellen Garantie, daß wir nichts zu zerstören brauchen, weil einerseits das Neue doch nur der neue Blick auf das Alte ist und andererseits nichts verlorengeht. Wie aber kann das Kriegs- und Kriegerdenkmal als Wohnzimmer, Auto oder Büro zugleich auch einem entscheidenden anderen, unzügelbaren Verlangen nach dem Tertium, dem Ausweg entsprechen? Die Dinge unserer Lebenssphäre, die ja schließlich durch und durch gestaltet sind, selbst da, wo sie noch als Natur angesprochen werden, sollen uns auch gemütlich anrühren. Wertbeständigkeit in allen Ehren, auch die Faust auf dem Tisch und gute Nachrede; aber man möchte sich auch gehen lassen, sich säuisch wohlfühlen, enthemmt und unbedingt; man möchte versöhnt sein dürfen in Übereinstimmung mit allem und jedem: man möchte die Euphorie des schließlich guten Endes, des Fortschritts aus voller Überzeugung vertreten dürfen: man möchte sich den Wonnen der Gewöhnlichkeit auch hingehen dürfen, ohne zuvor ein Gedicht geschrieben, einen Essay konzipiert oder ein Bild gemalt zu haben. Kurz, man möchte, daß die Dinge einem helfen wegzutreten, harmlos zu sein, belanglos, kindlich heiter, offen und ohne Argwohn gegen sich selbst, geschweige denn gegen die anderen.
Das ist zwar nicht ganz die deutsche Gemütlichkeit, aber doch die Gemütlichkeit der Designer, und die sind Gott sei Dank zum überwiegenden Teil ganz undeutsch. Also, wie sieht das gemütliche Kriegerdenkmal aus, das zugleich Gewalt über Dinge und Menschen signalisiert; das Ordnungen, also die Kontinuität von Geltungsansprüchen und damit Dauer repräsentiert und das zudem alle diese Leistungen mit Hinweis auf die menschliche Natur als bloße Entwürfe, als widerrufbare Handlungen wie im Kinderspiel vor der Verselbständigung zum Sachzwang und vor der Unausweichlichkeit als Schicksal zu bewahren weiß?
Wolfgang Neuss würde wahrscheinlich meinen, daß diesen Anforderungen Objekte entsprechen könnten, die durch designerische Umwandlung von wirklichen und ganz neuen Waffen entstünden. Wo die Arbeitsräume vernichtungsmächtiger Militärs als gemütliche Wohnzimmer eingerichtet wurden, müssen die Wohnzimmer ohnehin zu Schlachtfeldern werden, aber bitte nach der Schlacht oder zumindest als Warnung vor der Schlacht. Das ist ja das Lobenswerte an Kriegerdenkmälern, daß sie selbst nicht der Krieg, sondern die Warnung vor dem Kriege sind oder – noch besser – eine unaufhebbare Erinnerung an ihn. Insofern wären die Trümmerstädte Deutschlands der 50er Jahre die beste Gestaltung zwischen Kitsch und good design, die unübersehbare dritte Position zwischen Vollrausch und Askese, zwischen leibarmer Idee und hohlem Versprechen gewesen.
Aha, ahnten wir es nicht, das Steckenpferd und die Reitanleitung tragen den Namen »Ruinieren als erkenntnistheoretisches Prinzip«. Die dritte Position des Designs, also eine Ästhetik des Kaputten, des Häßlichen? Auch in den angewandten Künsten, also im Design, wird man im Raffaeljahr, im Jahr der Nazimachtergreifung mit Bauhausmord und Blubokitsch ohne weiteres verstehen, daß unser Heil kaum noch in der Stigmatisierung des häßlichen Kitsches und in der Verklärung des schönen, guten und wahren Designs liegen kann. Die Schönheit ist verdammt häßlich geworden – Raffael war ja nur der erste, an dem dieses schon vor achtzig Jahren konstatiert werden konnte, als man ihn für die Schlafzimmer der Kleinbürger zu entdecken begann. Andererseits reisen wir unter Anleitung sehenskundiger Künstler durch die Müllandschaft des Ruhrgebiets, um der Schönheit ihres Drecks und Bruchs als einziger Erscheinungsform der Schönheit zu begegnen, die wir noch zu tolerieren bereit sind.
Die Schönheit des Häßlichen, das ist die dritte Ebene des Designs. Junge Leute entdeckten die Schönheit von unbekleideten Maschinen. Ihre Begeisterung für nackte Armaturen zwang die Designer, Geräte so zu gestalten, als seien sie gar nicht gestaltet. Die neuen Jeans, die schon wie alte aussahen; die neuen Taschen, die wie vom Misthaufen aufgelesene Pfennigartikel wirkten; der Kompositstil, in dem zur letzten Schönheit gefügt erscheint, was total wahllos aus den Second-hand-Wühltischen herausgegrabscht wurde; der Wohnungsneubau, der wie eine Barackenruine aus dem Zweiten Weltkrieg aussieht: die Kaufhausarchitekturen, die mit ihren ruinösen Einbrüchen, Anhäufungen Käufer anlocken; der Fragmentarismus philosophischer Erörterungen, bei denen man nicht vor Langeweile einschläft oder sich vor peinlichem Bekenntnisekel fluchtartig ins Freie begibt – das alles sind Produkte der dritten Ebene, sind Zeugnisse einer Position zwischen Kitsch und good design, freilich Zeugnisse, die wir inzwischen allzu gut kennen. Überhaupt scheint ja die dritte Position im wesentlichen von Künstlern bearbeitet zu werden, die inzwischen zu spüren bekamen, was es heißt, ein Designer zu sein. Wenn am Beginn der Designbewegung der Versuch stand, während der industriellen Revolution sich als Künstler weder in die Dachkammern noch in die Museen, weder in die Himmel der Kunstautonomie noch in die Höllen der Unverbindlichkeit zurückzuziehen, also die künstlerische Arbeit gerade mit den neuen Mitteln und Methoden wirksam zur Geltung zu bringen, dann scheinen wir inzwischen so weit zu sein, daß die Industriegesellschaft ihre routinierte Einfallslosigkeit, ihre Absatzprobleme, ihre Gier nach neuen Produkten nur noch stillen kann, wenn sie ihren Protagonisten und Adressaten, ihren Produzenten wie Rezipienten künstlerische Haltungen und Urteilsformen zugesteht, also künstlerische Freiheit. Die Unternehmerspitzen müßten langsam einsehen, daß ihre Unternehmungen unvergleichlich leistungsfähiger würden, wenn nicht nur sie selbst, sondern möglichst viele ihrer Mitarbeiter eben jene Fähigkeit besäßen, die sie nur mit freien Künstlern teilen. Freilich wird es ein hartes Stück Arbeit bleiben, Unternehmer und Künstler davon zu überzeugen, daß sie nicht wie bisher das alte Doppelspiel zur Umsatzförderung fortsetzen dürfen: nämlich erst aufbauen und dann zerdeppern und dann wieder aufbauen. Das sind, wie gesagt, bloß Positionen des good design (aufbauen) und des Kitsches (zerdeppern). Die dritte Position verlangt von vornherein nach Ruinen. Und erstes ermutigendes, arbeitsplatzsicherndes, sozial sinnvolles Betätigungsfeld im öffentlichen Raum wie in den privaten Räumchen ist die Produktion von gemütlichen Kriegerdenkmälern.
(1) Vgl. auch ›Soziodesign – Lebensformen und Gestaltung‹, Band IX, S. 337-342
(2) Vgl. hierzu ›Persönlichkeit werden‹, Band IX, S. 388-400
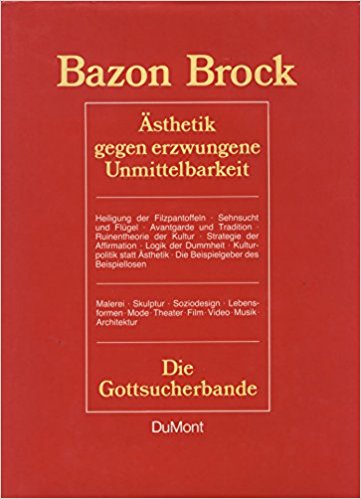 + 1 Bild
+ 1 Bild