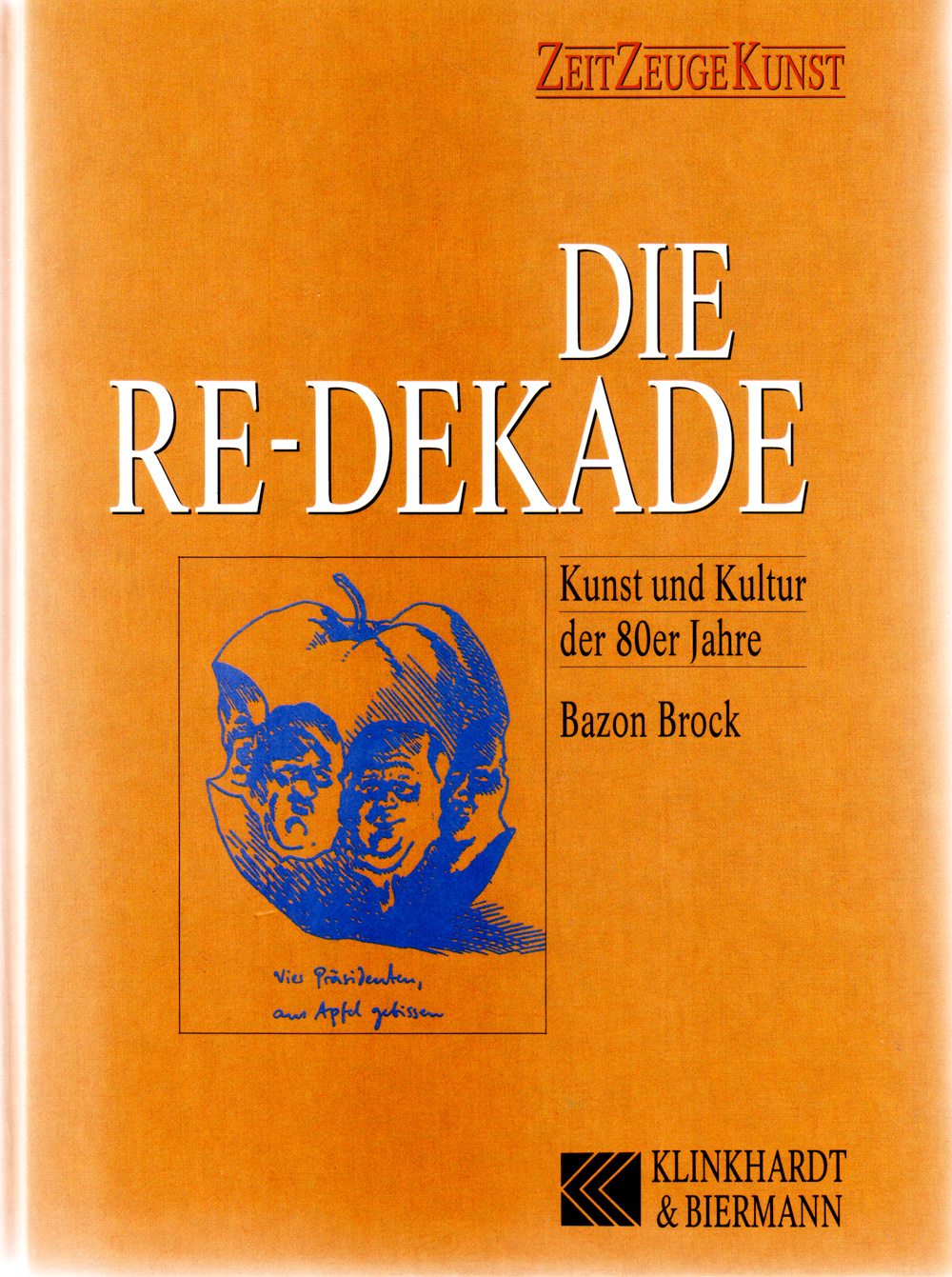Schlag 1989 wurde Bonn 2000 Jahre alt – etwas viel Geschichte für ein 40jähriges Provisorium. Das zu beheben, schenkte der Bundeskanzler der Stadt Bonn eine Orientierung stiftende Ausstellung, die soeben im neuen Bonner Kunstverein unter dem Programmtitel „Hauptstadt – Zentren, Residenzen, Metropolen in der deutschen Geschichte“ eröffnet wurde. Zentrum war Bonn immer – wie jede größere Siedlung für ihre Region; Residenz war es auch, sogar eine bedeutende im Zeitalter des Barock; vor allem war und ist Bonn eine Stadt, die sich hartnäckig weigert, Hauptstadt zu sein. Ist diese Abwehr ein gesunder Reflex bürgerlicher Moderatheit gegen die Zumutung, eine unangemessene Rolle spielen zu sollen, Angst, sich zu blamieren, Unfähigkeit des Mittelmaßes, in großen Zusammenhängen zu denken?
Wenn die Hauptstadt-Ausstellung irgendetwas zeigt, dann etwas auf den ersten Blick recht Kontraproduktives, das aber immer schon vermutet wurde: die Ansiedlung der Regierung in einer Stadt macht aus dieser noch keine Hauptstadt – zumindest nicht in der jüngeren Geschichte. Hauptstädte lassen sich nicht verordnen oder vom Reißbrett bestellen.
Eben das schienen Parlamentarier und Regierende in Bonn sich vorgenommen zu haben. Das Bundesbauministerium zeigt in einer Lagerhalle rückwärts des alten „Vorwärts“ an der B 9, was als Architektur der definitiven Hauptstadt gelten soll. Als Provisorium und ad-hoc-Maßnahme ist manches davon akzeptabel; als Resultat langfristiger Überlegungen wirken die Bauvorhaben kläglich.
Man kann ein Provisorium nicht allein dadurch auf Dauer stellen, daß man Dauer durch schiere konstruktive Solidität und Zuverlässigkeit der Machart zum Ausdruck bringt. Institutionen wohnen ebenso wenig wie Individuen in bloßen Gehäusen – sie wohnen in Gedanken, in Vorstellungen und Formideen Die erst machen aus einem Bau eine Architektur und aus einer Ansammlung von Architekturen eine Stadt.
Was hinter den geplanten Bauten des neuen Bundespresseamtes, des neuen Bundestagskomplexes, der Abgeordnetendomizile, der Bundeskunsthalle und dem Museum für deutsche Geschichte an Vorstellungen von einer Hauptstadt steht, bleibt dem Betrachter der Modelle und der wohl auch modellhaft präsentierten Projekte verschlossen. Fast wäre es einem am liebsten, wenn hinter diesen Allerwelts- und Allerfunktionsbauten gar keine Überlegungen steckten; dann könnte man mit dem Ratschlag auftrumpfen, gefälligst erst noch einmal nachzudenken und künstlerisch großzügig alles noch einmal neu zu konzipieren.
Aber das ist ja alles schon Resultat permanenter langjähriger Wettbewerbe mit begründeten Jurorenurteilen und wohlmeinenden Expertenempfehlungen. Und was für welchen! So hat beispielsweise Heinrich Klotz, Kunsthistoriker und erster Direktor des Frankfurter Architekturmuseums, den Bonner Hauptstadtplanern bereits 1978 brillant und pointiert, detailbezogen und in Verantwortung für das Ganze, Einsichten hinter die Spiegel gesteckt, die heute noch genauso zu empfehlen wären, obwohl in den neuen Entwürfen sowohl gestikulierende Betonmonumentalität wie Rechnungshofkargheit vermieden wurden zugunsten postmoderner Lust-, Lach- und Liebreize. (34)
Klotz fragte, wie viele andere Kenner der Probleme: „Welche Repräsentationsformen gibt es überhaupt, die ein demokratisches Staatswesen vergegenwärtigen können? Monumentalbaukunst – wie das Kapitol in Washington oder wie das Parlament in London – hat ihre Wurzeln in Gesellschaftsordnungen, in denen Macht nicht demokratisch-repräsentativ, sondern feudal oder absolutistisch ausgeübt wurde.“
Ist es allzu ketzerisch, darauf nach jahrelangen Diskussionen schlicht zu antworten, daß ein demokratisches Staatswesen sich in Bonn wie anderswo gerade so repräsentiert, wie es das tut, in Bauten also, die wahlweise als Banken und Rathäuser, Präsidialsitze und Schulämter, Regierungszentralen und Hochschulen, Konzernverwaltungen und Kaufhäuser genutzt werden könnten, als besäßen alle diese spezifischen Funktionen kein eigenes Selbstverständnis und keine je besondere Verpflichtung aufs Große und Ganze? Sind nicht gerade diese Bauten wegen ihrer Unauffälligkeit und Prätentionslosigkeit demokratisch repräsentativ und damit auch für eine Bundeshauptstadt gerechtfertigt? Sind sie nicht gar bedeutend in ihrem unkaschierten Ausdruck für das, was in unserem Gemeinwesen für seine Institutionen und Repräsentanten bestimmend ist?
„Wir sind wie unsere Volksvertreter mit eigentümlicher Gleichgültigkeit geschlagen gegenüber dem bedeutungsvollsten Mittel staatlicher Vergegenwärtigung, nämlich der Architektur“, stellte Klotz fest. Sollte man das vielleicht gar nicht beklagen, weil das, „was Diktatoren nur allzu genau wußten, nämlich mit Architektur staatliche Umwelt eindrucksvoll zu erzwingen, tatsächlich in der Gegenwelt des Parlamentarismus keine demokratische, bessere Alternative hat“? Wenn es keine bessere Alternative gibt, dann müßten wir ja wie die Feudalherren, wie die Autokraten und Diktatoren bauen. – Geben wir endlich zu, daß das die einzige Schlußfolgerung aus den Expertenempfehlungen ist. Trauen wir uns nur nicht?
Wenn wir uns das nicht zutrauen, bliebe uns nichts anderes, als alles, was nun einmal hier und da, mal so, mal anders gebaut wird, gerade deswegen befriedigt gelten zu lassen, ja, zu verehren, weil es dazu nur nichtakzeptable Alternativen gibt, nämlich die der Feudalherren und Diktatoren.
So gesehen, sind die Bauplanungen für die Bundeshauptstadt geradezu der Inbegriff vollendeter Architektur in einer zeitgemäßen Demokratie. Es hätte demnach keinen Zweck, mit Klotz weiterhin zu fordern, „die Phantasie der Architekten muß hinreichen, eine Form zu finden, deren Ausdrucksgehalt nicht nur augenblickliche Impressionstiefe garantiert, sondern die auf Dauer glaubhaft sein kann“. Was ist schon auf Dauer in der Geschichte glaubhaft? Lassen sich nicht die Bauten vordemokratischer Zeiten in den Hauptstädten und Regierungssitzen Rom, Paris, London, Washington etc. ohne weiteres mit ihrer heutigen Nutzung durch demokratische Institutionen und deren Aufgaben bestens vereinbaren? Wir erleben diese Hauptstädte in ihren Architekturensembles so intensiv, weil sie eines unserer zentralen Vorurteile revidieren. Sie beweisen, daß architektonische Formen nicht aus sich heraus feudal oder absolutistisch, demokratisch oder sozialistisch oder sonstwas sind. Es gibt keine feudalistische oder demokratische Architektur; es gibt nur leistungsfähige oder miese. Leistungsfähig ist sie dann, wenn sie einen Lebensraum in Formen und Vorstellungen möglichst umfassend definiert. Solche Architektur ist auch dann leistungsfähig, wenn sich ihre Nutzer mit den zugrunde gelegten Formen und Vorstellungen nicht identifizieren, aber sich ihnen zu konfrontieren gezwungen sind; sonst wären Architekturen schon innerhalb einer Generation dem Verdikt verfallen, historisch überholt zu sein. Zeitlose Gültigkeit des guten Beispiels gelungener Architektur ist eine Schimäre wie die absolutistische oder demokratische Architektur.
Was Demokraten von Feudalherren unterscheidet, ist ein anderer Gebrauch der Architektur; Dauer ist für Demokraten nicht definitive Endgültigkeit, sondern andauernde Auseinandersetzung auch mit den Formideen und Lebensvorstellungen, die nicht ihre eigenen sind und die niemandem als endgültige Lösung der besten Möglichkeit verordnet werden können. Dem Selbstverständnis der Demokraten in Rom, Paris oder Washington nützt der tägliche Aufenthalt in vordemokratischen Architekturen sowohl als Identifikation mit wie als Abgrenzung zu ihrer Geschichte. Tut es nicht jedem Demokraten wohl, von solcher Architektur daran gemahnt zu werden, was auch in ihm noch an feudaler Selbstüberhöhungssehnsucht und autokratischer Machtgeste steckt?
Hier liegt der Hund der Bonner Architekturmisere begraben und nicht bei der Phantasielosigkeit der Architekten. Entscheidungsbefugte Funktionsträger müssen sich auch in einer Demokratie, mit welchen architektonischen Mitteln auch immer, als diejenigen identifizieren lassen, von denen das Wohl und Wehe einer Gesellschaft abhängt. Es ist nicht demokratische Selbstbescheidung, auf architektonischen Ausdruck der eigenen Rolle zu verzichten. Sich hinter unauffälligem Oberflächenfinish unsichtbar zu machen, sich nur in gerade marktgängiger Architekturverpackung zu „verkaufen“, mag zwar machtstrategisch erfolgreich sein; es verhindert aber gerade damit, was alle lauthals beklagen: die Demokratie finde keinen Ausdruck und keine Repräsentation ihres inneren Zusammenhalts. Gerade wenn – nach dem berühmten Worte Willy Brandts – demokratisch legitimierte Funktionsträger den Durchschnittsmenschen entsprechen, die sie wählten, muß der Ausdruck demokratischer Institutionen sichern, daß Durchschnitt nicht blasses Mittelmaß intellektueller, kultureller und moralischer Kleinköpfe bedeuten darf.
Man sollte also nicht länger so tun, als könne man historische Beispiele leistungsfähiger Architektur nicht nachahmen, weil sie von vordemokratischen Bauherren auch genutzt und benutzt worden sind. Die Misere der Bauplanung für die Bundeshauptstadt hätte dann ein Gutes doch bewirkt: Die Einsicht, daß wir die Demokratie noch gar nicht verdienen, in der wir das Glück haben zu leben.
• (34) Heinrich Klotz: Gestaltung einer neuen Umwelt – Kritische Essays zur Architektur der Gegenwart, Luzern 1978.