oder Th. W. Adornos Kampf gegen Oberpriester und Oberkellner eines Wissenschaftsideals
In: Bazon Brock: Die Re-Dekade. München 1990, S. 153 ff.
Zumindest der Begriff „Ästhetik“ hat in den 80er Jahren Konjunktur. Keine Tageszeitung (inklusive der Wirtschaftsseiten, zum Beispiel der FAZ), in der nicht beherzt vorbehaltlos um mehr Ästhetik in unserem Alltagsleben gebeten wird. Andererseits ist selbst in Fachzeitschriften für Kunst und Kultur eine latente Aggressivität gegen mehr oder weniger alle ästhetische Theoriebildung spürbar. Immerhin wird nicht mehr generell dafür eine grundsätzliche Theoriefeindlichkeit, etwa der produktiven Künstler nach dem banalen Motto „Bilde, Künstler, rede nicht“, verantwortlich gemacht. Die Theorie wird auf andere Weise, medienimmanent, ausgeschaltet.
Die Leser der Zeitschriften und Fachpublikationen hätten keine Zeit mehr für langwierige theoretische Erörterungen. Wem es nicht gelinge, seine Artikel und vor allem auch seine Bücher mit auffälligen Reizworten zu durchsetzen und zentrale Aussagen in die Merkformen von Schlagzeilen zu überführen, habe keine Chance mehr, wahrgenommen zu werden. Selbst die Wissenschaftler hatten sich den veränderten Rezeptionsgewohnheiten des Publikums anzupassen. Aber es bleibt ja nicht bei diesen rezeptionsökonomischen Zwängen. Wer sich den Erwartungen des Publikums anzupassen hat, wird auch danach beurteilt, inwieweit er in der Lage ist, die Erwartungen des Publikums zu erfüllen. Wie wenig muß ein Publikum seine eigenen Interessen ernstnehmen, wenn es nur das zu hören, zu lesen, zu sehen bereit ist, was es ohnehin schon kennt und zu praktikablen Vorurteilen verfestigt hat.
Da laufen die Leute nicht nur als touristische Horde, sondern auch als Bildungsbürger zu Millionen in die Museen, um dort maulend zu beklagen, daß man sie vor den Werken allein lasse; sobald aber einige angeblich in ihre eigenen Theorien selbstverliebte Kunsthistoriker, Ästhetiker, Wahrnehmungspsychologen oder Pädagogen sich zur Hilfestellung andienen, macht das Publikum unmißverständlich klar, daß man es bitte mit längeren theoretischen Erörterungen verschonen möge. Diese alltäglich demonstrierte Idiotie läßt nur den Schluß zu, daß die inzwischen auch beim Publikum sprichwörtliche „Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst“ immer noch als Begründung für die Unfähigkeit von Künstlern und Kulturschaffenden verstanden wird, das Werk selbst sprechen zu lassen, so daß man, gar noch theoretisch, zu den Werken und über die Werke, beziehungsweise über Konzepte und Intentionen von deren Urheber zu reden gezwungen sei. –
In der Tat hat ja A. Gehlen, der Formulierer jenes Kalenderspruchs über die Kommentarbedürftigkeit, sich mit diesem Diktum den Zumutungen zeitgenössischer Kunstwerke entziehen wollen. Denn hätte er sein Diktum in dem Sinne gemeint, daß ein unmittelbar spontaner Zugang zu den Kunstwerken der Zeit ebenso möglich ist wie der Zugang zu anderen Konstrukten im Auto oder PC, dann hätte ihm auffallen müssen, daß auch nichtmoderne Werke auf die gleiche Weise kommentarbedürftig und abhängig von theoretischen Vorgaben gewesen sind.
Gehlen, wie die Mehrzahl seiner Wissenschaftlerkollegen, theoretisierten unter dem Deckmantel, Wissenschaft zu betreiben, kaum mehr als ihren weltanschaulich motivierten Unwillen, sich den eigenen Einsichten zu beugen. Als Wissenschaftler wußten sie recht gut, daß ohne theoretische Vorgaben auch die intensivste Anschauung blind bleibt und daß theoretische Konstrukte bloße Baukastenspielchen bleiben, wenn sie nicht dazu entwickelt werden, konkrete Aufgaben zu bewältigen. Theorie war und ist für Denker dieses Schlages Kaschierung der Ratlosigkeit vor den Denk- und Wahrnehmungsaufgaben, die uns die Werke stellen. Wer kann es sich aber, zumal als öffentlich bestallter Wissenschaftler, leisten zuzugeben, daß er diesen Aufgaben ebenso wenig gewachsen ist wie das nichtspezialisierte Durchschnittspublikum? Da dient die Theorie nur zur nachträglichen Begründung, warum es nicht lohne, sich mit den Werken überhaupt zu konfrontieren.
Ich habe in Aachen 1964, analog zu der damals geflügelten Frage nach Franz Josef Strauß: „Haben Sie überhaupt Abitur?“, die Formulierung von Gehlen gehört: „Haben denn Ihre Künstler überhaupt Philosophie studiert?“ Na also! Ausgerechnet so etwas von Gehlen, dem ja von Fachphilosophen mehr als einmal vorgehalten wurde, seinerseits kein Philosoph, sondern bloßer Soziologe zu sein! Und was sagten die ihres eigenen Anspruchs so selbstgewissen Philosophen? „Den Gegenstand selber reden läßt jedoch nur die Kunst, deren ontologische Relevanz bisher allerdings keineswegs zureichend untersucht worden ist. Das Vokabular der Philossphie, ihr begriffliches und methodisches Instrumentarium ist dafür nicht geeignet", schrieb Hans Heinz Holz zum 65. Geburtstag Adornos. Wie denn nun? Wenn es um ontologische Relevanz geht, dann kann die ja wohl nur mit dem Vokabular und Instrumentarium der Ontologen untersucht werden, und das ist ja wohl auch hinreichend geschehen. Wer mehr zu können glaubt, hätte das ja zeigen können; aufs Vokabular und Instrumentarium kann es wohl gerade bei einer Ontologie kaum ankommen: Die Ontologie wird den Gegenstand selber so wenig reden lassen können wie die Kunst. Dergleichen Theoretiker wollen sich nur als Wissenschaftler selbst überhöhen mit dem geheimnisvollen Hinweis, sie seien im Unterschied zu all ihren Vorgängern in der Lage, mit der Begründung ontologischer Relevanz Richter über die Machwerke der Kunst zu spielen.
Solche theoretischen Positionen laufen am Ende auf das gleiche hinaus, wohin ein die Theorie bemühender Galerist oder ein Künstler in einem Verkaufsgespräch ihren Kunden hinführen wollen: zur gläubigen Unterwerfung unter das Wesentliche, das nicht erarbeitet, sondern nur hochpriesterlich „entborgen“ werden darf. Eine ausgemachte Barbarei, die mit ihrem Anspruch auf theoretische Stringenz nur um so nichtswürdiger ist. Daß diese Barbarei und dieser Wissenschaftskitsch gerade durch den Widerstand, den er provoziert, immerhin die kulturelle Entwicklung zu beeinflussen, ja zu befördern vermag, muß anerkannt werden. Niemand wußte das besser darzustellen als Adorno, weil er den Schrecken erfahren hatte, der von den Wirkungen ontologischer Relevanznachweise gegenüber Kunst und Kultur ausgegangen war. Mit allem Nachdruck versuchte er deshalb, die Ästhetik den approbierten Philosophen, insbesondere den Ontologen, zu entreißen. Welche Anstrengung und Leistung das kostete, läßt sich von heute aus besser erkennen als zu seinen Lebzeiten.
Wie wenig er ästhetische Theoriebildung als bloße nachträgliche Rationalisierung künstlerischer Potenzgesten, wissenschaftlicher Niveauforderungen und gesellschaftlichen Machtgewinns verstanden hat, scheint dennoch sogar für seine heutigen Verteidiger unverständlich. Rolf Wiggershaus legt seine jüngst erschienene Würdigung Adornos weitgehend als Fragestellung aus, um dann immer wieder nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß Adorno auf diese Fragen die Antwort schuidig blieb. Hätte Adorno gefragt, um die Fragen zu beantworten, dann hätte er darauf gewiß so gut begründete Antworten geben können wie nur irgendeiner. Adorno entriß die Ästhetik der Philosophie, gerade weil er die ästhetische Theoriebildung aus diesem Schema wohlfeiler Fragestellung und triumphal selbstevidenter Antworten befreien wollte.
Wiggershaus schreibt: „Bei aller Problematik seiner Konzeptionen ist die Summe seiner Gedanken zur Ästhetik, die ästhetische Theorie, bis heute das kunstphilosophische Werk mit dem größten Anregungspotential.“ Auch wenn man aus dieser Aussage nicht nur die Nähe zur Appetithäppchenkultur herausliest: wieso können theoretische Konzeptionen pejorativ als problematisch gekennzeichnet werden, wenn es in dieser Ästhetik gerade um die Entwicklung von Problemstellungen geht? Die von Adorno entdeckten Probleme und nicht seine Konzeptionen sind anregend, wenn es schon bei dieser feingeistigen Kennzeichnung einer Stimulanz bleiben soll.
Das überaus Bedeutsame an Adornos ästhetischer Theorie liegt, zumindest von heute aus gesehen, darin, daß Adorno Theoretisieren als Thematisieren und nur als solches begründete. Thematisierung aber kann es nur in Form einer Problematisierung geben, die grundsätzlich nicht im ausgefuchsten methodisch-systematischen Selbstlauf oder in Problemlösungen, also jenen nachgefragten unproblematischen Antworten, stillgelegt werden kann. Hierin liegt auch der Grund für die Annahme Adornos, daß zumal ästhetische Theorie nur als Kritik daran zu hindern ist, in kindische Systemspielereien oder auch in kindlich behauptete Naivität überwältigender Unmittelbarkeit einzumünden. Kritik ist Problematisierung, die ihre Leistungsfähigkeit erst erweist, wenn ihr nicht mehr abverlangt wird, das Kritisierte durch ein Anderes, Besseres, weniger Kritisierbares zu ersetzen.
Der theoretische Naive glaubt, daß sich die Probleme von selbst verstünden; er möchte die Denkanstrengung darauf verpflichten, ihm diese Probleme vom Hals zu halten durch unproblematische Antworten, auf die er sich verlassen kann. Er verlangt von der Theorie die Entscheidung darüber, das einwandfrei Haltbare vom Problematischen zu unterscheiden, das er bestenfalls als anregend zu akzeptieren bereit ist.
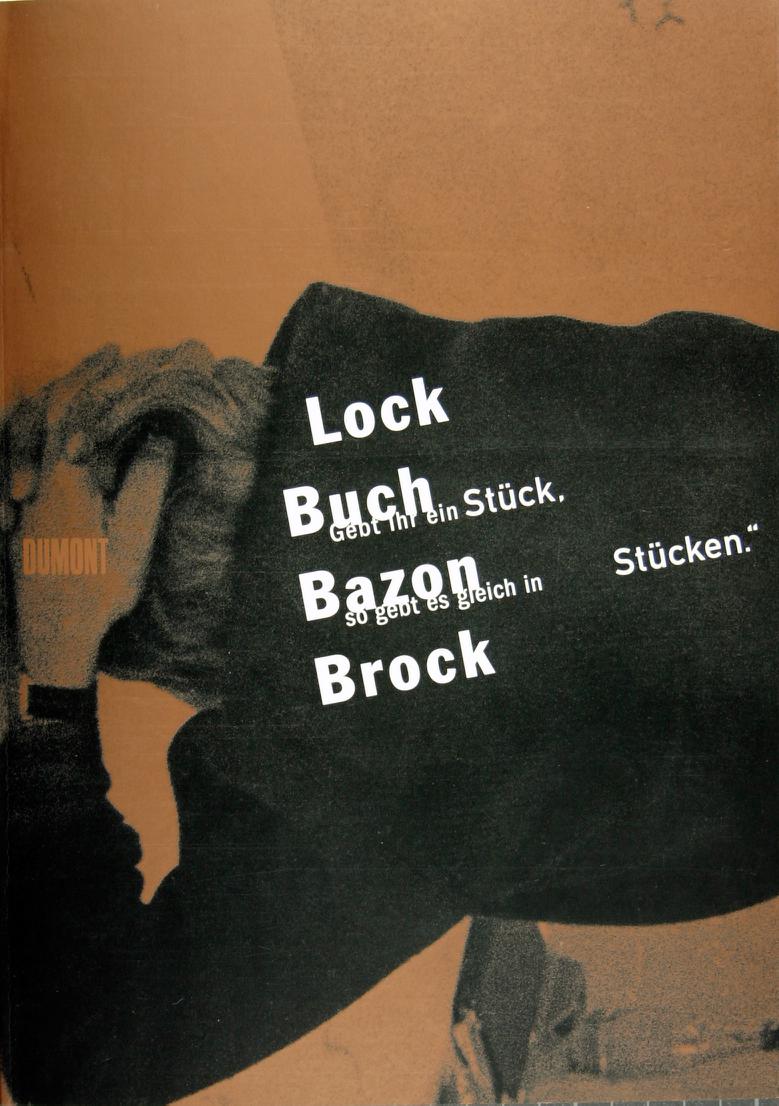 + 3 Bilder
+ 3 Bilder