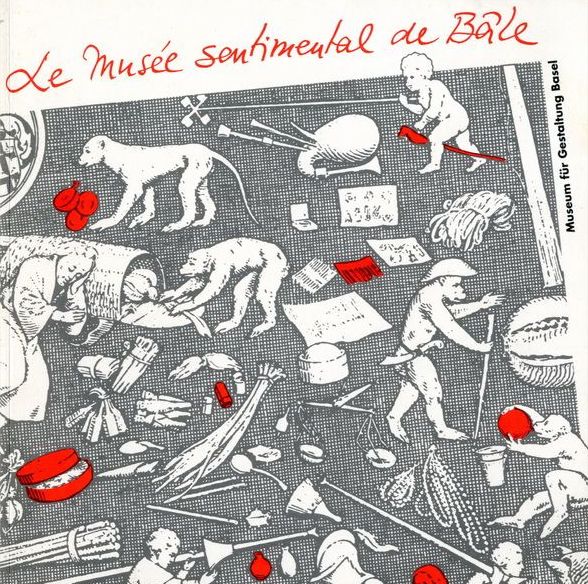Es ist ein Ort der Liebe zu den Dingen. Was wir lieben, wollen wir nicht nur über den Anlass seiner Entstehung und seines Gebrauchs hinaus erhalten. Wir wollen diesen Dingen einen Wert geben durch unsere Liebe zu ihnen, durch die Aufmerksamkeit, die wir ihnen gewähren. Wir lieben sie nicht, weil sie wertvoll sind, sondern sie haben Wert, weil wir sie lieben, wir oder andere Menschen, auf die es uns ankommt.
In historische Museen oder Kunstmuseen werden Dinge aufgenommen, weil sie als geschichtliche Zeugnisse oder Kunstwerke einen Wert in sich darstellen. Solche Museen wollen uns diese Werte nahebringen, indem sie geschichtliche Ereignisse und deren Zusammenhänge rekonstruieren oder die Entwicklungsgeschichte der Künste darstellen, in deren eigenständiger Logik die einzelnen Werke eine bedeutende Position einnehmen. Um historische Zusammenhänge oder die Entwicklungslogik der Künste darzustellen, bedarf es verbindlicher Kriterien, nach denen die Objekte der Museen geordnet werden. (Zum Beispiel geordnet auf Grund der Annahme einer kalendarischen Zugehörigkeit der Werke zu Stilen, Meisterwerkstätten, regionalen Kulturzentren, Sammlungen; geordnet im Hinblick auf Verwendungszwecke und Funktionsweise der Objekte; geordnet anhand der Materialien und Macharten der Objekte.)
Insofern man solche Ordnungen auch 'lieben' kann, insofern wir also in historischen und kunstgeschichtlichen Museen nicht Objekte, sondern Ordnungen als erzählte Zusammenhänge über die Objekte ausgestellt sehen, könnten diese Museen ebenfalls sentimentale sein; manch ein Kurator solcher klassischer Museen scheint in diese Ordnungen geradezu leidenschaftlich vernarrt zu sein – leider nur in die Ordnungen und weniger in die Objekte, die ihm eher ein Vorwand für das Betreiben des Museums sind, als dass er sie dort wirksam werden liesse.
Für sentimentale Museen gelten solche Ordnungskriterien nur ganz indirekt. Am besten hätten sie gar keine Ordnungen, sondern ermöglichten den Zugang zu den Objekten direkt und voraussetzungslos; denn sentimentale Museen vermitteln die Werke nicht über die Rekonstruktion von Geschichte, sondern über Geschichten, die zu den Objekten erzählt werden. Für diesen Typ des Museums gibt es nur ein Ordnungsproblem, nämlich wie die einzelnen Objekte und die zu ihnen gehörigen Geschichten zusammengeführt werden können. Um das zu gewährleisten, müssen Objekte und Geschichten – in welcher Reihenfolge auch immer – wenigstens mit Zahlen oder Buchstaben benannt werden, ohne dass diese Numerierung irgendeine inhaltliche Bedeutung hätte.
Daniel Spoerri, der Wiederentdecker des Musée sentimental, das früher den Namen Kunst- und Wunderkammer trug (siehe dazu Brock 'Zur Rekonstruktion einer zeitgenössischen Kunst- und Wunderkammer' im Katalog zu Daniel Spoerris 'Musée sentimental de Cologne' 1979), wählte und wählt für seine Objektordnungen die alphabetische Reihenfolge, wie sie in Lexika verwendet wird. Sprechende Objekte eines Kulturraums (einer Stadt) von A bis Z zu zeigen, hat in unserem Sprachgebrauch auch immer etwas von einer Präsentation der Welt als ganzer, einer Enzyklopädie des Bemerkenswerten, Bedeutsamen und Ausserordentlichen. Unser A bis Z geht auf das griechische Alpha bis Omega zurück, das nach dem Verständnis christlicher Theologie auch als Anfang und Ende der Welt, der Schöpfung, des Lebens gelesen werden sollte. Die Auflistung der Objekte von A bis Z bildet einen Leporello der Namen alles dessen, was in dieser Welt geliebt wird – dabei werden auch Begriffe als blosse Namen für Sätze verstanden. Das Musée sentimental bietet Namensrollen der Obsessionen für Ereignisse, Personen und Dinge wie Leporello die Namenslisten der Liebschaften Don Juans bietet. Mit jedem Namen ist eine Geschichte verknüpft; sie nacheinander erzählen zu müssen, aber eigentlich zugleich erzählen zu wollen, lässt den Museologen des Musée sentimental zu einem Epiker werden, weniger zu einem Chronisten; er bietet eher einen Erlebnisbericht seiner Abenteuer als deren Dokumentation; er konstruiert nicht wissenschaftlich eine Ordnung der Dinge, sondern verflechtet die Erzählungen über sie zu einem Reigen der Bilder, Visionen, Spekulationen, wie sie der Mythos, die Märchen und Sagen des anonymen Volksmundes vortragen.
Erzählungen entstehen ganz selbstverständlich über auffällige Sachverhalte, über Kuriosa, d.h. über das, was die Neugierde erregt und die Phantasie beschäftigt. Deshalb wird das Musée sentimental unter den vielen, vielen Objekten, die sich in Jahrhunderten in einem Lebensraum wie einer Stadt angehäuft haben, vor allem diejenigen auswählen, die besonders kurios sind, also phantasieerregend wirken. Dass dabei nicht nur ein Kuriositätenkabinett wie eine Jahrmarktsattraktion herauskommt, dafür hat die Art der Geschichten, Informationen und Annotationen zu sorgen, mit denen das Musée sentimental seine Objekte auszeichnet. Es sind aber auch andere Geschichten, Informationen und Annotationen, als sie in historischen und kunstgeschichtlichen Museen zu deren Objekten geboten werden, denn im Musée sentimental soll ja ein anderer Zugang zu und ein anderer Zugriff auf die Objekte geboten werden – ein Gebrauch der Objekte, der sie zum Beispiel zu Fetischen, Reliquien, Amuletten werden lässt oder als solche entdeckt.
Dies scheinen dem wissenschaftlichen Denken ganz unzeitgemässe Objektcharaktere zu sein, primitive, atavistische. Aber die sentimentalen Museen des Daniel Spoerri – wie auch die Museen der Obsession des Harald Szeemann – demonstrieren mit guten Gründen, dass einerseits auch das moderne Denken, das wissenschaftlich-rationale, bei weitem nicht so frei von Fetischisierungen ist, wie es das gerne sein möchte – viele wissenschaftliche Begriffe werden von Wissenschaftlern selber wie Fetische benutzt –, und dass andererseits der Gebrauch von Objekten als Fetische, Reliquien, Amulette genauso funktional sein kann wie der technische Zugriff auf sie. Diese Funktionalität wird zum Beispiel im Erklärungsmodell der sich selbst erfüllenden Prophetie dargestellt. In jedem Falle kommt es in sentimentalen und obsessionellen Museen gerade auf die intensive, wirksame Form des Gebrauchs und der Zuwendung zu Objekten an, wie sie der Ikone, dem Fetisch, der Reliquie, dem Amulett, dem Totem, dem Talisman, der Fahne, dem Markenzeichen, dem Signet, dem Logo, dem Souvenir entgegengebracht werden. Denn die Dinge sind weitgehend für uns das, was wir aus ihnen machen, und sie sind für uns das, als was sie auf uns wirken, obwohl wir sie selbst gemacht haben. Das Musée sentimental ist also dadurch ein Ort, an dem wir unsere Liebe zu den Dingen entfalten können, dass wir dort die Bereitschaft zeigen dürfen, die Dinge in einer ganz anderen Weise auf uns wirken zu lassen, als in einem Museum herkömmlicher Art. Im Musée sentimental erhalten wir die Möglichkeit, zum Beispiel das Beten vor Bildern gleichermassen als Objektgebrauch ernstzunehmen wie das Verbrennen des Tyrannenporträts; die sexuelle Stimulation durch einen eleganten Damenschuh wie die Stützung von männlichem Selbstbewusstsein durch das Tragen von Uniformen; die Sicherung eines Hauses vor Unheil durch die Kreideinschrift CMB wie die Sicherung eines Territoriums durch Hissen einer Fahne; die Aneignung eines Kunstwerkes als Statussymbol wie die Aneignung eines Knochens als heilsbringende Reliquie; die Verwandlung einer Lage Filz in einen Energiespeicher wie die Wandlung einer Oblate in den Leib Christi.
Das alles sind Formen des sentimentalen, obsessionellen Umgangs mit Objekten, die nicht nur vorwissenschaftlich denkende, vortechnisch bastelnde und irrational handelnde Menschen in ihrem Verständnis sinnvoll anwenden, sondern die – wie sich inzwischen herausgestellt hat – umso wirksamer sind, je besser wir über sie aufgeklärt werden. Autosuggestion wird heute als klinische Behandlungstechnik anerkannt; Biofeedback desgleichen; über Fetischisierung lädt uns die Werbung Güter mit Anreizen auf, die auch dann wirken, wenn wir uns darüber völlig klar sind, dass diese Reize gemacht werden, um uns zum Kauf der Güter zu überreden; wenn diese Wirkungspotentiale der Objekte nur von den Werbern willkürlich erfunden würden, blieben sie ganz folgenlos.
Immer mehr Menschen lesen die in Zeitschriften abgedruckten Horoskope des Tages, der Woche, des Jahres als Anleitung zur Selbstkonditionierung, die die Voraussetzung dafür nachweislich erhöht, dass gewünschte oder gefürchtete Ereignisse bei den ansonsten unauffällig absolvierten Tagesaufgaben thematisiert, also wahrgenommen und ins Kalkül gestellt werden können. Und Beten ist gerade für alle, die über Psychomechanismen aufgeklärt sind, nicht länger bloss ein aussichtsloses Herbeiphantasieren von Hilfe der Himmelsmächte, sondern Form der menschlichen Selbstvergewisserung in Ängsten vor kosmischen Verlorenheitsgefühlen, Raumfahrten aller Art – auch die Exponierung des Ichs im kalten sozialen Kosmos – lehren beten, lehren Selbstvergewisserung vor der Furie des Verschwindens durch die rituelle Wiederholung des einzig Selbstverständlichen: ich bin ein Mensch wie alle andern auch, und was als letzte, entscheidende Frage allen Menschen zugemutet wird und von ihnen auch bewältigt wird, das ist auch von mir zu leisten. Dessen kann ich gewiss sein! Bin ich es nicht, so habe ich meine Hinwendung auf andere Menschen zu verstärken. Alle Beziehungen der Menschen untereinander laufen aber über die Objekte der Aussenwelt, seien sie natürlich gegeben oder kultürlich hergestellt. Auch unsere Gedanken und Vorstellungen vermitteln sich uns und anderen über objekthafte Vergegenständlichungen und seien es die gesprochene Sprache oder gesungene Tonfolgen. Andererseits bedeuten uns irgendwelche gegebenen Dinge auch nur etwas im Hinblick auf andere Menschen und unsere Beziehung zu ihnen. Deshalb verbinden sich für uns die Dinge mit den Formen und Absichten unserer Beziehung auf und mit anderen Menschen; die Dinge werden zu Trägern unserer Leidenschaften und Kalküle, die wir auf andere Menschen hin entwickeln. Mit dem Gebrauch der obsessionellen, sentimental besetzten Dinge, die dadurch zu Objekten werden, entfalten wir also Beziehungen zu anderen, wobei die Objekte stellvertretend für diese anderen, tatsächlich gemeinten Menschen werden können. Als deren Stellvertreter sind die Objekte gleichsam agierende Subjekte, was sich im englischen Sprachgebrauch von Objekt als 'subject' noch besonders gut verstehen lässt. Dahinter steht die, seit etwa 300 nach Christi, kodifizierte Erfahrung, dass Menschen selber Objekte, zum Beispiel der staatlichen Finanzgesetzgebung oder der Naturgewalten oder der Geschichte sein können. Da alle Menschen ihre derartige Instrumentalisierung oder Verdinglichung, ihre Erniedrigung zum blossen Objekt fremder Kräfte oder Mächte fürchten, und demzufolge auch viele andere Objekte (Menschen wie Dinge) als Agenten oder Träger solcher Kräfte fürchten, entwickeln sie eben jenen sentimentalen und obsessionellen Gebrauch der Dinge und entfalten Beziehungen über diese Dinge zu anderen Menschen und Mächten.
Sentimental heisst hier wie schon bei Friedrich Schiller das Gegenteil von naiv, nämlich: die Steuerbarkeit und wunschgemässe Ausrichtung der Kraft der Objekte auf sich oder andere Menschen. Der sentimentale Gebrauch der Objekte heisst deren Aktivierung in vollem Bewusstsein der Tatsache, dass nicht die Objekte selbst wirken, sondern dass sie unsere Psychomechanismen aktivieren, durch deren Tätigkeit wir Wirkung erleben.
Naiver Gebrauch der Objekte heisst deren Aktivierung in der Annahme, die Objekte selbst verfügten über Kräfte, die sie von sich aus gegen oder für uns entfesseln könnten. Nichtsdestoweniger haben wir mit dieser Naivität jederzeit zu rechnen – so zeigt [es] uns das Musée sentimental. Und die Sozialpsychologie bringt das im Thomasaxiom aufs Prinzipielle: was Menschen auch immer für wirklich und wirksam halten, wird wirklich und wirksam durch die Konsequenzen dieses Dafürhaltens. Wenn einer naiverweise animistisch beseelte Objekte für wirklich aktionsfähig hält und deswegen zum Beispiel sein Haus lückenlos vernagelt, dann wird das wirklich existente, vernagelte Haus für ihn den Beweis der Wirklichkeit von Geistern abgeben.
In diesem sentimentalen Umgang mit den Objekten unterscheidet sich das Musée sentimental ganz ausdrücklich nicht nur von den klassischen Museen (die es aber erst seit etwa 200 Jahren gibt – teilweise als Errungenschaft der französischen Revolution), sondern auch von den Sammlungen der Spurensicherer und Alltagsgeschichtsschreiber. Deren Tendenz zur Musealisierung des Banalen ist darin bedeutsam, dass das Selbstverständliche in ihnen thematisiert wird, wodurch es sich als überaus problematisch erweist – ganz gegen die verbreitete Auffassung, das Gewöhnliche sei unbedeutend. Was uns durch alltäglichen Umgang vertraut wird, muss damit noch keineswegs tatsächlich erkannt oder angeeignet sein; wer das angeblich Selbstverständliche zum Problem macht, kann sogar eine Fülle von Sensationen des Alltäglichen entdecken. Das Sensationelle ist nicht nur das vom Selbstverständlichen und Banalen Abgehobene, Unerwartete und Ausserordentliche; es ist vielmehr sensationell, dass wir es wagen, irgend etwas als selbstverständlich hinzunehmen und es wagen, uns darauf bloss deshalb zu verlassen, weil wir es eben für selbstverständlich halten wollen.
In einem Punkte nimmt auch das Musée sentimental diese Spurensicherung und Problematisierung des Banalen auf. Durch den sentimentalen Gebrauch der Objekte, der vornehmlich als Erzählung über deren Wirkungskräfte sichtbar wird, wandelt sich die Wahrnehmung der Objekte, wodurch dem sentimentalen Museologen häufig Entdeckungen gelingen, die dem spezialisierten, also mit eingeschränktem Blick operierenden Fachwissenschaftler entgehen mussten. Die zufällige, bloss formale Ordnung des Musée sentimental in lexikalischen Reihungen bietet die willkommene Gelegenheit, konventionell Unvereinbares, also sachlich und fachlich voneinander Unterschiedenes doch wieder miteinander in Beziehung zu setzen und dabei überraschende Wechselwirkungen der Objekte und Erzählungen zustande zu bringen. Das gelingt dem sentimentalen Museologen Daniel Spoerri vor allem durch seine herausragende künstlerische Fähigkeit, die Objekte zu inszenieren, d.h. einen wesentlichen Teil der sentimentalen Erzählungen in die Art und Weise aufzunehmen und in ihr sichtbar werden zu lassen, wie die Objekte und Objektensembles präsentiert werden. In der Inszenierung des Theaters der Objekte werden die sentimentalen Erzählungen wie dramatische Texte eingesetzt; die theatralischen Handlungen mit den Objekten vollziehen die Ausstellungsbesucher in ihrer Vorstellung, sich diesen Objektwirkungen auszusetzen und sich von ihnen beeinflussen zu lassen. Der Besucher befindet sich gleichsam auf der Bühne mit vielen sprechenden Objekten, die ihn zu Aktionen veranlassen, ohne dass für seine Rolle ein Textbuch vorhanden ist. Er schreibt sich selber seine Rolle als Spur seiner Bewegung durch szenische Wirkung der Objekte. Die Objekte suchen im Besucher einen Autor, der die vielen Geschichten auf eine nur ihm mögliche Weise miteinander verknüpft. Das genau ist die dem Besucher eines Musée sentimental ermöglichte eigenständige Leistung von Produktivität: er entwickelt seine soziale Biographie durch Aneignung der Objekte, die in seinem sozialen, kulturellen Lebensraum, in seiner Stadt also, angehäuft wurden und die ihm das Musée sentimental präsentiert. Diese Leistung geht weit über die Musealisierung des eigenen Lebens hinaus. Wer seine Schuhkartons voller alter Fotos und anderem Lebensplunder auskippt, um seine persönliche Biographie dingfest zu machen, bleibt eben aufs Persönliche beschränkt; es sei denn, er liehe sich bei Anderen Formen und Typen der sentimentalen Erzählungen aus, die er seinen Lebenszeugnissen überstülpt. Diese Mythologisierung durch Musealisierung des eigenen Lebens betreiben heute offenbar mehr Alltagsmenschen als je zuvor. Gerade deshalb ist das professionelle Musée sentimental des Daniel Spoerri so wichtig. Es fordert unsere Bereitschaft heraus, uns mit naiven Privatmythologien nicht zufrieden zu geben. Sentimentale Lieben gelingen nur dort, wo die Liebenden sich gemeinsam auf ein Drittes beziehen, das Objekt der Begierde, der Leidenschaft und Sehnsüchte, die prinzipiell unstillbar sind, und die deshalb auch im Musée sentimental nicht befriedigt, sondern erfahrbar gemacht werden.