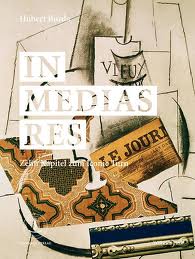Dr. Hubert Burda / Prof. Dr. Bazon Brock
Hubert Burda: Wie lässt sich der Begriff des ,,Iconic Turn" erklären?
Bazon Brock: Auf der alltagstauglichen Ebene meint ,,Iconic Turn“: vom Weltbild zur Bilderwelt. Die allgemeine Zustimmung zum Gegenstand der Mitteilung wird durch das Bild und nicht mehr durch Begriffe organisiert. Weltbilder sind Begriffshierarchien, Architekturen der Begrifflichkeiten. Bilderwelten hingegen sind organisierte Einheiten im Bild, die etwas mitteilen. Auf Lateinisch heißt das Evidenz. Und auf Griechisch heißt Evidenzerleben Autopsie. Herodot ist derjenige, der einführt, dass ich mit eigenem Augenschein gesehen haben muss, wovon ich spreche, um es mit anderen teilen – also mitteilen – zu können.
Was hat das mit dem „Iconic Turn“ zu tun?
Das habe ich ja gesagt: vom Weltbild zur Bilderwelt. Bilderwelt soll heißen, dass das, was wir gemeinsam teilen, über die Bilder schneller und ökonomisch sinnvoller geworden ist, dass wir damit aber auch in höherem Maße einer Täuschbarkeit ausgesetzt sind.
In der Hirnforschung hat man festgestellt, dass es ein Sprachsystem und ein Bildsystem gibt. Besteht die Gefahr, dass das Bildsystem das Sprachsystem ablöst?
Die Aufteilung in Bildsystem und Sprachsystem teilt heute kein Fachmann. Das Beziehungsgefüge zwischen Wortsprache und Bildsprache kennt man längst. Es geht um das Zusammenspiel zwischen der Kognition, das heißt der Fähigkeit, Begriffsbildungsarbeit zu machen, und der Imagination und Repräsentation. Oder, und das ist das Entscheidende, es geht um den Gewinn einer Strategie, die man emblematisches Denken nennt. Diese Strategie macht Evidenzkritik durch Evidenzerzeugung möglich. Wie erhalten wir die Möglichkeit, auf verlässliche Erkenntnisse zu kommen? Das Gehirn hat evolutionär seine fantastische Leistungsfähigkeit gerade dadurch gewonnen, dass es täuschbar ist und dass es zum Beispiel nicht in der Lage ist, Begriffskonstruktionen komplett in Bilder umzusetzen. Deswegen kann der „Iconic Turn“ niemals bedeuten, dass wir uns von der Begriffskonstruktion, ja von kognitiven Prozessen verabschieden und auf Evidenzerlebnisse durch Bildersehen umschalten.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das Emblem ein entscheidendes Phänomen des Prozesses.
Das Emblem ist eine Strategie. Sie ist von Anfang an innerhalb der Menschheit angelegt. An der Höhlenwand ist das Jagdtier abgebildet, um Name und Sache zusammenzubringen. Die Emblematik als ausgebildetes Instrument beginnt in der Zeit, in der die Philosophen die Begriffsbestimmung für wesentlich zur Erkennbarkeit des Visuellen halten.
Wann ist das?
Zur Zeit des Streits zwischen den Sophisten und Platon. Platon entwickelt eine ablehnende Haltung gegenüber den Bildern, weil das Evidenzerleben so überwältigend sei, dass die Menschen sich von der Wahrnehmung der Erscheinung als Anspruch auf Geltung und Wahrheit täuschen ließen. Platon zwingt die bildliche Evidenz unter die Kritik des begrifflichen philosophischen Arbeitens, um eine neue Ebene der Evidenz zu erzeugen – die der Idea.
Wie verhält es sich aber in der griechischen Kunst?
Also etwa in der Vasenmalerei? Dort taucht als Aufschrift immer der Name des Helden auf, oder dieser ist durch die Erzählung der Gemeinschaft derer gesichert, die das Bild sehen. Jeder weiß: Das ist Herakles. Die Vase war in diesem Sinne der meist verbreitete Bildträger. Deswegen gab es die Möglichkeit, bei jedem gemeinsamen Essen oder Betrachten sofort auf die Themen aufmerksam gemacht zu werden. Man rekapitulierte die Mitteilung als das gemeinsam Geteilte, indem man sagte: Und hier sehen wir, wie Hektor niedergemacht wird.
Also eine Art Fernsehen?
Eine Art Fernsehen, aber Fernsehen ist der falsche Name, weil wir nie fernsehen. Der einzige Mann, der Fernsehen realisiert hat, ist Alberto Giacometti. Der hat Figuren gemacht, die in der Nähe betrachtet so aussehen, als würde man sie in zwei Kilometer Entfernung sehen.
Springen wir in die Gegenwart. Zu den heutigen Massenmedien. Nach Jahrhunderten der Zeitungen stellt sich die Frage, ob und wie diese sich gegenüber den neuen digitalen Medien behaupten können.
Es hängt nicht an den materiellen Trägern. Die Brot-und-Spiele-Strategie der Römer hat genauso schon massenmediale Phänomene hervorgerufen. Denn Brot und Spiele ist das Programm der Massenmedien. Und es geht darum, das vorzuführen, was eine möglichst große Anzahl von Menschen in einer bestimmten sozialen Situation, einer Gemeinde, einer Kulturregion als übereinstimmende Ebene hat. Massenmedial ist die Herstellung einer Beziehung zwischen den Dingen, die Erzeugung einer Evidenz. Allerdings fehlt es dieser in den Massenmedien an Kritik, und ohne die notwendige Kritik ist es auch keine Erkenntnis stiftende Evidenz.
Aber was geschieht jetzt, wenn die Leute, die Massenmedien machen, feststellen, dass sie nicht mehr durchkommen, weil jeden Abend siebzig Filme laufen, während früher nur einer lief. Der Gesprächsstoff verändert sich.
Die Konsequenz ist, dass wir nichts mehr miteinander teilen. Es gibt also keine Mitteilungen. Das ist eine unmittelbare Gefahr für einen Sozialverband, der belastbar Sein muss in Phasen der Nahrungsverknappung, der Klimaverschlechterung, der Bedrohung durch äußere Feinde. Wenn nichts mehr miteinander geteilt wird, haben die Medien keine Funktionen mehr innerhalb der Steuerung eines Verbandes. Die Konsequenz ist dann immer die gleiche: Es muss eine sektiererische Orientierung auf Exklusivität geben. Exklusivität im Sinne von Luxus oder viel Geld oder exotischem Wissen ist eine natürliche Strategie, um wieder zur Teilbarkeit von etwas zu kommen, was dann Mitteilung sein kann.
Es geht dabei immer um die Frage, wie man das organisiert, was Menschen miteinander teilen. Es gibt drei Ebenen, auf denen wir diese Gemeinsamkeiten definieren können. Einmal durch die Namensnennung, dann durch das, was wir bei diesen Namenszurufen in der inneren Vorstellung haben, das ist die Bildlichkeit. Und dann kommt das Entscheidende: die Fähigkeit, beide Ebenen, die begrifflichen Namen wie die Kognitionsebene in einem materiellen Träger, also im Medium zu verkörpern, zu medialisieren.
Kann die gesamte Entwicklung auch wieder zum Papier zurückgehen?
Die Kernfrage ist, ob diejenigen weiterhin belohnt werden, die auf Auflösung aller Mitteilung abzielen, aber auf der Ebene des Sozialen einfordern, dass andere sie ernähren. Die Kunden von Privatsendern haben ja keinerlei Möglichkeit mehr, die Welt als eine Mitteilung zu sehen, außer im simplen Fressen und Vögeln. Doch muss man ihnen dieses Problem erst klar machen. Die Amerikaner wussten von Anfang an, dass die Vielzahl der in die USA einströmenden Leute etwas Gemeinsames auf der Basis der Verfassung teilen müssen. Sonst entwertet sich die gesamte Lebenspraxis.
Und welche Stellung hat heute die Medienkunst?
Kunst ist vor rund 600 Jahren spezifisch entstanden im Hinblick auf eine Optimierungsstrategie. Vorher gab's keine Kunst. Es gibt keine chinesische, keine afrikanische, keine griechische, keine römische Kunst. Es hat in hohem Maße die Fähigkeit zum Gestalten, zum Bauen, zum Ornamentieren gegeben, aber keine Kunst. Sie entsteht erst im 14. Jahrhundert – mit Giotto, Dante, dann mit Petrarca, der das Programm ausarbeitete. In klassischen Gesellschaften ist Mitteilung auf die Autorität von sechs Legitimationsinstanzen beschränkt: was der eigene Vater sagt, was der Führer im kommunalen Zusammenhang oder in sonstiger Repräsentanz sagt, was der geistliche Führer sagt, was Tradition und Sitte sagen, und eine bescheidene Form, was mir die Natur als Horizont der Möglichkeiten sagt. Die Stabilität der Gesellschaft muss durch die Kultur, durch die Religionen, durch die Macht legitimiert sein. Doch dann kam man in Oberitalien auf folgende Idee: Wie viel interessanter, also mitteilungsvoller, wird die Welt, wenn man auch Individuen als Legitimationsurheber anerkennt? Diese Individuen nannte man Autoren. Da im Lateinischen Autor (auctor) und Autorität (auctoritas) dasselbe ist, entstand eine neue Form der Legitimation von Mitteilungen, nämlich Autorität durch Autorschaft.
Was war der Gegenstand dieser Autorschaft?
Es ging darum, wie man Interesse für Aussagen wecken kann, hinter denen weder Bestrafungsfurcht noch Belohnungshoffnung steht. Wenn der Fürst spricht und man weghört, wird man bestraft. Man hört also hin und betreibt Anpassungsheuchelei, dann wird man belohnt. Das Großartige bei der Entstehung der Kunst ist, dass Mitteilungen ohne Autorität der Kirche, des Papstes, des Geldes, des Marktes, nämlich allein durch die Künstler interessant gemacht werden.
Die Kunstgeschichte handelt davon, dass man zwischen Romanik, Gotik, Barock, Klassizismus zu unterscheiden lernt. Und jetzt haben wir eine Debatte über die neue Bildwissenschaft.
Vasari stellt in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Frage, was die Voraussetzungen dafür sind, dass Autorität durch Autorschaft überhaupt entstehen kann: Über welche individuellen Fähigkeiten muss jemand verfügen, um sich als Künstler zu entwickeln? Das ist zunächst einmal eine Frage nach der biografischen Voraussetzung, aber am Ende entsteht daraus eine Kunstgeschichte – dank der fabelhaften Einsicht, dass das eine Geschichte ganz anders als die Naturevolution, anders als die Technikgeschichte ist. Etwa beim Ackerbau ist die Geschichte eine Überbietung des jeweils Vorausgegangenen durch das Nachfolgende. Am Ende interessiert sich ein Bauer nicht mehr dafür, den Grabstock von vor 500 Jahren zu nehmen, sondern er wird den modernsten Pflug nehmen.
Im Unterschied dazu bewahrt die Kunstgeschichte auf jeder Stufe eine Gleichrangigkeit. Wenn Raffael als Schüler Peruginos genannt wird, dann ist durch ihn die Arbeit von Perugino nicht überboten, sondern Perugino und Raffael und Michelangelo und Caravaggio stellen, obwohl eine Entwicklung stattfindet, die Gleichrangigkeit aller historischen Erscheinungsformen dar, soweit sie Kunst sind.
Das also ist die Idee der Kunstgeschichte. Und wie verhält es sich bei der Bildwissenschaft?
Bildwissenschaft ist von der Kunstentwicklung abgekoppelt, denn die Medien der Gestaltung, der Ornamentik, der Verteidigungstechnik oder der Architektur sind ja ohne Künstler möglich gewesen. Jahrtausendelang haben Hochkulturen ohne Künstler gelebt. Die Bildwissenschaft ist insofern das Ursprünglichere. Die Kunst ist etwas Sekundäres, ein Sonderfall. Bildwissenschaft ist die Wissenschaft von der medialen Form der Prägung und Gestaltung.